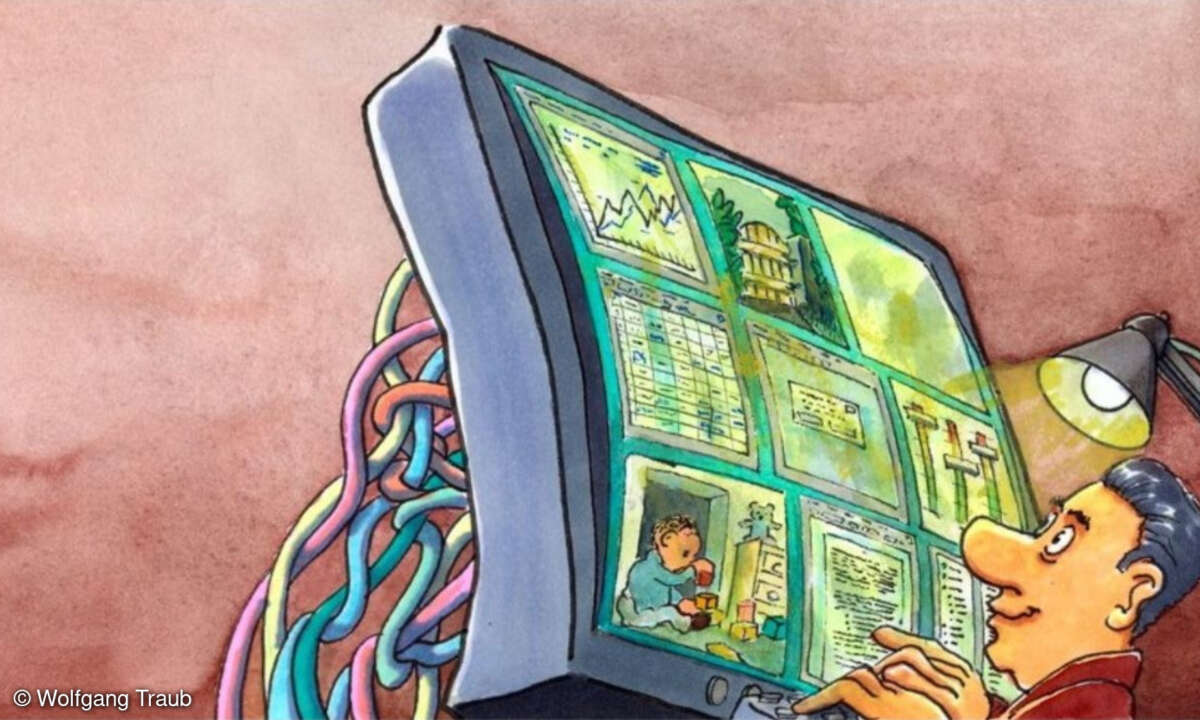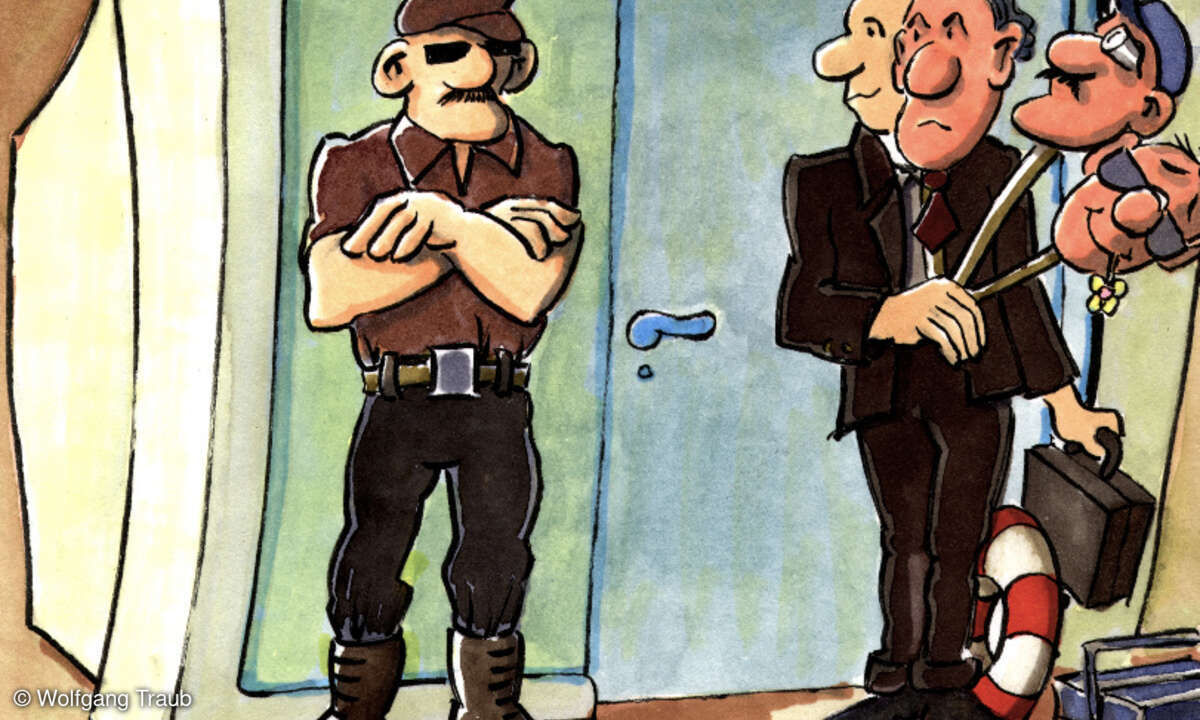Der Faktor Mensch
Wer Best Practices gemäß ITIL (IT Infrastructure Library) in die Tat umsetzen will, darf nicht halbherzig vorgehen. So groß der Vorteil strukturierter Prozesse nach Best-Practice-Methoden auch ist, so gravierend können letztendlich die Kosten ausfallen, die durch Sparsamkeit am falschen Ende entstehen. Insbesondere gilt es, den kritischen Faktor Mensch stets im Auge zu behalten.
Prozesse nach ITIL einzuführen bedeutet konkret, die als Best Practices (also in der Praxis als
optimal ermittelte Vorgehensweisen) etablierten Vorgaben konsequent umzusetzen. Diese Best
Practices sind aber keinesfalls fest zementiert, sondern können und müssen je nach individuellen
Erfordernissen durch eigene Konzepte erweitert oder ersetzt werden. Somit ist man auch bei
konsequenter ITIL-Umsetzung durchaus flexibel. Zu Beginn ist eine gründliche Analyse der bereits
verwendeten Prozesse unumgänglich. Die dazu erforderlichen Informationen gewinnt man nahezu
vollständig aus dem Unternehmen selbst. Für die Praxis bedeutet dies: die Veranstaltung von
Kick-off-Meetings, Befragung von Mitarbeitern sowie Durchführung von Assessments und Workshops. Die
Ergebnisse werden umso brauchbarer, je aktiver die Teilnehmer an der Erarbeitung der Ergebnisse
beteiligt sind. Dabei sollten die Teilnehmer immer einen Bezug zu ihrem eigenen Arbeitsumfeld
vorfinden oder diesen unmittelbar herstellen können. Der mitunter wichtigste Schritt ist
unternommen, wenn alle Beteiligten frühzeitig involviert sind. Ein ITIL-Projektleiter sollte hier
auf die vollständige Erfassung aller Gruppen achten, zumal die Bandbreite vom Management bis hin zu
den ausführenden Mitarbeitern ("Prozess-Performern") reicht.
Bei der Einführung von Prozessen erlebt man immer wieder, dass Mitarbeiter eine skeptische bis
ablehnende Haltung annehmen. Diese Tatsache sollte ein ITIL-Verantwortlicher keinesfalls
ignorieren, denn vielfach haben diese Mitarbeiter aus ihrer jeweiligen Perspektive betrachtet
durchaus Recht. Abhilfe schafft die Motivierung der Workshop-Teilnehmer dazu, aktiv eine andere
Perspektive einzunehmen. Dies kann beispielsweise in einem Rollenspiel erfolgen. Dabei gilt es zu
beachten, dass die in einem solchen künstlichen Szenario eingenommene Rolle fachlich nicht zu weit
von der tatsächlichen entfernt sein darf.
Bei der Fülle der Prozesse und Schnittstellen, die ITIL mit sich bringt, verlieren die
beteiligten Personen oft den Überblick. Häufig fehlt auch das Verständnis für neue Prozesse
jenseits der Abteilungs- oder Fachbereichsgrenzen. Dieses Phänomen ist durchgängig zu beobachten
und trifft sowohl auf kleine als auch auf große Unternehmen und Konzerne zu. Verständnis für das
Prozessumfeld ist jedoch für den Erfolg der Prozesseinführung unabdingbar. In geeigneten Workshops
kann ein ITIL-Projektteam gezielt die benachbarten Geschäftsprozesse transparent machen. Ziel ist
die Motivation der Teilnehmer, die Interessen jenseits der eigenen Abteilung zu verstehen.
Anschließend lassen sich als logische Konsequenz die IT-Prozesse der benachbarten Abteilungen
ableiten.
Je nach Zielgruppe ist jeweils der Fokus neu zu setzen. Während das Management tendenziell
besser für Business-Themen ansprechbar ist, ist im operativen Bereich eine Affinität zu technischen
Themen so gut wie selbstverständlich. Bei solch unterschiedlichen Gruppen gestaltet sich die
Schaffung von Verständnis für die jeweils andere Gruppe sicher schwierig. Ein Patentrezept gibt es
nicht. Hier sind individuelle Lösungen gefragt, die der jeweiligen Unternehmenskultur angemessen
sind.
Selbst wenn alle Beteiligten zunächst ihr Engagement oder Commitment beteuern, gelten
Veränderungen jedweder Art auch immer als Gefahrenpotenzial. Die Ängste des Einzelnen überlagern
dann den Prozessgedanken. Vor diesem Hintergrund werden scheinbar irrationale Verhaltensweisen oft
erst erklärbar, zum Beispiel dass mitunter Prozesse hervorragend ausgearbeitet und dokumentiert,
dann paradoxerweise aber nie in die Tat umgesetzt werden.
Hinzu kommt, dass jeder Mitarbeiter kurz- oder langfristig seine Arbeits- und Prozessumgebung
selbst optimiert. Bestenfalls geschieht dies zum Vorteil, aber nicht selten sogar zum Nachteil des
Unternehmens. Letzteres muss keinesfalls bewusst oder vorsätzlich geschehen: Wenn ein Mitarbeiter
sich stets in einem sehr eingeschränkten Bereich bewegt, wird er in der Regel auch nur innerhalb
der Grenzen seines Verantwortungsbereichs aktiv handeln und sich auch nur dafür interessieren. Der
Mensch überschreitet diese Grenzen ungern – der Prozess hingegen macht vor diesen Grenzen nicht
Halt. Informationsdefizite sind die Folge.
Dieses Problem lässt sich in der Regel durch den Einsatz eines externen Beraters lösen, zumal
dieser ohne Probleme bereichsübergreifend agieren kann. Da der Berater sich zu Beginn selbst einen
Überblick verschaffen muss, kann und muss er Informationen von allen Abteilungen einfordern.
Dadurch ist er prädestiniert, die versteckten Informationsdefizite der einzelnen Abteilungen
aufzudecken und sie im nächsten Schritt auszugleichen.
Für die Schaffung von Bewusstsein oder Awareness gibt es bei jeder ITIL-Einführung einen
konkreten Handlungsbedarf. Mangelnde Erfahrung, aber auch der damit einhergehende Mangel an
Glaubwürdigkeit derer, die im eigenen Hause ITIL einführen wollen, geraten schnell zu Fallen einer
erfolgreichen Einführung. Abhilfe schaffen so genannte Overview-Events, moderiert durch kompetente
Trainer mit Erfahrung aus der ITIL-Praxis.
Die Besetzung dieser Rolle kann zu einer Herausforderung werden, da das erforderliche Maß an
Prozesserfahrung am ehesten im Consulting anzutreffen ist, gleichzeitig aber auch didaktische
Fähigkeiten gefordert sind. Letztendlich ist aber entscheidend, dass sich im Verlauf einer
ITIL-Umsetzung die Schaffung von Awareness zu einem der wichtigsten Punkte entwickelt, die den
Einsatz entsprechend breit qualifizierter Trainer rechtfertigt.
Unternehmensweite Motivation ist ohne Unterstützung durch das Management nicht möglich. Hat man
diese erfolgreich eingeholt, kann man zur nächsten Gruppe übergehen: zum mittleren und unteren
Management. Dabei kann ITIL aber weder angeordnet werden, noch kann es unterschwellig ein
Unternehmen unterwandern. Zudem gibt es vielfältige Möglichkeiten, eine Prozesseinführung zu
vereiteln.
Bei der Erstellung des Einführungskonzepts sind alle beteiligten Rollen und Personen
einzubeziehen, angefangen vom Business-Management bis hin zu den ausführenden Prozess-Performern.
Dabei hat jede Gruppe ihren jeweils spezifischen Weg vor sich, das ITIL-Konzept zu durchdringen und
letztlich engagiert mit Leben zu erfüllen. So unterschiedlich diese Gruppen sind, so
unterschiedlich müssen auch die Strategien sein, diese Gruppen geeignet anzusprechen. Dazu ist die
Entwicklung zielgruppenoptimierter Workshops zwingend notwendig. Diese Flexibilität erzeugt
Mehrkosten, die im Hinblick auf die Resultate jedoch gerechtfertigt sind.
Prozess-Performer stehen zwar am Ende der Kette, deren überzeugtes Handeln ist aber mindestens
so wichtig wie das ihrer Vorgesetzten aus dem Management. Will man den Mitarbeitern die
bestmögliche Unterstützung bieten, ihre Prozesse in der Praxis handhaben zu können, wird man um die
Wahl geeigneter Tools nicht herumkommen. Auch hier ist letztlich der Faktor Mensch wieder
mächtiger, als man mutmaßen könnte: Oft entscheidet die Ergonomie über die dauerhafte Akzeptanz
eines Tools. Dabei setzen Prozess-Performern sogar oft die Prozesse direkt mit dem zugehörigen
Werkzeug gleich, allerdings zum Leidwesen derer, die sich um Awareness und Commitment bemühen. Die
Entwicklung geeigneter Ergonomie ist ein langjähriger Prozess. Beim Einsatz bewährter Tools
vermeidet man teures Reengineering, das sich später als unvermeidlich erweisen kann.