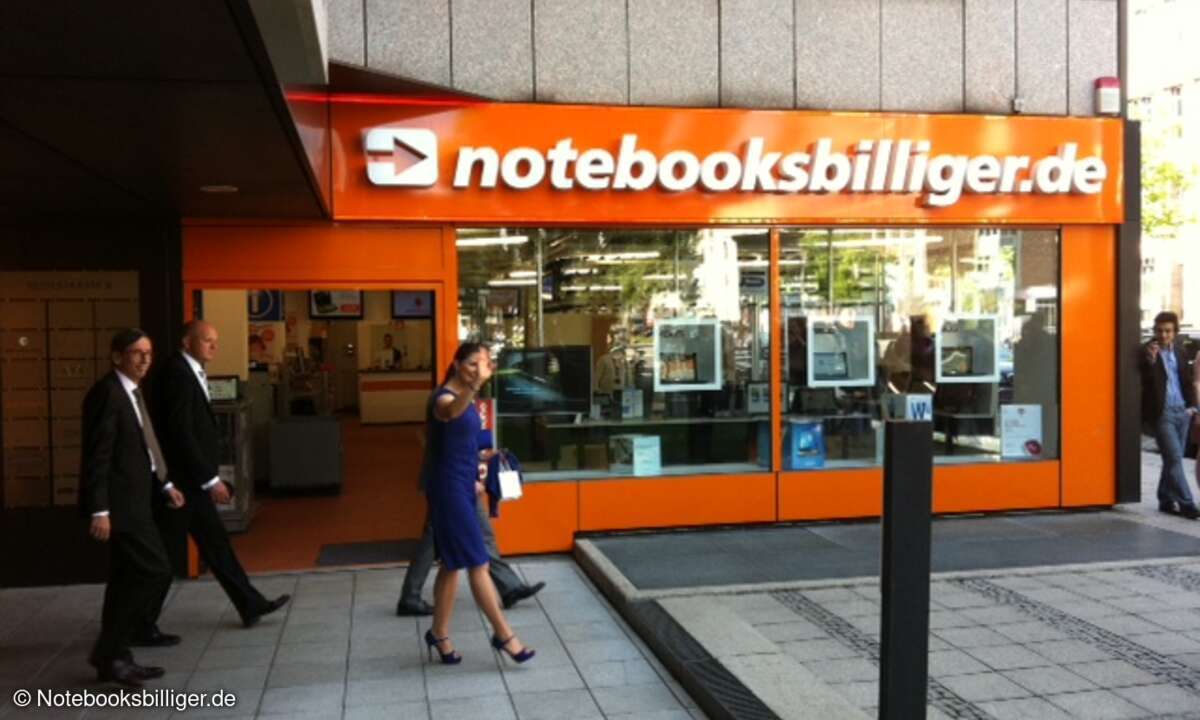Die doch nicht ganz serverlose Filiale
"Branch Office Boxes" (BOBs) sind Multifunktionsgeräte für die Anbindung von Niederlassungen an die Zentrale. Sie liefern zahlreiche Funktionen und Services, die in einer Filiale erforderlich sind, in Form eines vorinstallierten Geräts, also einer Appliance. Appliances nutzen meist proprietäre Betriebssysteme. Doch gerade im Fall der BOB machen sich die Vorteile einer Windows-Basis bemerkbar.
Einschalten und loslegen – so lässt sich der Begriff "Appliance" (was auf Deutsch schlicht "
Gerät" heißt) wohl am ehesten charakterisieren. Doch dann beginnt schon die Vielfalt: Appliances
sind eigentlich fertig vorinstallierte Geräte mit (meist proprietärem) Betriebssystem und Software,
aber einige Hersteller vermarkten spezielle Versionen einer Software, die komplett konfiguriert und
mit minimalem Aufwand zu installieren sind, als "Software-Appliances". Schließlich gibt es seit
Kurzem auch noch "Virtual Appliances": komplett vorkonfigurierte Images für
Virtualisierungsplattformen. Allen Varianten ist gemeinsam, dass sie eine klar definierte Aufgabe
verrichten und dafür optimiert sind.
Durch das Weglassen unnötiger Funktionen bei den proprietär betriebenen Appliances lassen sich
die oft knapp kalkulierten Hardwareressourcen besser nutzen. Weniger Funktionen bedeutet
gleichzeitig: geringere Festplattenauslastung, weniger Prozessorhunger, weniger
Arbeitsspeicherbedarf. Dass keine zusätzlichen Lizenzkosten fällig sind und die Sicherheit in der
Regel höher ist, macht die Sache noch attraktiver.
Die Nachteile: Ein speziell entwickeltes Betriebsystem führt zu geringer bis fehlender
Kompatibilität zu anderer Soft- und Hardware, insbesondere zu Gerätetreibern. Die Integration in
Windows- oder stark Windows-lastige Netzwerke fällt schwer, da viele Softwarekomponenten
ausschließlich für Windows entwickelt und erst mit erheblicher Verzögerung portiert oder nachgebaut
werden. Aus diesem Grund verrichten proprietäre Appliances in Niederlassungen großer Unternehmen
bislang nur sehr spezielle, meist netzwerkbezogene Aufgaben.
OEM-Partner entwickeln Windows-Appliances
Ein Kompromiss ist der Appliance-Betrieb mit Windows-Betriebssystem. Dabei wird grundsätzlich
nach dem gleichen Prinzip vorgegangen, nämlich dem der Verschlankung durch intensives Härten: Der
Anbieter beseitigt die typischen Windows-Nachteile in puncto Sicherheit und Performance und
beschränkt das der Appliance zugrunde liegende Windows-System auf seine nötigsten Funktionen, um
dessen Effizienz und Stabilität zu steigern – eine Aufgabe, der sich in den vergangenen Jahren
immer mehr Microsoft-Partner verschrieben haben. Eine Übersicht darüber gibt es unter
www.microsoft.com/windowsserver
system/solutions/specializedservers/). Partner, die bisher Appliances auf Basis anderer
Betriebssysteme hergestellt haben, kennen die Anforderungen an solche Geräte und gehen entsprechend
radikal mit dem Betriebssystem um: Sie verändern Dienste, entfernen bestimmte Komponenten und bauen
spezielle Hardware ein.
Diese Appliances lassen sich folglich gut in Windows-Umgebungen integrieren – Stichworte: Active
Directory, Distributed File System etc. – sowie generell in Softwarearchitekturen auf Basis von
Windows-Applikationen. Auch werden damit nun zahlreiche Hardwarekomponenten unterstützt, von
Grafik- oder Soundkarten für Media-Appliances über Netzwerkkarten für Network-Appliances bis hin zu
Druckertreibern für Print-Appliances oder auch USB-Treibern. So verwischt sich allmählich der
bislang typische Eindruck von Windows-Appliances, zu langsam, unsicher und instabil zu sein. Der
Schritt von Microsoft, die Entwicklung solcher Appliances OEM-Partnern zu überlassen, hat diesen
Durchbruch erst ermöglicht.
Bedeutung gewinnt die Windows-Portierung vor allem vor dem Hintergrund der stark im Kommen
begriffenen "Branch Office Boxes", einem Begriff, den die Marktforscher von Gartner vor zwei Jahren
prägten. Das BOB-Konzept besteht darin, verschiedene getrennte Funktionen einzelner Appliances in
einem Gerät zusammenzufassen. Dies soll das Nebeneinander mehrerer in Niederlassungen installierter
Appliances und Server für verschiedene Zwecke wie Routing, WAN-Optimierung, Drucken etc. beenden
und Synergien beim Gerätemanagement schaffen.
Ablösung individueller Appliances
Zentralisierung heißt das Schlagwort – und so geht der Trend hin zu "serverlosen Filialen".
Viele IT-Services lassen sich dank der heute verfügbaren Bandbreiten komplett zentralisieren;
einige Funktionen jedoch sind – sei es aus technischen oder firmenpolitischen Gründen – in der
Niederlassung notwendig. Kommen zum Beispiel Protokolloptimierungen oder Kompressionsalgorithmen
zur Kommunikation mit einer Niederlassung zum Einsatz, dann erfordert dies eine entsprechende
Client-Komponente in der Außenstelle.
Da eine Verteilung dieser Funktionen auf die Clients dem Zentralisierungsprinzip widerspricht,
können dezentrale Appliances hier die Lösung sein. Da sich Appliances einfach einsetzen und schnell
austauschen lassen, stellen sie einen guten Kompromiss zwischen wirklich serverfreien Filialen und
einer dezentralen Struktur dar. BOBs mit ihrem All-in-One-Konzept sollen dabei die verschiedenen,
auf jeweils einen bestimmten Einsatzzweck hin konzipierten Appliances ablösen.
Immer mehr IT-Anbieter – von Cisco und Citrix bis hin zu Herstellern wie dem
Security-Unternehmen Phion oder dem Druckspezialisten Thinprint – bieten ihren Kunden solche
All-in-One-Systeme für die Anbindung von Außenstellen und die einfache Verwaltung der genutzten
Applikationen. Jeder Hersteller legt hierbei die Schwerpunkte anders: Sind es bei Cisco die Router-
und WAN-Beschleunigungsfunktionen, so setzt Phion den Fokus auf VPN und Firewalls. Während
Thinprint die Druckservices in den Vordergrund stellt, konzentriert sich Citrix mit ihrem Branch
Repeater auf beschleunigtes Application Streaming.
Einsatzzweck ist zu beachten
Gerade anhand der beiden letztgenannten Anbieter lässt sich verdeutlichen, dass es stets von den
speziellen Gegebenheiten im Unternehmen abhängt, welche BOB jeweils die am besten geeignete ist.
Beide Boxen optimieren den Datenverkehr, doch mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten. Der
Branch Repeater fungiert als Zwischenspeicher für Xenapp Streamed Applications und realisiert die
WAN-Optimierung über Wanscaler und ISA-Caching (ISA: Microsoft Internet Security and Acceleration
Server 2006). Die benötigten Softwarepakete werden auf dem Repeater zwischengelagert und müssen bei
Anforderung in der Außenstelle nicht mehr aus der Zentrale verschickt werden. Die Synchronisation
der Pakete erfolgt per DFS (Distributed File System). Wer also Application Streaming mit Xenapp in
Außenstellen nutzt, trifft mit dem Repeater sicher eine gute Wahl. Wenn die Hauptlast im Netzwerk
auf dem Drucken liegt, könnte ein Gerät mit integrierter professioneller Drucklösung die bessere
Alternative sein. ISA haben beide Systeme integriert. Firewall, Webfilter und Web-Caching werden
damit automatisch mitgeliefert.
Fazit
So verschieden die Ansätze der BOB-Anbieter auch sind: Nicht zuletzt durch die verstärkte
Windows-Portierung werden die Multifunktionsgeräte bei der Außenstellenvernetzung von Unternehmen
künftig wohl eine immer größere Rolle spielen. Der Höhepunkt ist dabei noch nicht erreicht; ihn
erwarten die Marktforscher von Forrester Research erst für 2010.