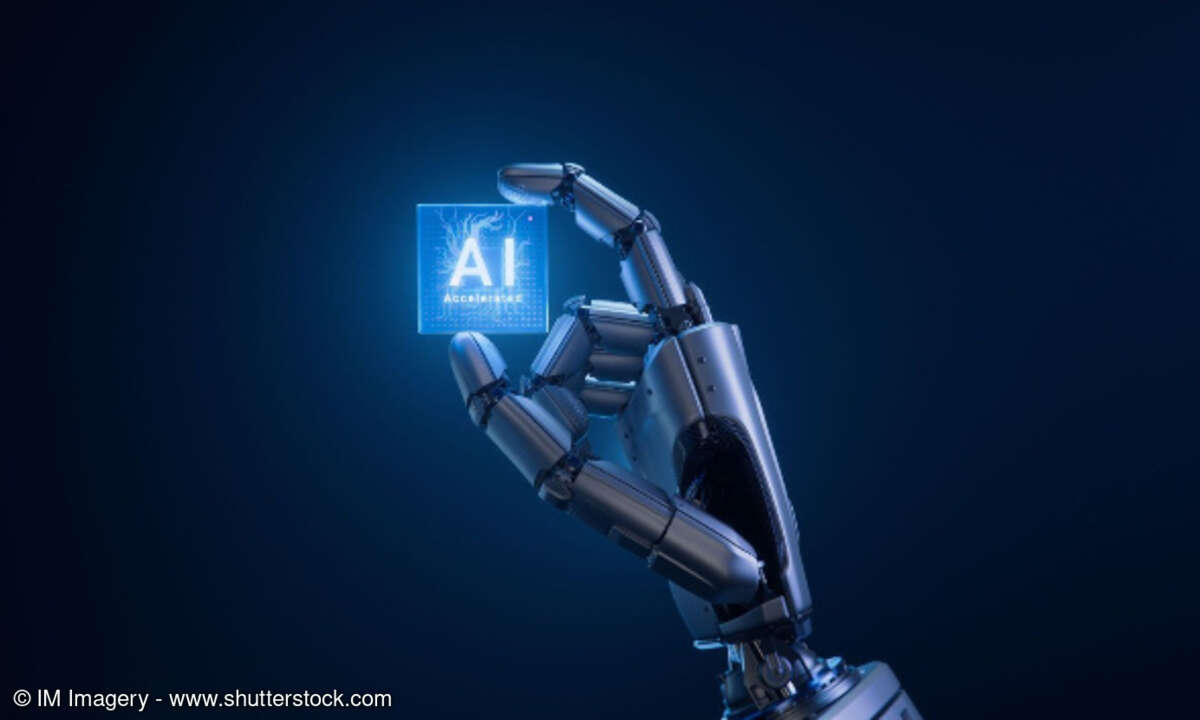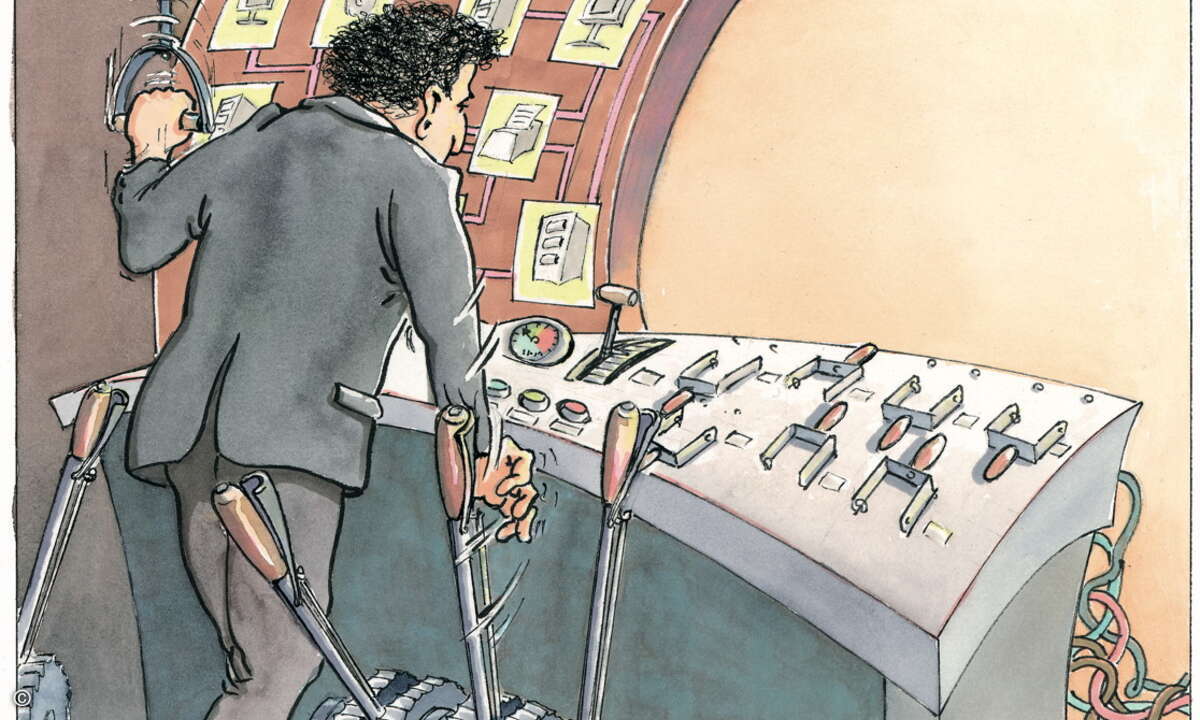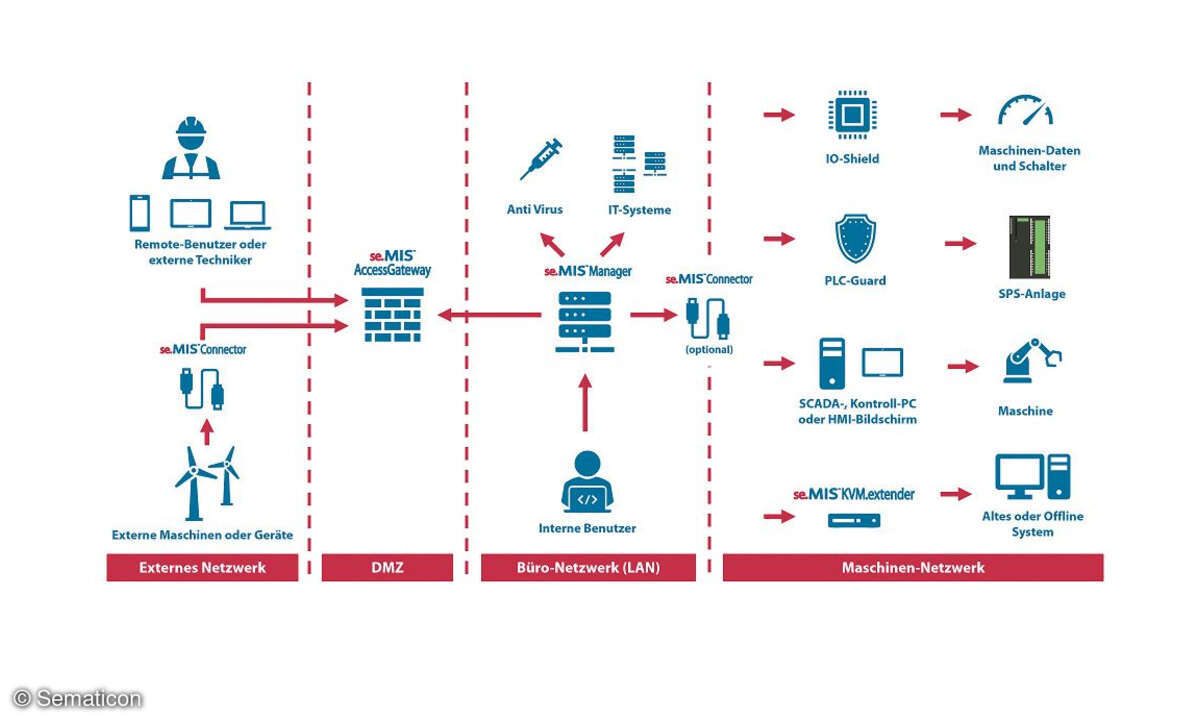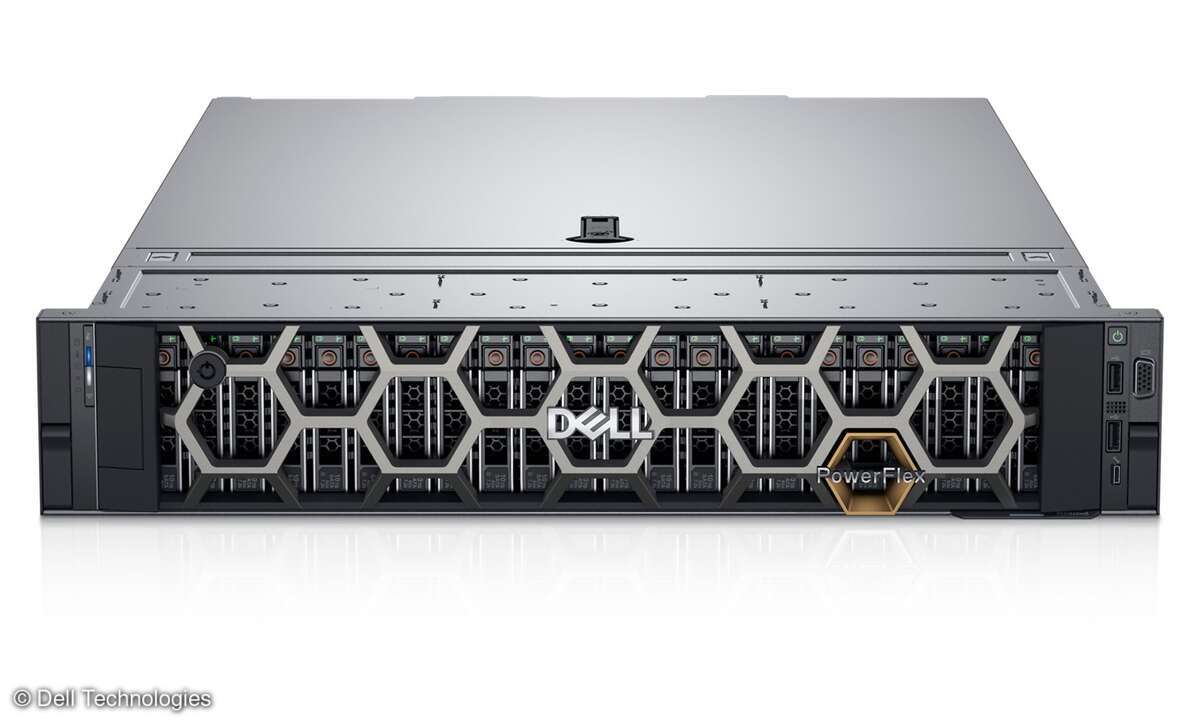Reiseführer
Die Virtualisierung von Servern erleichtert dem Administrator das Aufsetzen neuer Maschinen und senkt die Energiekosten. Auch Ausfallsicherheit lässt sich leichter gewährleisten. Die Migration physischer Server zu virtuellen Maschinen erfordert nicht unbedingt eine Neuinstallation. Verschiedene Softwarelösungen helfen dabei.
Will ein Unternehmen Server von physischer Hardware auf virtuelle Maschinen portieren (Physical-to-Virtual- oder kurz P2V-Migration), sind oft Hilfsmittel nützlich. LANline veröffentlicht deshalb seit der Ausgabe 9/2008 eine nach wie vor laufende Testserie zu P2V-Migrationswerkzeugen (Kasten Seite 18). Zwar lassen sich Daten auch per Image übertragen, doch bei einer großen Anzahl an Servern ist diese Arbeitsweise umständlich und vor allem unübersichtlich. Spezielle Migrationslösungen liefern eine Steuerungszentrale, mit der sich die Überführung leichter bewältigen lässt.
Wichtig bei solchen Lösungen ist zunächst die Unterstützung der im Unternehmen eingesetzten Betriebssysteme: Eine Lösung, die nur Windows unterstützt, bringt für die Migration von Linux-Servern nicht viel. Extrem wichtig ist auch die Frage der unterstützten Virtualisierungslösungen. Eine P2V-Lösung sollte dabei die Möglichkeit bieten, Daten per Liveübertragung zu migrieren, also ohne den Quellserver herunterfahren zu müssen. In diesem Fall ist es auch interessant zu wissen, ob die Lösung dazu einen speziellen Agenten erfordert, der auf den Quellservern installiert sein muss. Die Option, Konvertierungen per Zeitplan zu steuern, schafft einem Systemverwalter in P2V-Projekten zusätzliche Freiräume. Hilfreich kann die Option zum Beispiel sein, um eine Übertragung außerhalb der Geschäftszeiten durchzuführen. Zur Automation oder Standardisierung sind Lösungen, die skriptbasiert funktionieren, eine interessante Wahl. Hier müssen Systemverwalter etwas mehr Arbeit investieren, dafür läuft die Übertragung mit optimierten Skripten immer auf die gleiche Art und Weise ab.
Plattformvielfalt
Während der Migration von physischen Servern zu virtuellen Maschinen wird meist die Betriebssystempartition als Image gesichert und auf einen virtuellen Server übertragen. Müssen Unternehmen zahlreiche Server migrieren, sind Anwendungen hilfreich, die dafür eine zentrale Oberfläche bieten. Wichtig ist hier, dass die P2V- Lösung die Konvertierung physischer Festplatten zu den verschiedenen Virtualisierungslösungen unterstützt: Vmware Server, ESX, aber auch Xen, Citrix Xenserver sowie Microsoft Virtual Server und Hyper-V gehören zu den Virtualisierungslösungen, die solch ein P2V-Tool unterstützen sollte.
Ein Beispiel für eine solche Lösung ist Platespin Powerconvert. Neben der üblichen Unterstützung der gängigen Windows-Betriebssysteme als Gast bietet Powerconvert den großen Vorteil, auch die Migration von Linux-Systemen mit Red Hat 7 oder 8 sowie Suse Linux Enterprise Server (SLES) in den Versionen 8, 9 und 10 zu ermöglichen. Nicht viele P2V-Tools unterstützen unterschiedliche Betriebssystemvarianten. Daher muss sich der Administrator schon vor dem Kauf darüber im Klaren sein, welche Server und welche Betriebssysteme er in die Migration einschließen will. Er sollte vor dem Kauf ausführlich testen, ob die Übertragung gelingt.
Zusätzlich sollte ein Migrationslösung idealerweise über eine Disaster-Recovery-Möglichkeit verfügen, für den Fall, dass bei der Migration etwas schief geht. Unternehmen, die Images mit Tools wie Acronis True Image, Symantec Livestate oder Ghost erstellt haben, wollen diese Images eventuell für die Migration zu virtuellen Servern verwenden. Neben diesen Imaging-Produkten sollte eine P2V-Lösung auch Backup-Archive unterstützen.
Die Migration von einem virtuellen zu einem anderen virtuellen Server (V2V) sollten Systemverwalter bei der Auswahl ebenfalls mit berücksichtigen. Nicht alle Migrationslösungen unterstützen diese Möglichkeit. Manche Werkzeuge erstellen Images zudem im laufenden Betrieb, auch ohne dass auf den Servern ein spezieller Agent installiert sein muss. Bei Exchange- oder SQL-Servern müssen natürlich alle Lösungen, auch das erwähnte Powerconvert, die Systemdienste stoppen, sodass Anwender nicht mehr auf diese Serverdienste zugreifen können.
Virtuelle Server ausfallsicher machen
Neben der reinen Migration ist es auch notwendig, virtuelle Server und vor allem die installierten Serverlösungen vor Ausfall zu schützen. Auch dafür gibt es spezielle Lösungen. Dabei kopieren die meisten Lösungen Daten zwischen Quell- und Zielserver, sodass bei einem Ausfall des Quellservers der Zielserver sofort einspringen kann. Beim Zielserver muss es sich dabei aber nicht gezwungenermaßen um einen physischen Computer handeln. Darum sollten Unternehmen beim Einsatz solcher Lösungen darauf achten, dass auch virtuelle Server als Zielserver zum Einsatz kommen können.
Double-Take zum Beispiel unterstützt die Replikation zwischen physischen und virtuellen Servern und ermöglicht dadurch eine Migration in diese Richtung. Während reine Migrationslösungen wie Powerconvert nach der P2V-Umstellung der Server meist ungenutzt im Schrank stehen, können Werkzeuge wie Double-Take, deren Fokus eher eine Art Datensicherung oder Ausfallschutz ist, auch nach der Umstellung einen wichtigen Nutzen bieten.
Der große Vorteil solcher Replikationslösungen offenbart sich im Einsatz während und nach der eigentlichen Migration. So muss der Administrator zwar etwas mehr Hand anlegen als bei reinen Migrationslösungen. Dafür erhält er aber eine Softwarelösung, die im Unternehmen für Ausfallsicherheit sorgen kann. Sind bereits andere Techniken im Einsatz und soll nur die Migration im Fokus stehen, ist hingegen zu spezialisierten P2V-Tools zu raten.
Virtualisiert ein Unternehmen seine Hardware, besteht auch die Möglichkeit, den Netzwerkspeicher zu berücksichtigen. Über SAN- oder NAS-Technik ist es schon lange möglich, Speicher virtuell zuzuweisen und über das Netzwerk bereitzustellen. Allerdings sind die entsprechenden Geräte meist hardwarebasiert oder verfügen über ein spezielles Betriebssystem. Diese Geräte sind oft wenig skalierbar und teuer; zudem lässt sich nicht aus jedem Server ein solches Speichersystem bauen.
Diverse Lösungen, zum Beispiel Datacore Sanmelody, können einen herkömmlichen Server und dessen Festplatten in einen effizienten Festplattenserver verwandeln. Dieser Server steht dann anderen Servern im Netzwerk als Datenspeicher zur Verfügung. Die Anbindung erfolgt meist über iSCSI, die verbundenen Laufwerke verhalten sich für die Server dann wie lokale Festplatten. Angenehm an iSCSI ist der im Vergleich zu Fibre Channel deutlich niedrigere Preis. Der Vorteil dieser Technik ist, dass sich Festplattenspeicher im Netzwerk schneller aufrüsten lässt. Um den Datenspeicher von Servern zu erweitern ist es nicht mehr notwendig, die einzelnen Hardwareserver auszubauen.
Ein weiterer Vorteil solcher Lösungen ist die Möglichkeit, Daten zwischen zwei alleinstehenden Servern zu spiegeln. So entsteht eine kostengünstige Hochverfügbarkeitslösung, da Unternehmen keine spezielle Cluster-Software zur Spiegelung benötigen. Fällt der Quellserver aus, kann der Zielserver automatisch die Laufwerke übernehmen. Wollen Unternehmen solche Lösungen einsetzen, ist es durchaus sinnvoll, darauf zu achten, ob das Produkt Cluster-tauglich ist. Für Windows-orientierte Unternehmen bedeutet dies die Unterstützung herkömmlicher Cluster auf Basis von Windows Server 2003.
Beachtet sein will die Frage, ob die Lösung auf Windows basiert oder ein eigenes Betriebssystem mitbringt wie Open-E, ebenfalls ein System zum Aufbau eines virtuellen Speichernetzes. Der Nachteil von Tools wie Open-E ist, dass sie nicht vom Windows-Server-Speichersystem profitieren. Sanmelody hingegen baut auf dem Windows-Standard auf. Damit ist das System schnell, stabil und unterstützt vor allem eine große Anzahl an Speichergeräten. Denn für Windows gibt es unzählige Treiber, die stabil und zuverlässig arbeiten.
Sind die Server einmal virtualisiert, benötigen Unternehmen eine zentrale Verwaltungsoberfläche. Die Anbieter der Virtualisierungsplattformen bieten jeweils eigene Managementlösungen: Marktführer Vmware offeriert Virtualcenter, Citrix das Delivery Center, Microsoft den System Center Virtual Machine Manager 2007. Aber auch die zahlreichen namhaften Anbieter von Systemmanagementlösungen haben das Virtualisierungs-Layer inzwischen in ihre Werkzeuge eingebunden.