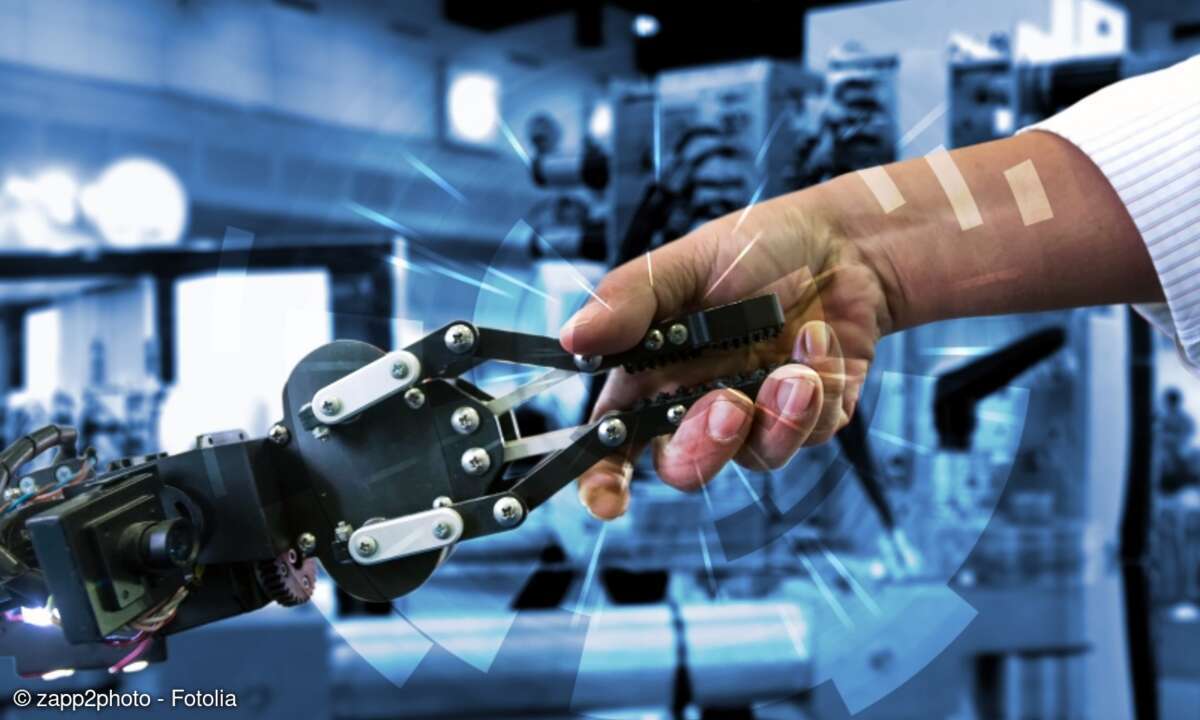»Einheitliches Bieter-Client ist notwendig«
»Einheitliches Bieter-Client ist notwendig«. In einem Positionspapier hat der BITKOM die eVergabe aus der sicht der anbietenden Wirtschaft betrachtet und einige Defizite ausgemacht. Jürgen Höfling sprach mit Dr. Pablo Mentzinis, Leiter des Bereichs »Public Sector« beim BITKOM

»Einheitliches Bieter-Client ist notwendig«
Herr Dr. Mentzinis, elektronische Vergabe, wenn sie denn zum normalen Beschaffungsalltag von öffentlichen Verwaltungen und Privatfirmen gehört, birgt große volks- und betriebswirtschaftliche Einsparpotenziale. Wie sieht die Realität in Deutschland in der ersten Hälfte des Jahres 2006 aus?
Dr. Pablo Mentzinis: Nach den Vorstellungen der EU-Kommission sollten bis zum Jahr 2003 25 Prozent aller Beschaffungen elektronisch abgewickelt werden. Von diesen Vorgaben sind wir auch im Jahr 2006 noch weit entfernt. Nach aktuellen Schätzungen werden weniger als 5 Prozent, vermutlich sogar weniger als 2 Prozent aller Angebotsabgaben in Deutschland im öffentlichen Bereich in elektronischer Form abgewickelt.
Woran liegt das? Die politischen Rahmenbedingungen sind doch eigentlich frühzeitig gesetzt worden.
Die wichtigen gesetzlichen Rahmenbedingungen sind in der Tat sehr frühzeitig gesetzt worden. Allerdings müssen wir uns fragen, ob nicht mit der Forderung nach der qualifizierten elektronischen Signatur bei allen Schritten der elektronischen Beschaffung ein eher praxisfernes und übermäßig hohes Schutzniveau angestrebt wurde.
?hier sind aber realistischere Tendenzen in der Politik zu erkennen?
Das stimmt. Neue Entwicklungen wie etwa in der VOL/A 2006, also der Verdingungsordnung für Leistungen, Teil A, die demnächst bekannt gegeben wird, gehen hier in eine andere Richtung. Künftig wird es möglich sein, dass für elektronisch übermittelte Angebote auch eine fortgeschrittene elektronische Signatur ausreichend ist.
Mir scheint, dass die elektronische Signatur aber nur ein Teil des Problems ist. Werden potenzielle Anbieter nicht auch durch die vielen unterschiedlichen technischen Lösungen abgeschreckt? Sie schreiben in Ihrem Papier ja auch, dass viele elektronische Angebote wegen formaler Fehler nicht berücksichtigt werden können.
Letzteres betrifft die Vergabeunterlagen. Etwa 30 Prozent der Angebote können in der Tat wegen formaler Fehler nicht berücksichtigt werden. Bei Ausschreibungen über gleiche Leistungen werden oft von Auftraggeber zu Auftraggeber unterschiedliche und den Aufwand treibende Belege der Leistungsfähigkeit und Kompetenz der Bieter gefordert. Präqualifizierungsverfahren werden unter Behörden nicht übergreifend anerkannt.
Wie kann das verbessert werden?
Unter anderem durch folgende Maßnahmen: Die Vergabeunterlagen, die sich heute bei Ausschreibungen von Bund, Ländern und Gemeinden sowohl äußerlich als auch inhaltlich unterscheiden, sollten standardisiert werden. Einheitliche Vergabeunterlagen vermindern auch formale Fehler bei der Angebotsabgabe.
So genannte Plausibilitätsprüfungen sollten genutzt werden. Elektronische Plausibilitätsprüfungen können den Auftragnehmer automatisch informieren, falls ein Angebot formell fehlerhaft oder unvollständig ist. Für die Bieter entsteht hierdurch ein greifbarer Mehrwert.
Kommen wir noch einmal auf technische Unverträglichkeiten, wie sie sich aus der Sicht eines Bieters darstellen, zurück.
Der Bieter muss auch für sich den Mehrwert sehen. Den Unternehmen entstehen ja durch die Umstellung auf elektronische Verfahren Kosten. Im Bereich Infrastruktur, bei der Anpassung der Prozesse, durch Schulungen. Diese zusätzlichen Kosten sind am ehesten dann vertretbar, wenn zugleich etwa durch standardisierte XML-Schnittstellen die Anbindung an Warenwirtschaftssysteme oder Kundenmanagement-Systeme ermöglicht wird und hierdurch Informationsvorgänge automatisiert werden können.
Aber es hapert ja anscheinend auch noch an anderen Stellen mit der Standardisierung. Wie Sie in Ihrem Positionspapier schreiben, müssen sich potenzielle Bieter mit vielen unterschiedlichen IT-technischen Lösungen herumschlagen…
Bieter müssen sich bisher mit unterschiedlichen Lösungen bei Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungen auseinandersetzen. Das geht soweit, dass auch die Internetadresse von Beschaffungsstellen nicht einheitlich ist, etwa nach dem Modell vergabe.stadtname.de. Bei Unternehmen, die sich bundesweit an Ausschreibungen beteiligen, entstehen zusätzliche Kosten und Probleme, wenn die Beschaffungstools der jeweiligen ausschreibenden öffentlichen Stellen installiert werden müssen und wenn zum Beispiel IT-Integrationstests mit entsprechenden Folgekosten gemacht werden müssen. Dringend notwendig sind daher einheitliche Schnittstellen zu den Plattformen, die es einem Nutzer ermöglichen, mit einem Programm, so zusagen einem einheitlichen Bieterclient, an Ausschreibungen unterschiedlicher öffentlicher Auftraggeber teilzunehmen.
Standards, einheitlicher Bieterclient und so weiter: besteht da nicht die Gefahr, dass damit der Wettbewerb zwischen den Systemanbietern zunichte gemacht wird?
Die Harmonisierung darf auf keinen Fall soweit führen, dass wir zu
einer Monopolisierung der Anbieter von Beschaffungssoftware kommen. Es geht um Interoperabilität, nicht um Gleichmacherei. Am Ende einer Interoperabilitätsoffensive könnte stehen, dass Unternehmen mit einem beliebigen Bieterclient an allen Ausschreibungen teilnehmen können.
Herr Dr. Mentzinis, haben Sie nicht auch ein paar Fakten oder Zahlen, die Mut machen?
Die Zahlen aus dem Beschaffungsamt des BMI über Unternehmen, die die Zulassung mit einer fortgeschrittenen Signatur beantragen, machen auf jeden Fall Mut. Während seit 2003 nur 250 Unternehmen die Zulassung bei elektronischen Vergabeverfahren mit der qualifizierten Signatur beantragt haben, ist die Zahl der Unternehmen, die künftig mit der fortgeschrittenen elektronischen Signatur anbieten wollen, schon nach wenigen Monaten bei über 500 Unternehmen.
Herr Dr. Mentzinis, vielen Dank für das Gespräch!