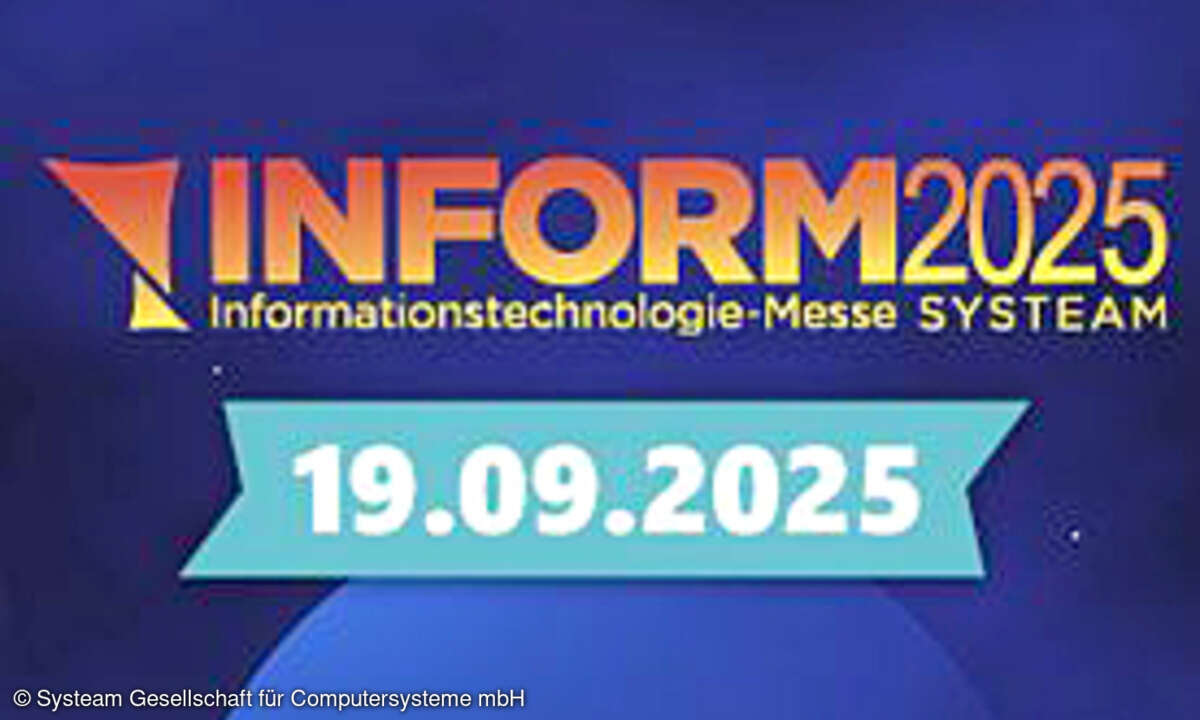Application Lifecycle Management: Microsoft tritt die Aufholjagd an
Application Lifecycle Management: Microsoft tritt die Aufholjagd an. Mit einer Erweiterung der Visual-Studio-Produktlinie bringt Microsoft erstmals eine Lösung für das Application Lifecycle Management (ALM) auf den Markt. Das Segment wird traditionell von IBM und Borland beherrscht. Das Marktpotenzial für ALM-Lösungen wächst Analysten zufolge in den kommenden vier Jahren um 30 Prozent.
Application Lifecycle Management: Microsoft tritt die Aufholjagd an
Autorin: Cordula Lochmann
Microsoft ist spät dran. Mit Visual Studio 2005 Team System steigt der weltgrößte Software-Hersteller jetzt als Neuling in den Markt der Lösungen für das Application Lifecycle Management (ALM) ein. Traditionell wird das Segment von Borland und IBM Rational dominiert. Beide Anbieter setzten bereits Ende der neunziger Jahre auf die Erkenntnis, dass zur Software-Entwicklung mehr gehört als eine Programmiersprache und eine Entwicklungsumgebung.
Mit Visual Studio Team System tritt Microsoft nun die Aufholjagd an. Das Unternehmen strebt nicht nur einen Anteil am lukrativen ALM-Markt an, der laut IDC in den kommenden vier Jahren weltweit um rund 30 Prozent wächst. Die Redmonder möchten auch ihren Marktanteil bei Entwicklertools sichern, der ohne Erweiterungen für den kompletten Entwicklungszyklus womöglich in Gefahr gerät.
Da erst zehn Prozent aller Unternehmen einer IDC-Studie zufolge ALM konsequent umsetzen, stehen die Marktchancen für alle Hersteller und deren Partner gut. »Je größer das Unternehmen, desto eher werden ALM-Tools eingesetzt«, beschreibt Michael Arbesmeier, Geschäftsführer von ARS, einem Münchner IBM-Partner, die Situation bei den Anwendern. Im Mittelstand werde dagegen die Notwendigkeit für derartige Software bislang kaum gesehen.
Dabei müssten eigentlich alle Beteiligten handeln, wie zahlreiche Studien belegen. Nur zehn bis maximal dreißig Prozent aller Software-Projekte werden termingerecht und zu den veranschlagten Kosten fertig gestellt. Bis zu dreißig Prozent scheitern ganz, die übrigen benötigen mehr Zeit oder Geld als geplant. Und das Verhältnis von erfolgreichen zu gescheiterten Entwicklungsprojekten bessert sich nur langsam. Einige Studien sprechen sogar von Stagnation oder Verschlechterung.
Doch das heißt nicht, dass die Anwender das Problem ignorieren oder die Hersteller die Entwicklung verschlafen würden. Aber die Software-Entwicklung ist komplexer geworden. Immer aufwändigere Web-Applikationen und die wachsende Bedeutung, die der Integration heterogener Landschaften zukommt, sind nur zwei Trends, die dafür sorgen.
Den gewachsenen Anforderungen stehen Innovationen bei den Programmiersprachen, den Technologien und den Architekturen gegenüber. Das hat zwar die Produktivität der einzelnen Entwickler gesteigert und die Möglichkeiten verbessert, Geschäftsprozesse abzubilden. Nicht ins Blickfeld kam jedoch der gesamte Zyklus der Software-Entwicklung vom Anforderungsmanagement bis zur Optimierung bereits eingeführter Anwendungen.
An diesem Punkt setzt das ALM an, das die Software-Entwicklung als geschlossenen Kreislauf ineinander greifender Phasen versteht. Dahinter steht das Konzept der Industrieproduktion, in der es genau definierte, reproduzier- und messbare Prozesse gibt. Das ist auch das Idealbild für die Software-Produktion. Zentral ist dabei das Projektmanagement, das den Zusammenhalt der Elemente im Lebenszyklus garantiert.
Dass Entwicklungsprojekte ein Management benötigen, wird seit langer Zeit als Selbstverständlichkeit angesehen. In der Vergangenheit wurden die Vorgänge dabei jedoch manuell protokolliert. ALM-Anwendungen tun das heute automatisch. Den Traum, dass sich Software selber schreibt, wenn sie richtig modelliert ist, hat die Branche zwar aufgegeben. Dafür wird inzwischen jedoch ein hohes Maß an Automatisierung durch eine enge Verzahnung der Aufgaben des Lebenszyklus erreicht. Das Projektmanagement muss beispielsweise nicht mehr die Informationen aus der Anforderungsanalyse an die Designer weitergeben. Das können die Werkzeuge von alleine.
Auf Anbieterseite brachte Rational 1999 erstmals mit der Rational Suite ein ALM-Paket heraus, das von der Definition der Anforderungen über die Dokumentation bis hin zum Änderungsmanagement alle Phasen des Zyklus abdeckte. Schon vor dem Kauf durch IBM war Rational ein Anbieter von Change-Management- und Resource-Management-Lösungen. Seit der Übernahme wurden die Tools weiterentwickelt und an die verschiedenen Plattformen angepasst. Eine Veränderung bedeutete für Rational die enge Zusammenarbeit mit den Partnern. Sie war bei Anbietern zuvor nicht in der Form ausgeprägt, wie es bei IBM der Fall ist. Dass sich das Partnerprogramm für Rational bewährt, bestätigt ARS-Geschäftsführer Michael Arbesmeier: »Das IBM-Partnerprogramm ist exzellent, und Rational wächst in dieses Programm gerade hinein.«
Borland ging 2003 erstmals mit einer kompletten Produktpalette für das Application Lifecycle Management auf den Markt. Das Unternehmen hatte im Jahr zuvor Starbase und Togethersoft übernommen und deren Produkte anschließend ins eigene Portfolio integriert. Mit den Together-Produktlinien sowie den Starbase-Produkten für das Anforderungs- und Konfigurationsmanagement wurde der Lebenszyklus größtenteils bedient.
Inzwischen ist aus den Produkten eine Initiative geworden, die so genannte Software Delivery Optimization. Darunter versteht Borland die Überführung der Software-Entwicklung in einen industriellen Herstellungsprozess. Für den Channel ist bei dieser Initiative jedoch kein Geschäft zu holen: Borland betreut die Kunden durch sein eigenes Key Account Management. Das gilt freilich nicht für den Produktvertrieb der zahlreichen ALM-Komponenten des Anbieters.
Aus Sicht der Anwender bietet Borland ebenso wie IBM Rational den Vorteil, nicht nur die eigene Entwicklungsumgebung zu unterstützen, sondern auch die der Konkurrenz. »Es gibt Abläufe, die für alle Entwicklerteams gleich sind, zum Beispiel das Änderungsmanagement oder die Dokumentation«, erläutert René Meyer, Solution Expert bei der IBM Software Group. Für die Rational-Tools sei nicht relevant, welches Entwicklungswerkzeug zum Einsatz kommt. Das Gleiche trifft auf die Borland-Produkte zu.
Konfrontation mit dem Wettbewerb
Gerade erst hat Microsoft sein »Visual Studio Team System«, eine Suite, die aus den Komponenten Team Architect, Team Developer, Team Tester und dem Team Foundation Server besteht, auf den Markt gebracht. Und schon werden die Redmonder mit dem Wettbewerb konfrontiert. Denn IBM Rational und Borland werben eifrig um die Visual-Studio-Anwender und sind mit ihren ALM-Produkten bereits bei diesen Kunden vor Ort.
Der Newcomer sieht die Situation indes entspannt, weil ALM aus seiner Sicht in vielen Firmen noch gar nicht angekommen ist. »Microsoft muss daher keinen Verdrängungswettbewerb führen«, meint Christian Weisbrodt, Produktmanager für Visual Studio Team System. Bei einem weltweiten Marktanteil seiner Entwicklungsumgebungen von über 20 Prozent kann der weltgrößte Software-Hersteller in diesem Bereich wachsen, ohne in fremden Gewässern fischen zu müssen.
So bietet Microsoft die neuen ALM-Produkte auch nur für die eigene Entwicklungsumgebung an. Dafür ist die Integration anscheinend gut gelungen und die Oberfläche einfach zu bedienen.
Für welchen Hersteller sich ein Unternehmen am Ende entscheidet, das hängt laut IBM-Manager Meyer von strategischen Aspekten ab. Setzt ein Kunde auf eine plattformunabhängige Lösung und offene Standards oder wählt er die Dot-Net-Plattform? »Davon ist dann auch die Wahl der Entwicklungsumgebung und der übrigen Tools abhängig«, folgert Meyer.
IBM setzt strategisch auf Java. Das wirkt sich vor allem bei der Modellierung aus, weil beispielsweise hinter Microsofts Visual Studio andere Konzepte stehen, die von den Rational-Produkten weniger gut unterstützt werden. Das heißt jedoch nicht, dass IBM Rational nichts für Kunden zu bieten hat, die mit Visual Studio arbeiten. Die Team Unifying-Plattform sowie die Testwerkzeuge Purify Plus und Functional Tester sind dem Anbieter zufolge genauso für die Microsoft-Entwicklungsumgebung geeignet wie für die eigene.
Als Vorteil der Rational-Produkte führt Meyer vor allem die Integration in die IBM-Middleware ins Feld. Der Kunde erhalte eine Lösung aus einem Guss, betont der Manager, ein Vorzug, den Borland so nicht bieten könne.
Dafür dürfte Borland in heterogenen Entwicklungslandschaften leicht im Vorteil sein. Ebenso wie IBM ist das Unternehmen zwar eher in der Java-Welt zu Hause als in der Dot-Net-Welt. Doch Borland hat frühzeitig begonnen, die eigene Software für die Microsoft-Plattform anzupassen. Der Anbieter bezeichnet sich selbst als engen Partner der Gates-Company, der auch in Zukunft auf die Interoperabilität mit Dot-Net setzt.
Je komplexer die Software-Entwicklung wird, je mehr sie die Branche als Lifecycle versteht, desto mehr kommt es für Partner darauf an, Know-how zu verkaufen. Das Produkt spielt eine untergeordnete Rolle, sofern der Kunde eine Lösung erhält, die seine Kosten für zu entwickelnde Business-Anwendungen besser kalkulierbar macht. Lässt sich das Vertrauen des Kunden gewinnen, verspricht ALM entsprechend hohe Margen.
Alle Hersteller haben inzwischen Partnerprogramme verabschiedet, die über Produktkenntnisse hinaus ALM-Kompetenz vermitteln. Zudem arbeiten sie daran, ein Bewusstsein für die Verbesserungsmöglichkeiten in den IT-Abteilungen zu schaffen. Angesichts der prognostizierten Steigerungsraten von dreißig Prozent in den kommenden Jahren, bietet ALM den Partnern die Chance, sich neue Umsatzpotenziale zu erschließen. Voraussetzung dafür ist aus Sicht der Anbieter allerdings die Bereitschaft, sich Know-how anzueignen und sich mit komplexen Prozessmodellen auseinander zu setzen.
_____________________________________________
INFO
Borland GmbH
Robert-Bosch-Straße 11, D-63225 Langen
Tel. 06103 979-0x
www.borland.com/de
IBM Deutschland GmbH
Pascalstraße 100, D-70569 Stuttgart
Tel. 01803 313233, Fax 0 70 32 15 37 77
www.ibm.com/de
Microsoft GmbH
Konrad-Zuse-Str. 1, D-81716 Unterschleißheim
Tel. 089 3176-0, Fax 089 3176-1000
www.microsoft.com/germany