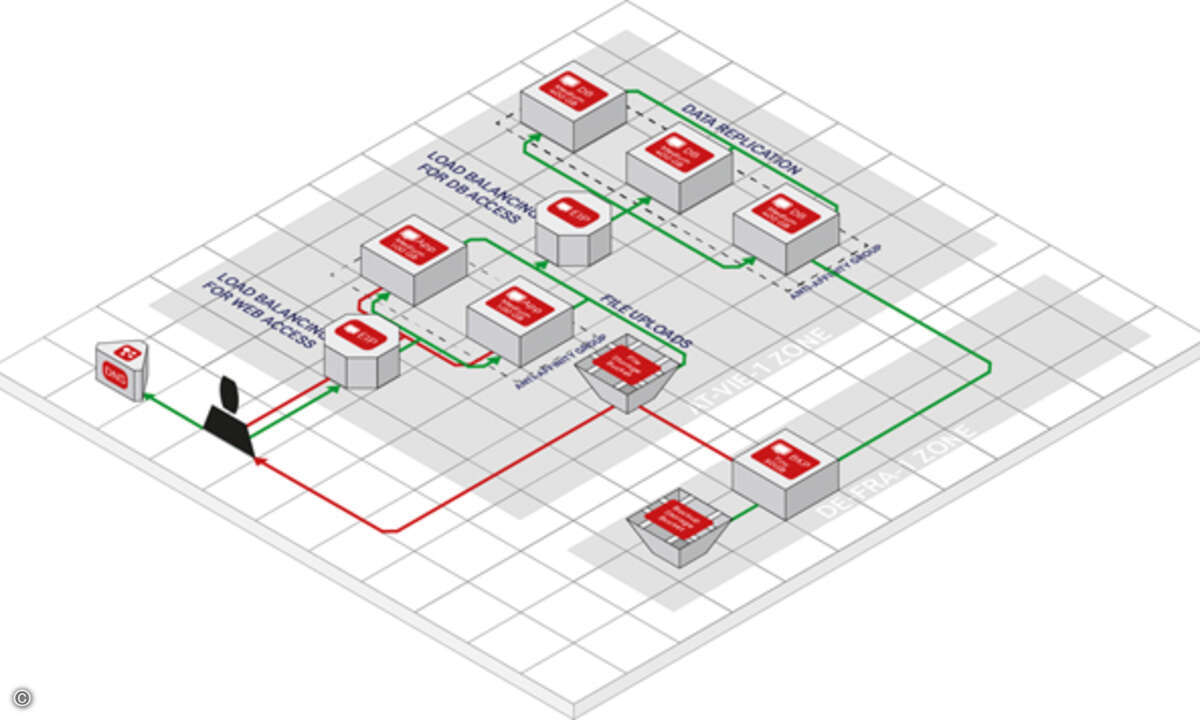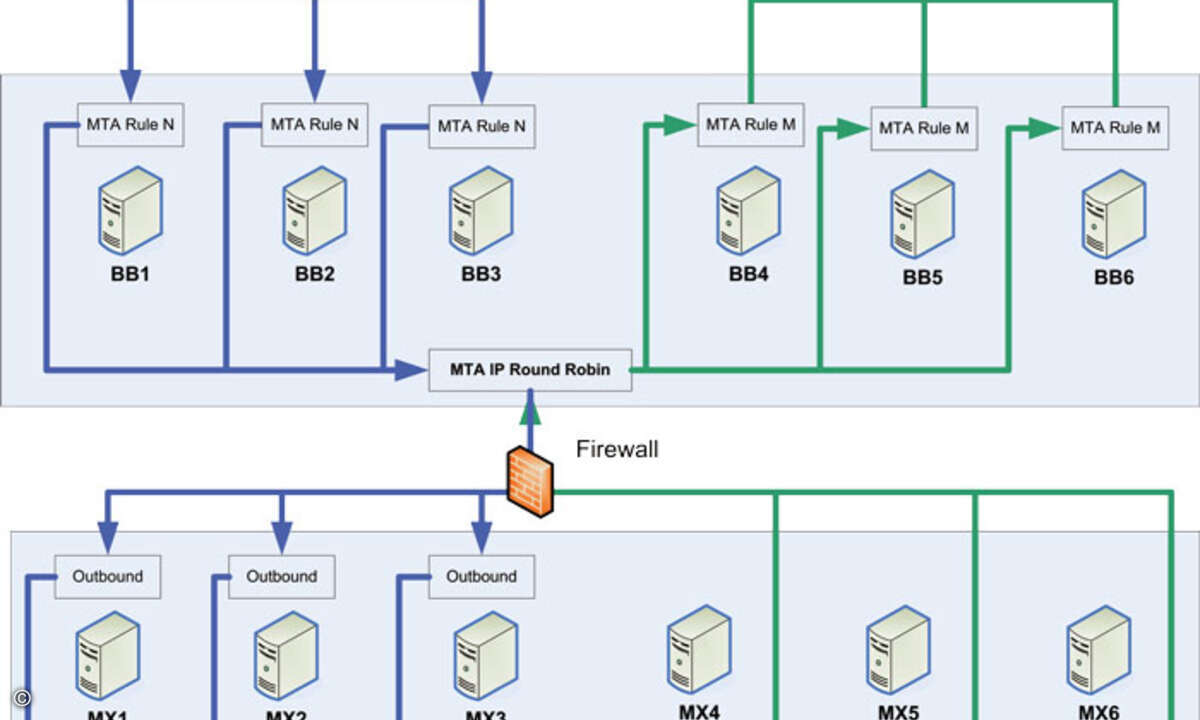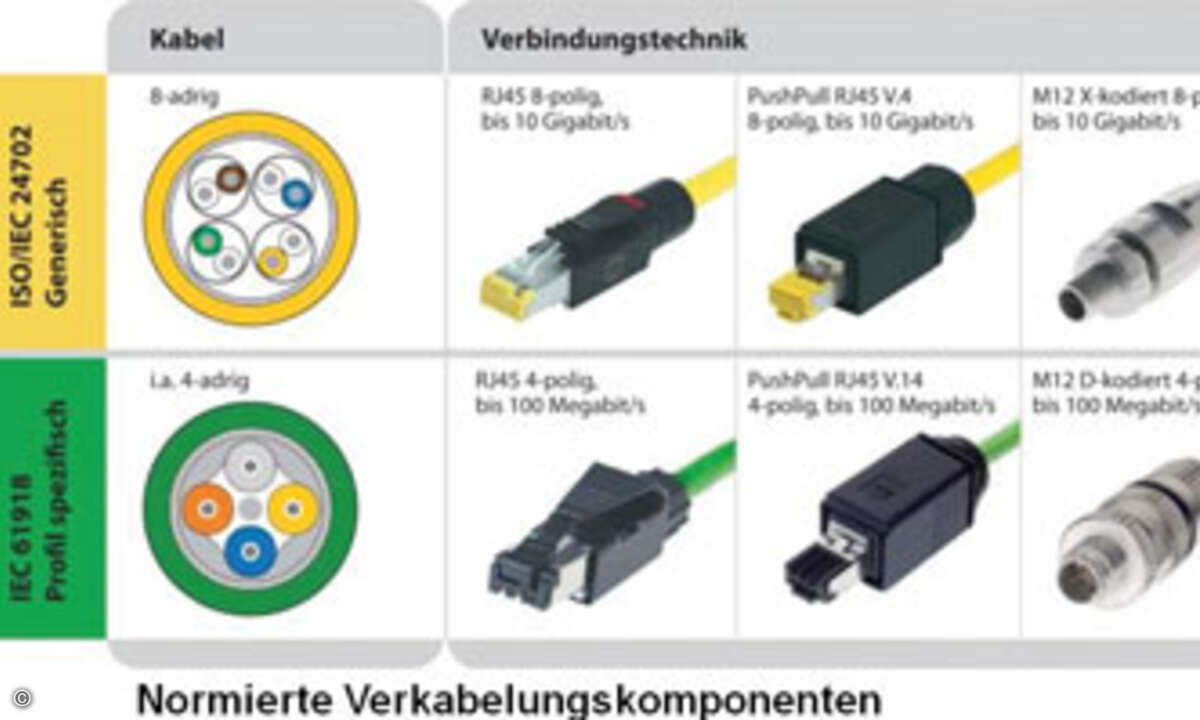Maschinen-Geflüster
Das Beispiel eines intelligenten Haussystems zeigt, welchen Lebenskomfort neue, integrierte Systemtechnik im Privaten wie auch im B-to-B-Bereich bescheren wird. Die technischen Errungenschaften drohen aber auch, die Gesellschaft drastisch zu verändern. Auf die Industrie kommt eine neue Herausforderung zu.

Unsere Gesellschaften werden im Zeitraum zwischen 2009 und 2014 ganz von der digitalen Technologie durchdrungen sein.
Wer kennt sie nicht, die Geschichte von der Spinne in der Yucca-Palme, oder die von der Tarantel in der Bananenkiste? Nichts hält sich hartnäckiger als ein Gerücht, nichts ist dauerhafter als die Legende. Die Hightech-Branche hat ihre eigenen Mythen. Zum Beispiel die vom intelligenten Kühlschrank, der Milch und Käse nachbestellt, bevor sie ausgehen. Ein Märchen. Höchste Zeit, ein für alle Mal damit aufzuräumen, meint Professor Dr. Peter Glotz, Direktor am Institut für Medien- und Kommunikationsmanagement in St. Gallen: »Die Idee der amerikanischen Entwicklungsschmiede MIT vom intelligenten Kühlschrank geistert schon seit mehr als zwanzig Jahren durch die Welt, dabei hat es diesen Kühlschrank nie gegeben«, so der SPD-Politiker auf dem Podium der von Computer Associates veranstalteten Infoexchange@ca 2003 am 6. Oktober in Mannheim.
Bei aller Technikbegeisterung sei es nicht nachzuvollziehen, warum »mir mein Kühlschrank vorschreibt, was ich essen und trinken soll«, kommentiert Glotz das nutzlose Beispiel für integrierte Inhouse-Systeme. Weitaus nutzbringender sind dagegen Anwendungen, die Dr. Viktor Grinewitschus, Gruppenleiter am Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme, in dem Projekt »inHaus-Zentrum für intelligente Haussysteme Duisburg« entwickelt (www.inhaus-duisburg.de). Um intelligentes Wohnen zu testen, baute Grinewitschus mit seinem Team ein Doppelhaus in Duisburg, in dem moderne Technik geschickt miteinander verbunden und vor Ort von Bewohnern erprobt wird. Grinewitschus: »Moderne Ausstattung soll praktische Unterstützung im Alltag liefern, Komfort und Sicherheit erhöhen sowie Zeit sparen«. Im Prinzip macht der Projektleiter nichts anderes, als vorhandene Komponenten – Elektronik, TK-IT-Endgeräte und Netze – geschickt auf einer Plattform zu integrieren, um neue Anwendungen zu generieren. Eigens dafür entwickelte Techniken oder Produkte kommen nicht zum Tragen. So dient beispielsweise das große Wand-LC-Display sowohl als Fernseher wie auch als Überwachungsmonitor für die Garageneinfahrt, der automatisch ein Bild einblendet, sobald jemand den Bereich betritt.
Grinewitschus hat noch weitere Anwendungen im Test. So beispielsweise die Mobilfunkmeldung auf dem PDA, die ausgelöst wird, wenn Sensoren am Haus Alarm geben. Der Hausbesitzer bekommt – egal wo er sich gerade befindet – ein Bild aufs Display übermittelt und kann sofort die Ursache feststellen und gegebenenfalls reagieren.
Noch ein Beispiel: Sollte die Heizung einmal mitten im kalten Winter versagen, erhält der Vertragshandwerker vom »elektronischen Hausmanager« eine E-Mail und eine SMS aufs Handy. Nun kann er vom Homeoffice aus per Internet die Anlage analysieren und erfährt, welche Werkzeuge und Ersatzteile er zur Reparatur benötigt. Ist er einmal vor Ort, kann er per Multimedia-Handy die genaue Installation sowie die aktuellen Daten der ganzen Anlage aufrufen.
Dieser hohe Integrationsgrad lässt sich theoretisch nur über einheitliche Standards erreichen. Da im intelligenten Haus eine Vielzahl heterogener Komponenten und Verbindungsarten zusammen spielt, muss die Einbindung per Software gesteuert werden. Um den Administrationsaufwand möglichst gering zu halten, streben die Projektentwickler einen hohen Automatisierungsgrad an. Grinewitschus: »In den 80er Jahren kommunizierten Menschen mit Menschen per E-Mail über das Internet, in den 90er Jahren kommunizierten Menschen mit Maschinen über das Internet und in den kommenden Jahren werden Maschinen autonom miteinander über das Internet kommunizieren«. Ein Navigationsrechner im Auto macht das heute bereits mit dem Traffic-Control-System, das auf manchen Autobahnen installiert wurde.
Geht es nach dem Projektleiter, so könnte ein Zukunftsszenario damit folgendermaßen aussehen: »Beim Verlassen des Büros wird die Heizung heruntergefahren, Telefonanrufe und E-Mails werden je nach Anrufer auf die Sekretärin, das Handy oder den PDA umgeleitet. Der Dienstwagen ist reserviert und kann ohne Schlüssel verwendet werden. Der Navigationsrechner ist bereits programmiert und begleitet den Fahrgast zum reservierten freien Parkplatz am Flughafen. Die Erfassung und Abrechnung von Parkgebühren erfolgt automatisch. Per Navigation wird der Weg vom Flugplatz am Zielort zum Hotel aufgezeigt. Dort betritt man das personalisierte Hotelzimmer ohne Schlüssel und steuert die Raumtemperatur und sonstige Bedienung per Sprachsteuerung. Die Präsentation für das Meeting ist bereits auf den Rechner überspielt und wird mit dem persönlichen Code lesbar gemacht.«
Obwohl Grinewitschus heterogene Techniken zusammenführt, ist auch er auf die Vereinheitlichung und somit auf die Weiterentwicklung von Standards angewiesen. TCP/IP, HTML und Java sind wichtige Bausteine für eine Kommunikationsplattform. Allerdings ist der aktuelle Status Quo dieser Standards unzureichend. »Die Standardisierung der Informationen im Internet und die Sicherung der Zuverlässigkeit von Informationen erfordern weitere Entwicklungen und ein Redesign des Internets«, so Grinewitschus.
Schlüsselwort Integration
Ein Schlüsselwort für die Weiterentwicklung von Anwendungen heißt »Integration«. Ein Beispiel aus der Unternehmens-IT ist das intelligente, automatisierte Management und die Steuerung von Prozessen. Die Geschäftsprozesse eines Unternehmens verändern sich und erfordern einen hohen Integrationsgrad der Techniken und Anwendungen. Da die Anzahl der Prozesse zunimmt, muss die Software weitgehend autark arbeiten und den Administrator entlasten. Voraussetzung dafür ist eine äußerst intelligente Managementsoftware, die automatisch Veränderungen in den Prozessen wahr nimmt und die richtigen Entscheidungen für die Steuerung trifft.
Am Beispiel des On-Demand-Computing – bedarfsorientierter IT-Dienstleistung – wird deutlich, wie dies in der Praxis funktionieren kann: Einen wesentlichen Baustein für ein derartig intelligentes Management von Geschäftsprozessen hat Computer Associates mit der sogenannten »Sonar«-Technologie entwickelt. Zusammen mit der Managementlösung Unicenter bildet Sonar eine umfassende Management-Infrastruktur beim On-Demand-Computing. Hier werden Geschäftsprozesse analysiert und verwaltet. Dem Administrator wird ein vollständiger Einblick in die On-Demand-Infrastrukturen und ihre Wirkung auf Unternehmensabläufe dargestellt. »Sonar korreliert Geschäftsprozesse mit den entsprechenden IT-Komponenten und gleicht Investitionen in die IT-Infrastruktur mit den geschäftlichen Prioritäten ab«, so die Technikbeschreibung. Anders ausgedrückt: Sonar ist die Intelligenz zur Integration und Automatisierung von Prozessen im Netzwerk. Damit beeinflusst die Technik die Flexibilität und Vielfalt der Anwendungen eines Unternehmens und nimmt somit indirekt Einfluss auf dessen Wettbewerbsfähigkeit.
Am Beispiel der Sonar-Technik in Lösungen von Computer Associates wird deutlich, wie vielseitig deren Einsatz ist. So automatisiert der Brightstor-Process-Automation-Manager die Zuteilung und Bereitstellung von Speicherressourcen entsprechend den geschäftlichen Anforderungen über verschiedene Plattformen hinweg. Der E-Trust-Vulnerability-Manager dagegen erkennt automatisch, welche IT-Komponenten im Unternehmen Schwachstellen aufzeigen, die die Sicherheit der IT-Umgebung bedrohen. Die Lösung analysiert in Echtzeit die IT-Systeme eines Unternehmens und stellt diese Bestandsaufnahmen einer stets aktuellen Datenbank bekannter Schwachstellen gegenüber. Die CA-Lösung sorgt außerdem dafür, dass durch die jeweils gültigen Sicherheits-Patches Konfigurationsstandards beibehalten werden können. Unicenter-NSM-Option-for-Vmware-Software wiederum überwacht virtuelle Rechnerumgebungen auf Intel-basierten Linux- und Windows-Plattformen. Diese Lösung ermittelt, ob zusätzliche Ressourcen benötigt werden, um vereinbarte Service-Levels zu erfüllen.
Wer nicht integriert, verliert
Peter Rasp, Geschäftsführer von Computer Associates in Deutschland, bezeichnet Integration generell als »Dreh- und Angelpunkt« künftiger Entwicklungen. Für Unternehmen ist sie eine unabdingbare Voraussetzung, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Für die betroffenen Individuen und die Gesellschaft gelten allerdings die selben harten Gesetze: »Die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnik wird die Gesellschaft regelrecht umpflügen«, so Peter Glotz. Er vertritt die Auffassung, dass das Internet die Lebenszeit von Produkten verkürze und den »Time-to-Market«-Prozess hervorhebe. Damit würde der gesamte Lebensrhythmus unserer Gesellschaft beschleunigt. Wer in diesem Prozess der Geschäftsprozess-Beschleunigungen nicht Schritt halten kann, falle unten durch. Glotz geht so weit, dass er bei der weiteren Entwicklung von der »analogen in die digitale Gesellschaft« von einer Aufteilung der Gesellschaft in zwei Klassen spricht – jenen zwei Dritteln, die Schritt halten können und wollen und dem anderen Drittel, die sich dagegen verwehren oder nicht in der Lage dazu sind. Welches Ausmaß diese Entwicklung noch annehmen wird, lässt sich leicht aus dem Fazit des Politikers ableiten: »Unsere Gesellschaften werden zwischen 2009 und 2014 ganz von der digitalen Technologie durchdrungen sein. Die »New Economy« war nur eine Zwischenphase, ein vorbeiwischender Hype. [ nwc ]