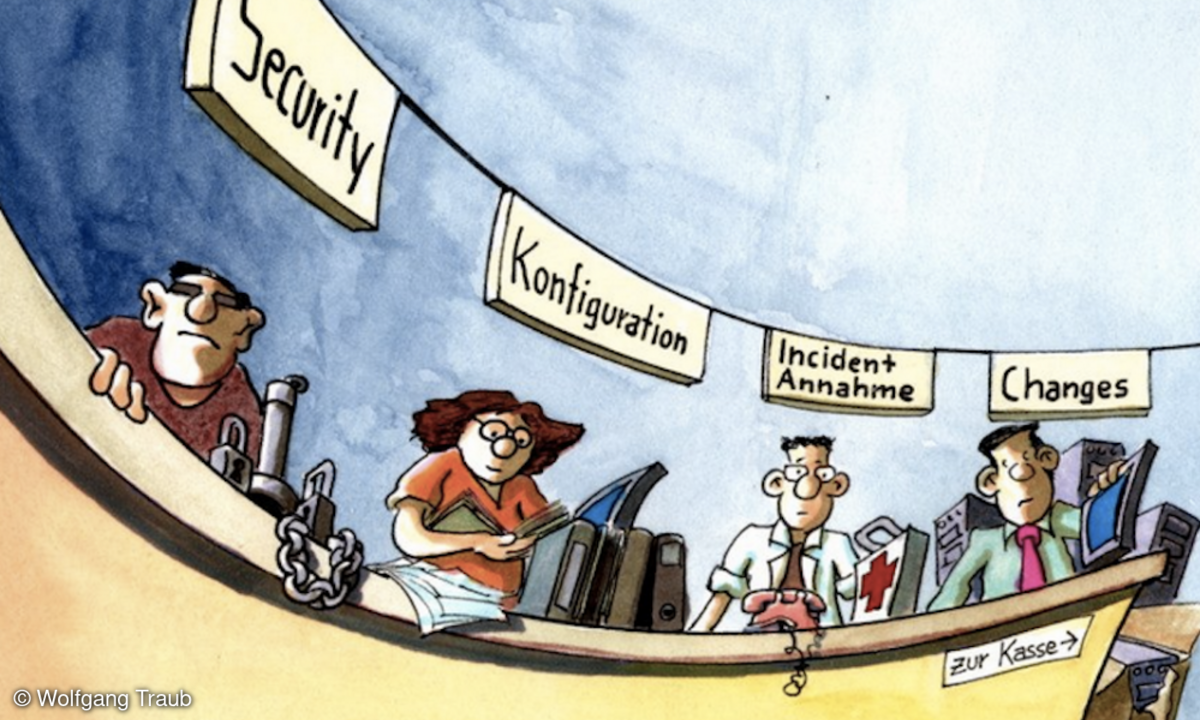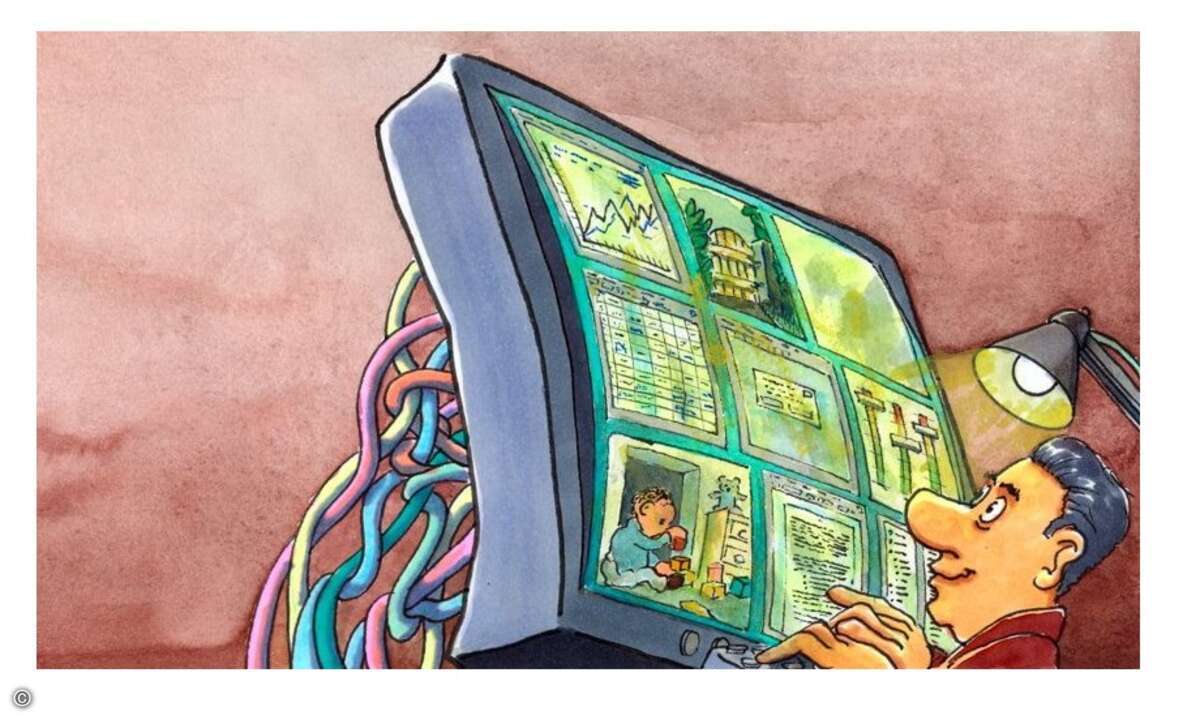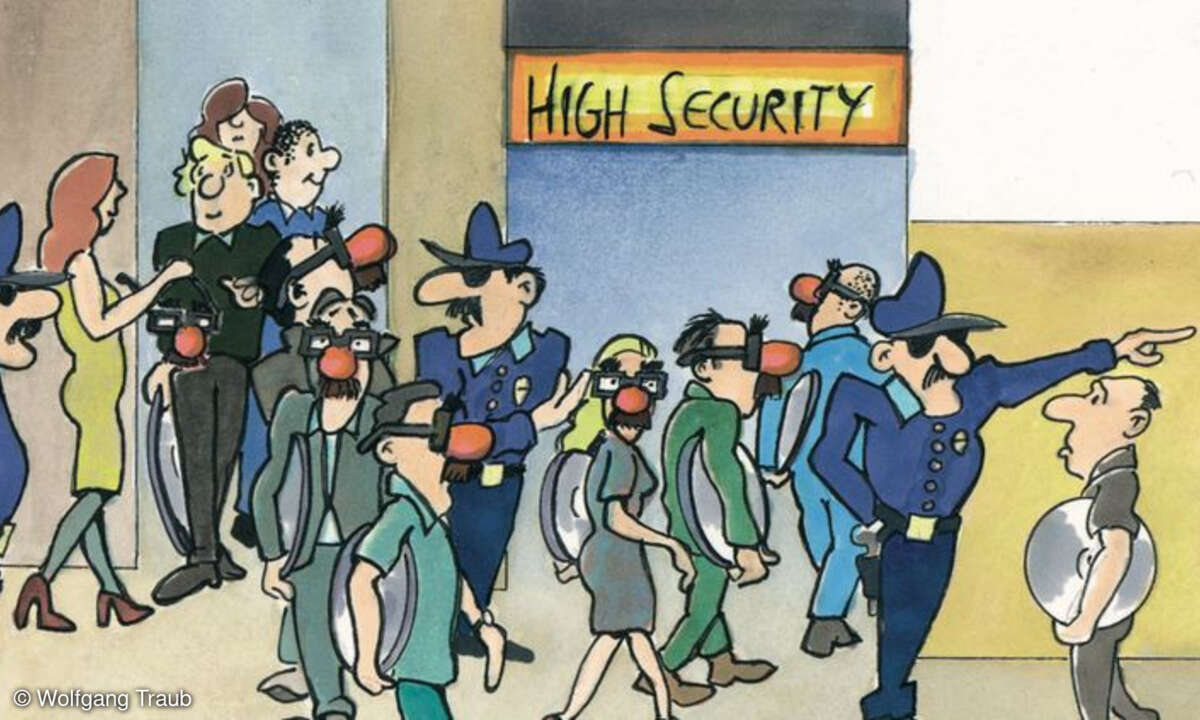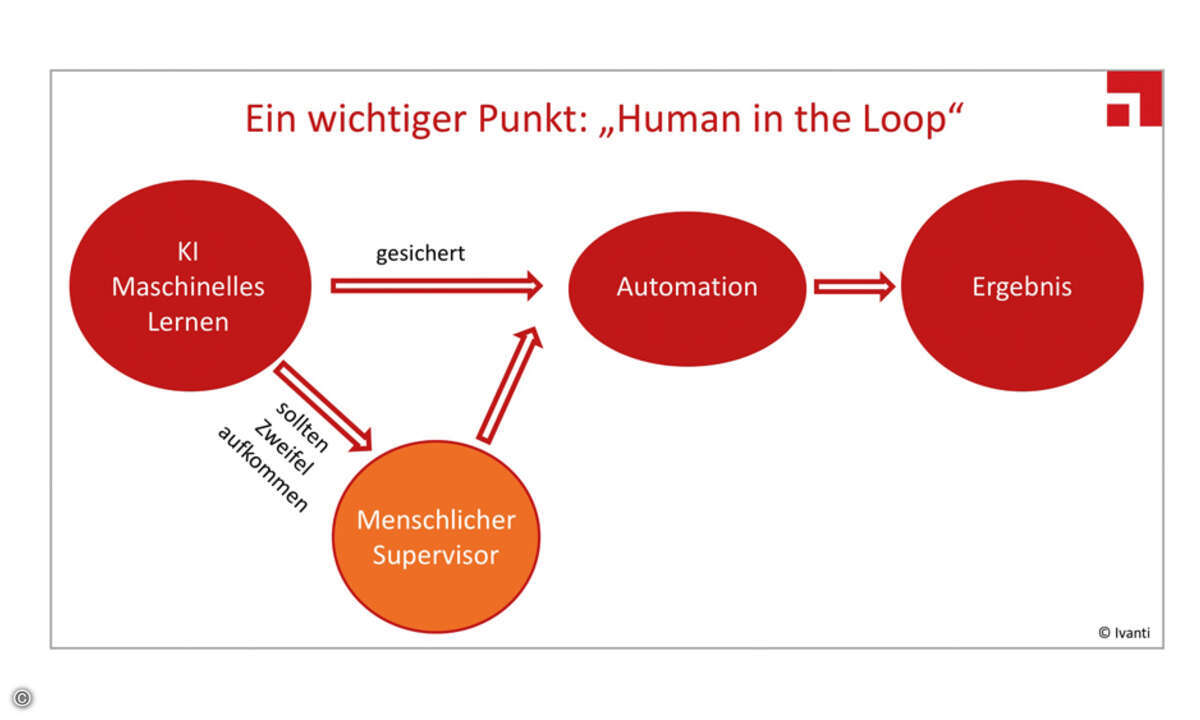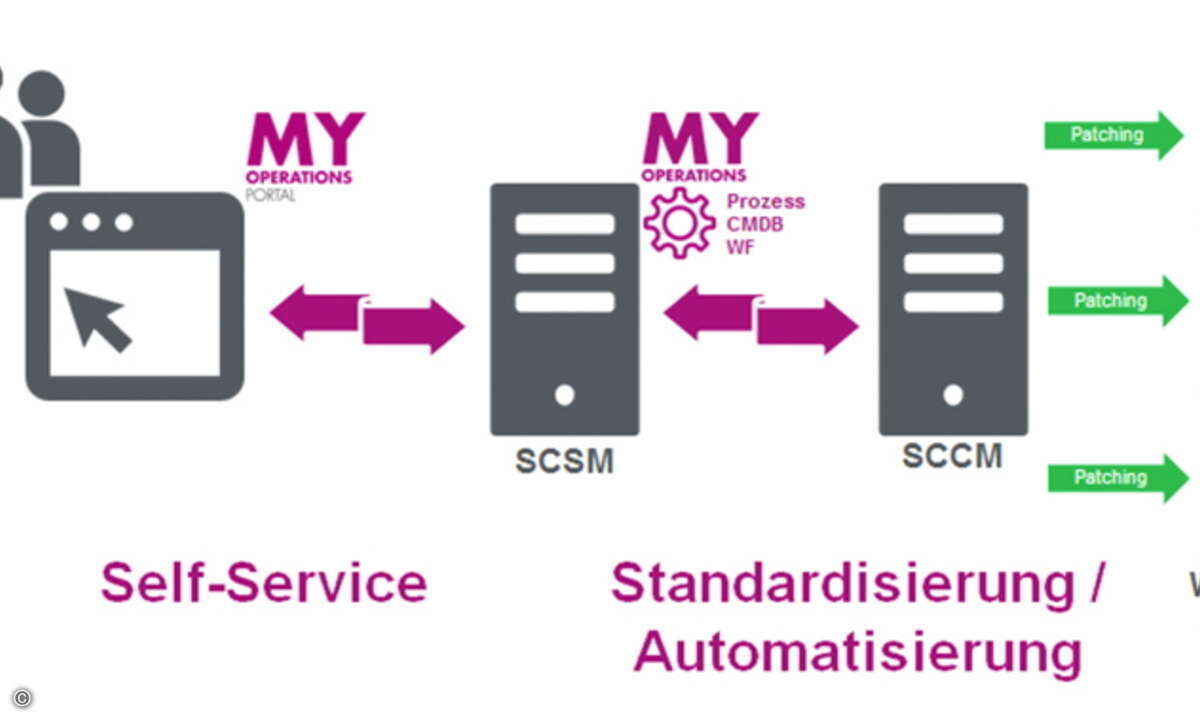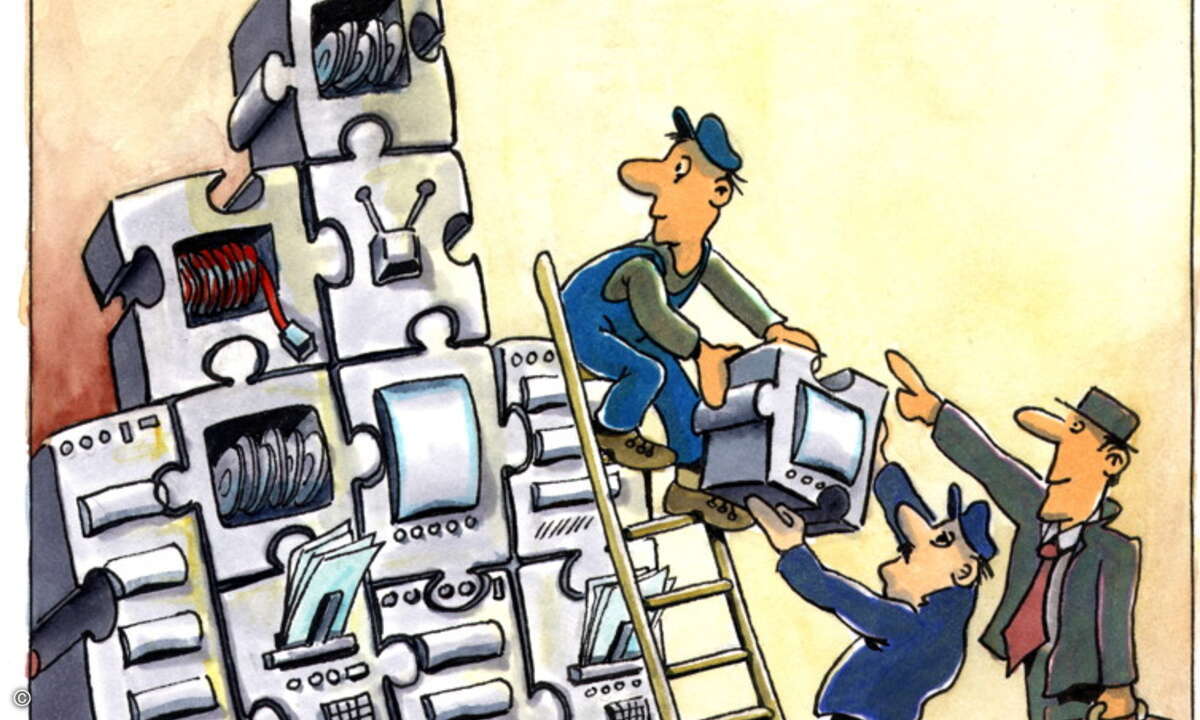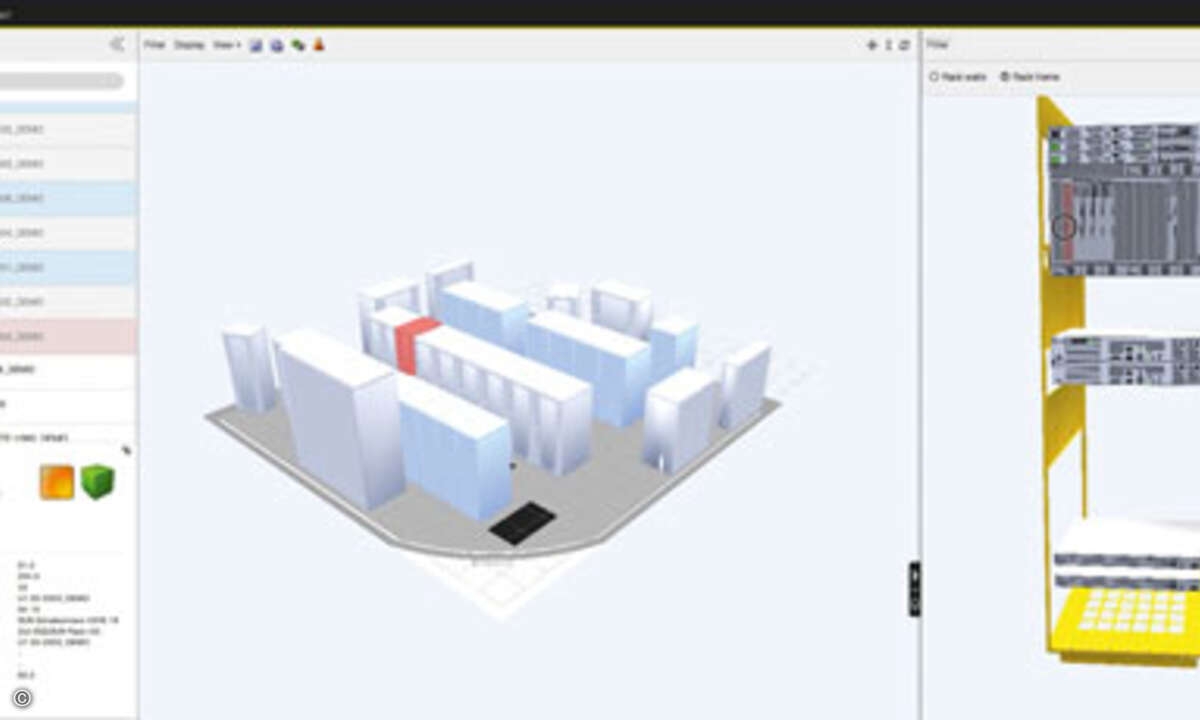Netzwerk-Management


Wie gut ist Service-Management mittlerweile gelöst?Dürfen die Anwender glauben, was die Hersteller versprechen?
Eine gute Vorbereitung ist der halbe Weg zum Erfolg, denn Technologie allein löst nicht das Problem.
Dietmar Thom, Competence-Manager bei Siemens Business Services
Die Verfügbarkeit, Performance und Qualität der Prozesse sind in Online-Zeiten entscheidend für das Unternehmensgeschäft. Service-Management ist das geeignete Mittel dazu. Es hält die Geschäftsprozesse und damit das Geschäft auf Trab. Doch Technologie allein löst nicht das Problem. Service-Management setzt eine gründliche Analyse voraus, um genau das Maß an Verfügbarkeit, Performance und Quality-of-Service herauszukristallisieren, das jeder Geschäftsprozess braucht. Denn nur im Wissen um dieses konkrete Anforderungsmaß wird später das Service-Management im richtigen Kosten-/Leistungsverhältnis stehen. Service-Management nach Maß heißt auch, präventiv die Geschäftsprozesse zu verbessern, um später die technische Umsetzung des Service-Managements nicht auf Kosten des Budgets sowie der Service- und Systemtransparenz überzudimensionieren. Die strikte Orientierung an (ITIÖ) IT Infrastructure Library leistet dazu gute Dienste. Diese systematische und praxisnahe Methode ermöglicht, IT-Organisation und -Betriebsprozesse mit der IT-Architektur als Lieferant der IT-Services unter einen Hut zu bringen. Über die Art und Weise, wie Prozessvorgaben umsetzbar und welche Service-Managementwerkzeuge dazu am besten geeignet sind, hilft ITIL nicht weiter. Hier ist das Unternehmen, am besten mit kompetentem Beistand, gefordert, die richtigen organisatorischen und technologischen Entscheidungen zu treffen. Eins ist klar: Service-Management umfassend betrachtet muss alle IT-Leistungsträger über die interne Prozesskette integrieren, einschließlich der Desktops. Enterprise-Managementsysteme können das bis heute nicht lückenlos leisten. Viele haben vor allem beim Desktop-, aber auch in der Königsdisziplin, dem Service-Management, ihre Schwächen. In der Praxis ist für ein effizientes Service-Management also nicht an einem Mix von Werkzeugen unterschiedlicher Hersteller vorbeizukommen.
Auf die Qualität der Ereigniskorrelation kommt es an. Hier sind Zusatzlösungen gefordert.
Manfred Mackert, Leiter Business-Development OSS bei Steria
Über die Breite der Anbieterschaft fällt die Qualität des Service-Managements höchst unterschiedlich aus. Vor allem die Qualität der Correlation-Engine als Erweiterung zum Fehlermanagement differiert unter den Anbietern. Nur wenn das Herz des Service-Managements alle Fehlerereignisse lückenlos registriert, hinreichend qualifiziert (verdichtet) und in voller Systembreite über alle IT-Domänen – Netzwerk, Server, Dienste, Anwendungen und Datenbanken – korreliert, wird das Unternehmen aus Prozesssicht von einer umfassenden Störungsüberwachung, Problemanzeigen nur bei akutem Handlungsbedarf und einer schnellen Problembehebung profitieren. Dazu gehört auch für eine bessere Übersicht und schnellere Reaktionen an der Konsole, dass Kurzzeit- und toggelnde Alarme zusammengefasst, die eigentlichen Fehlerursachen per Root-Cause-Analyse selbsttätig ermittelt und Folgealarme konsequent ausgeblendet werden. Erst dann kann von einem aktiven, sogar präventiven Fehlermanagement die Rede sein. Das alles wiederum ist für das Unternehmen gleichbedeutend mit hoher Effizienz im IT-Betrieb, kurzen Fehlerbehebungszeiten im Problemfall sowie Prozessen, die sich im Sinn eines effizienten Geschäftsauftritts soweit wie möglich an den für sie definierten Service-Level-Agreements (SLAs) halten.
Die Professionalität des Service-Managements lebt also förmlich von der Qualität der Korrelationsmaschine. Diese wichtige Entscheidung durch kompetente externe Unterstützung zu treffen, wird sich in der Regel für das Unternehmen immer auszahlen, bevor eine falsche Entscheidung zu Lasten des Budgets und der Effizienz des Geschäftsauftritts geht. Zumal umfassende Enterprise-Managementplattformen bei den geforderten Qualitäten noch Lücken lassen. Sie gilt es, durch das richtige Zusatzprodukt zu füllen, das nahtlos auf dem Fehlermanagement solcher Plattformlösungen aufsetzt.
Komplexität und Herstellerabhängigkeit
lassen grüßen. Die Architekturen sind weiterhin proprietär.
Hadi Stiel, Berater und freier Fachjournalist in Bad Camberg
Service-Management passt augenscheinlich genau ins Prozessbild der Unternehmen. Immerhin wird über die Geschäftsprozesse buchstäblich das Geschäft gemacht. Wieso also nicht die Ereignisse von dieser Warte aus überwachen und steuern?
Was auf den ersten Blick so einleuchtend erscheint, hat jedoch für den Anwender seine Tücken. Um den Service-Management-Gedanken voll mit Leben zu erfüllen, müssen alle IT-Leistungsträger in ein umfassendes Enterprise-Management integriert werden. Auch wenn die Hersteller Begriffe wie Management-Framework auf Grund der komplexen Erfahrungen der Anwender in der Vergangenheit nicht mehr in den Mund nehmen: An den komplexen Managementkonstruktionen hat sich dadurch wenig geändert. Zumal die Hersteller solcher Rahmenwerke ihre proprietäre, herstellerbindende Architektur weitgehend beibehalten haben. Ganz im Gegenteil: Durch das Service-Management ist die Gesamtlösung noch komplexer und dadurch nicht weniger projektaufwendig in der Umsetzung geworden. Gesamtprojektlaufzeiten zwischen eineinhalb und weit länger als zwei Jahren sind damit keine Seltenheit. Diese Tatsache bringt auch voreilig festgelegte Amortisierungsmodelle schnell zu Lasten der Anwender in Schieflage.
Zumal auch der zusätzliche Integrationsaufwand im Rahmen des Service-Managements nicht unterschätzt werden sollte. Denn Alleskönner sind auch die neuen Service-Management-Frameworks nicht. So weisen sie in der Regel erhebliche Schwächen beim Desktop-Management, teils sogar bei der Königsdisziplin on-top des Rahmenwerks, dem Service-Management, auf. Solche Lücken müssen aufwändig durch Speziallösungen oder Zusatzprodukte gefüllt werden. Auch von einer Integration aller installierten Netzwerkkomponenten, Server, Betriebssysteme, Netzdienste, Anwendungen, Datenbanken und Speicherlösungen ins Service-Management können die Unternehmen nicht zwangsläufig ausgehen. So fehlen unter den Rahmenwerken immer noch für viele Systeme die Integrationsagenten oder aber die Metriken, um sie in Ereignis-Korrelationen und damit ins Service-Management einzubinden. Auch diese Lücken zu füllen verursacht erhebliche Zusatzkosten.