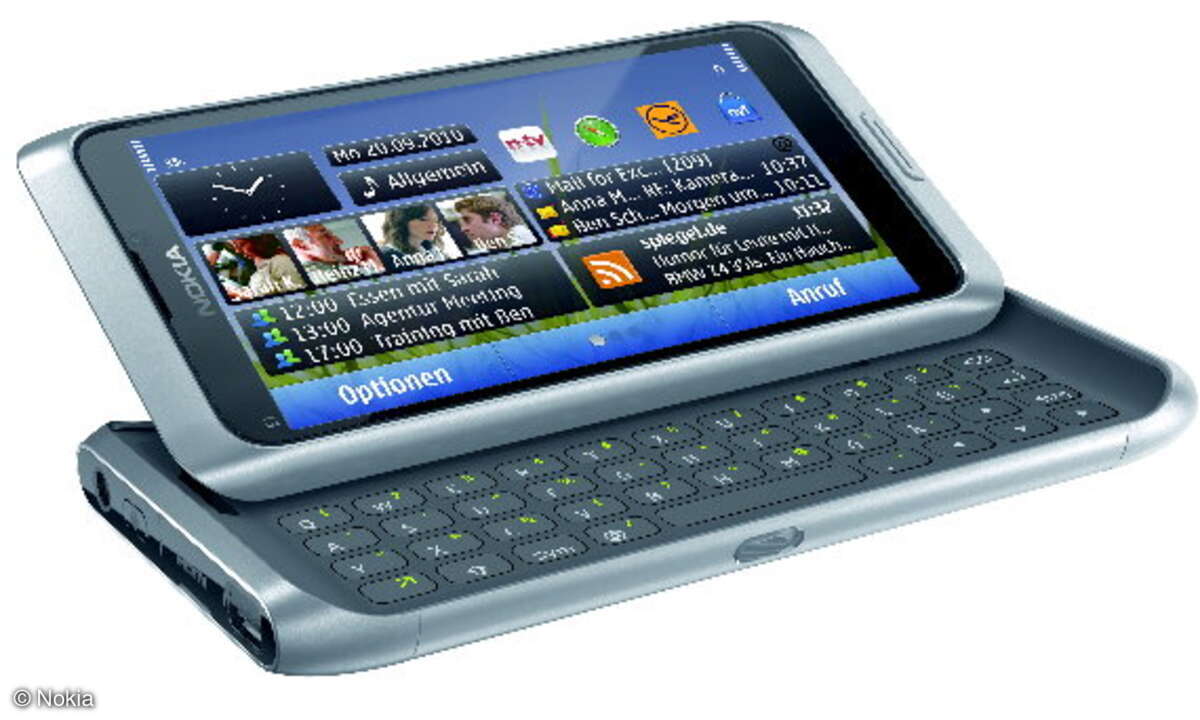Rightsourcing ? ein Balanceakt
Rightsourcing ? ein Balanceakt. Immer mehr Unternehmen holen ihre IT-Töchter zu sich zurück. Reintegration allein birgt jedoch nur wenig Potenzial. Ein Spannungsfeld aus internen und externen Leistungen bietet mehr: Flexibilität, erhöhte Wettbewerbsfähigkeit, Kostensenkungspotenziale.
- Rightsourcing ? ein Balanceakt
- Rightsourcing ? ein Balanceakt (Fortsetzung)
Rightsourcing ? ein Balanceakt
In den 90er Jahren gehörte es regelrecht zum guten Ton, die eigene IT-Abteilung auszulagern und sie in eine unabhängige IT-Tochter zu verwandeln. In den letzten drei Jahren sind allerdings immer mehr IT-Töchter in den Fokus der Mutterunternehmen geraten. So verbuchten die meisten IT-GmbHs zuletzt zwischen 80 und 90 Prozent ihres Umsatzes nur über Aufträge ihrer Mütter.
Der Verkauf der Tochter ist eine Lösungsmöglichkeit. Die Veräußerung der ThyssenKrupp-Tochter Triaton an Hewlett-Packard ist zwar ein Paradebeispiel dafür, wie man es beim Verkauf seiner IT-Einheit schafft, gleichzeitig einen strategischen IT-Partner zu finden, bleibt jedoch wie der Verkauf der DaimlerChrysler-Tochter Debis an die Deutsche Telekom eine Ausnahme. Dies liegt zumeist darin begründet, dass die eigene Vertriebskraft fehlt und für Externe ein Kauf wenig lukrativ erscheint.
Viele Konzerne reagieren dann mit einer schnell entschiedenen Reintegration. Die rechtliche und operative Selbständigkeit wird aufgegeben, und man holt die IT-Töchter »zurück ins Elternhaus«. Übereilt ist man von den vermeintlich klaren und häufig publizierten Vorteilen überzeugt, wie zum Beispiel Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen der IT und den Geschäftsbereichen sowie Kosteneinsparungen. Aber Achtung: Schnell stellt man fest, dass die verbesserte Zusammenarbeit nicht primär ein rechtliches oder prozedurales, sondern ein Führungsthema ist. Die gleiche Verbesserung hätte man auch ohne eine große Neuorganisation haben können, allerdings mit bedeutend weniger Unruhe. Und bei den Kosteneinsparungen setzt das böse Erwachen ein. Grundsätzlich können zwar Kosten, etwa für den Jahresabschluss sowie der Aufwand für Rechnungserstellungen durch eine Reintegration reduziert werden, doch die ergebniswirksamen Veränderungen sind marginal. In anderen Fällen sinken Kosten nur vordergründig, wie zum Beispiel die auf der Gesamtmitarbeiterzahl basierenden Wirtschaftsprüfungskosten. Viel schlimmer ist jedoch, dass sich beim Hauptkostenblock, nämlich den Personalkosten, auf einmal gegenläufige Effekte einstellen, etwa durch tarif- und betriebsratsrelevante Veränderungen. So erhöhten sich in einem konkreten Fall die Personalkosten, da der reintegrierte Bereich auf einmal Überstunden bezahlen musste.
Den Königsweg gibt es sicher nicht, aber einen situativen, für das jeweilige Unternehmen passgenauen Ansatz. Dieser ist gekennzeichnet durch eine ganzheitliche Sourcing-Strategie und deren konsequente Umsetzung, hier als praktisches Rightsourcing bezeichnet. Praktisches Rightsourcing überwindet die häufig nur aus einer eindimensionalen Kostensicht gestellte Frage »Make or Buy« und ist dabei nur auf den ersten Blick widersprüchlich zum Trendthema Outsourcing. Ganz im Gegenteil: Gerade bei erheblichen Outsourcing-Umfängen ist praktisches Rightsourcing erfolgsbestimmend, indem es die Gelegenheit bietet, sich gezielt mit der eigenen IT-Strategie inklusive Fokussierung von Kern-kompetenzen auseinanderzusetzen. So wird verhindert, dass solide laufende interne Prozesse gestört werden oder ein Freeze entsteht: Einmal festgelegte Abläufe und IT-Unterstützung werden zwar kostengünstig definiert, aber Fortschritt erstickt in tödlichen Diskussionen mit externen Dienstleistern ? und firmenspezifische Nähe zu den eigenen Geschäftsprozessen geht verloren.
Ganzheitliches Rightsourcing vernetzt zwei Dimensionen:
-Aufgabeninhalte: Konzepte/Prozesse, Software, Hardware/Netzwerke, Dienstleistungen
-Aufgabenträger: das Spannungsfeld eigener und dritter Leistungserstellung
Die reintegrierten Aufgabeninhalte (rote Pfeile in Abb. 1) bilden den Gegenpol, der die Nähe zu den eigenen Geschäftsprozessen aufrecht erhält, dabei dem Trend zum Outsourcing (graue Pfeile) Rechnung trägt und somit einer Einseitigkeit vorbeugt. Die Pfeile spiegeln hierbei eine Tendenz wider und können sich bei verschiedenen Unternehmen unterschiedlich darstellen. Ausschlaggebend ist, dass praktisches Rightsourcing für eine notwendige Balance zwischen der geschäftsprozessnahen Aufgabenerfüllung und den oft weit entfernten outgesourcten Funktionen sorgt und somit die Flexibilität des Mutterunternehmens entscheidend erhöht.