Schluss mit der Zettelwirtschaft
Schluss mit der Zettelwirtschaft Mit einem elektronischen Auftragsbearbeitungssystem in den Stationen hat das Uniklinikum Göttingen das sehr fehleranfällige und teure Papierformularwesen abgeschafft. Flexible Etiketten und Barcodedrucker erleichtern das Analysemanagement deutlich.
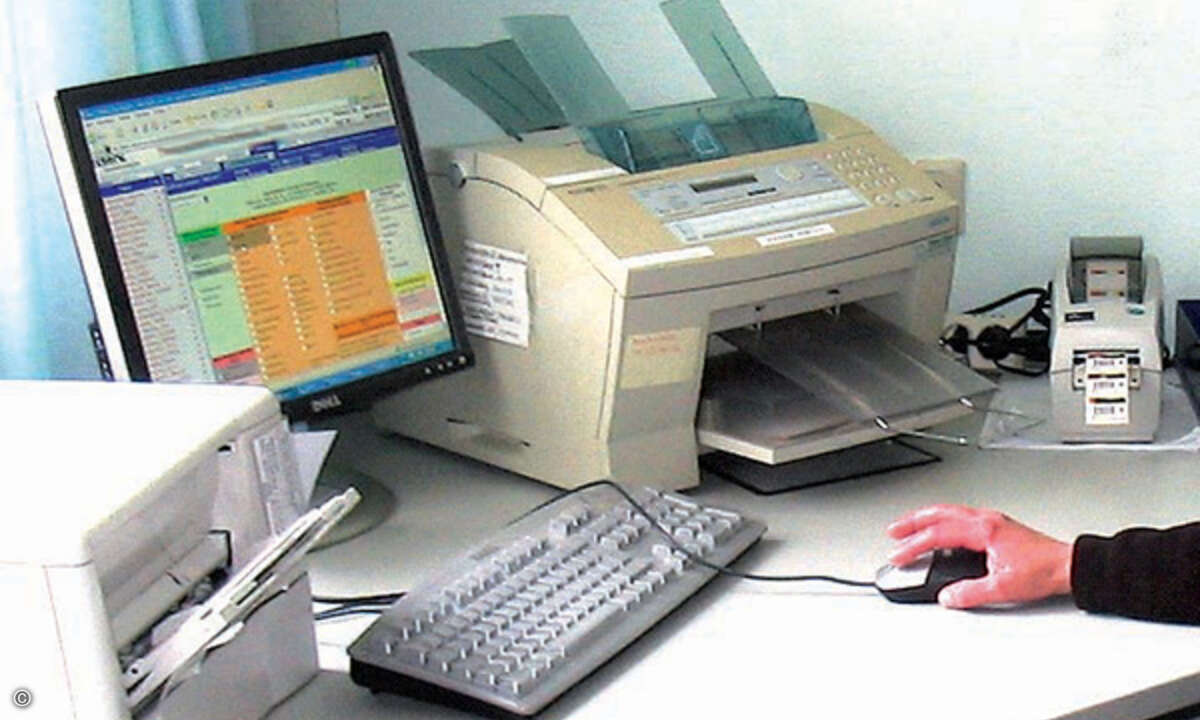

Blut ist bekanntlich ein ganz besonderer Saft, dessen genaue Analyse viel über den Gesundheitszustand eines Menschen verrät. Blutanalysen gehören deshalb zur täglichen Routine von Arztpraxen und Kliniken. Allein die schiere Zahl dieser Analysen, die täglich in einem größeren Krankenhaus durchgeführt werden, macht eine möglichst umfassende Automatisierung unumgänglich. Entsprechende Automatisierungspotenziale gibt es vor allem an der Nahtstelle zum Krankenbett, sprich zu den einzelnen Patienten. »Im Zentrallabor des Universitätsklinikums Göttingen müssen täglich rund 1500 Patientenproben untersucht werden«, berichtet Dr. Hilmar Luthe, verantwortlich für das Labormanagement am Klinikum, und er rechnet vor: »1500 Proben summieren sich täglich auf rund 12000 Analysen, das entspricht 4,2 Millionen Ergebnissen pro Jahr. Es ist klar, dass ein solches Volumen nur mit einem hohen Automatisierungsgrad ökonomisch durchführbar ist«.
Riesige Mengen an Altpapier
Nicht zuletzt ist die Automatisierung der Analyse aber eine Frage der Sicherheit für jeden einzelnen Patienten. »Früher waren immer wieder einige Befunde nicht zuzuordnen, weil auf dem Weg vom Krankenbett ins Labor und zurück ins Arztzimmer etwas schief gelaufen war«, sagt Luthe. »Früher«, das ist indes noch gar nicht so lange her. Denn obwohl das Labor schon länger über ein IT-gestütztes Befundmanagementsystem verfügte, waren die patientenseitigen Abläufe bis vor kurzem noch papiergebunden. »Wir hatten jährliche Kosten von rund 60000 Euro für die Erstellung, den Druck und die Vorratshaltung der entsprechenden Belege, die dann am Krankenbett bei der Blutentnahme handschriftlich ausgefüllt und dann an anderer Stelle in das Befundmanagementsystem eingepflegt wurden«, sagt Luthe und deutet damit eine gewaltige Zettelwirtschaft an. Gleichzeitig mussten die Mitarbeiter immer das richtige Etikett für die Blutentnahme-Monovette finden. Nicht immer sei bei diesem Papierkram zu vermeiden gewesen, dass eine Serum-Monovette versehentlich für eine Blutbild-Bestimmung statt für einen Hepatitis-Nachweis gekennzeichnet war. Das sei zwar für die Patienten nicht unmittelbar lebensbedrohlich, erzeuge aber unnötige Kosten und Ärger. Das ganze Procedere sei im Übrigen noch einmal teurer dadurch geworden, dass die Formulare sehr schnell veralteten, weil ständig neue Untersuchungsmethoden dazu kämen. »Wir konnten immer nur relativ kleine Auflagen drucken oder wir hatten riesige Mengen an Altpapier«, beschreibt Luthe die Situation vor ein, zwei Jahren.
Fehler praktisch unmöglich
Mittlerweile hat man die Formulareingabe vollständig digitalisiert. Die bisherigen Papierformulare wurden in einem Auftragsbearbeitungssystem elektronisch nachgebildet. Das Auftragsbearbeitungssystem ist direkt mit dem Befundmanagementsystem gekoppelt. Und für die Beschriftung der Proben gibt es Spezialdrucker der Firma Zebra, die spezielle Klebeetiketten (der Firma Diagramm Halbach) mit einem Barcode sowie dem Namen des Patienten, der Auftragsnummer und der Stationsangabe bedrucken. Die Drucker sind speziell für den Labor- und Krankenhausbedarf entwickelt und »sehr flexibel, was die Gestaltung der Etiketten angeht«, lobt Hilmar Luthe. Diese Flexibilität sei auch notwendig, weil das Klinikum die Blutentnahme-Monovetten sehr detailliert kennzeichnen müsse, um einen optimalen Arbeitsfluss zu erreichen. Luthe erklärt den Vorgang: »Die verwendeten Monovetten weisen durch die Farbe auf den Verschlusskappen auf den jeweiligen Inhalt hin, zeigen, ob es sich dabei um Blut, Serum oder Plasma handelt. Diagramm Halbach konnte Etiketten mit einem Balken liefern, der genau die gewünschten Farben enthält. Die Ausgabe der Etiketten an den Druckern ist nun so programmiert, dass alle Farben des Balkens bis auf diejenige, die dem Verschluss der Monovette entspricht, geschwärzt werden«. Durch diese programmiertechnische Hilfestellung ist es für das Stationspersonal einfach, die richtige Zuordnung von Monovette und Etikett zu treffen. Es wird dadurch praktisch unmöglich, dass eine Monovette mit einem falschen Bestimmungshinweis (EDTA-Plasma statt Serum, siehe oben) versehen wird.
Visitenwagen mit WLAN
»Wir haben sehr genau darauf geachtet, dass die Eingangsmasken im neuen Auftragsbearbeitungssystem wie die alten Papierformate aussehen, um die Nutzer nicht zu verunsichern und die Akzeptanz des neuen Systems zu sichern. Das ist uns hundertprozentig gelungen«, sagt Hilmar Luthe. Jetzt könne man darauf aufbauen, dass die Anwender das System angenommen hätten. Mittlerweile kämen auch schon die ersten Anwenderwünsche, die sich auf die erweiterten Möglichkeiten des digitalen Systems stützten, aber das gehe nur Schritt für Schritt zusammen mit den Nutzern. Besonders am Krankenbett, wo ja die Blutentnahme in aller Regel stattfindet, werden sich in der nächsten Zeit noch Verbesserungen verwirklichen lassen. So ist Hilmar Luthe mit Herstellern in Gesprächen über einen »handlichen Visitenwagen, auf dem der Drucker ebenso Platz finden soll wie ein Notebook als WLAN-Arbeitsplatz«. Letztlich sollen nur noch die Blutprobengefäße händisch bewegt werden, alle anderen Tätigkeiten sollen in einen digitalen Arbeitsfluss eingebunden werden.
Bis Mitte 2007 sind alle Stationen ausgerüstet
Was den digitalen Arbeitsfluss angeht, liegt natürlich die Frage nahe, warum man überhaupt noch mit Papieretiketten arbeitet und nicht gleich RFID-Chips eingeführt hat. Schließlich gibt es auch in deutschen Krankenhäusern, beispielsweise in Saarbrücken, schon erfolgreiche Versuche, die Patienten über Armbänder mit Funkchips eindeutig zu identifizieren. Auf diesem grundlegenden Identitätsmanagement könnten dann ohne Medienbruch sämtliche andere Krankenhausprozesse und natürlich auch das Befundmanagementsystem des Zentrallabors arbeiten. Luthe lächelt bei dieser Beschreibung des idealen Szenarios: »RFID ist sicher die Zukunft, das ist keine Frage. Wir sind auch mit Firmen in Kontakt, die RFID-Etiketten auf die Blutentnahmengefäße aufbringen wollen, ebenso haben wir Kontakt mit Laborgeräteherstellern. Im Grunde warten wir darauf, dass Firmen mit großem Anwendungspotenzial die Preise der Funktechnik weiter nach unter drücken«. Aber auch die Einführung des jetzigen Systems mit Barcode-Etiketten und Barcode-Druckern sei für das Auftrags- und Befundmanagement am Universitätsklinikum Göttingen ein Riesenfortschritt, betont Hilmar Luthe. Und es sei auch ein ökonomischer Erfolg. Mittlerweile haben sich auch schon zwei externe Häuser, eines in Göttingen und ein anderes in rund 70 Kilometer Entfernung an das System angeschlossen. Bis Sommer 2007 sollen dann auch alle Stationen im Universitätsklinikum selbst in das System integriert sein.
RFID ist die Zukunft
»RFID ist zwar die Zukunft, aber eine erfolgreiche Einführung beruht auf einigen Voraussetzungen«, greift Hilmar Luthe noch einmal das Thema auf. RFID müsse als Gesamtlösung im Haus eingeführt werden, mit der schon erwähnten Patientenidentifizierung mittels Funkarmband als Grundlage. Dann könne man darauf die einzelnen Anwendungen aufbauen. Je weiträumiger man denke, desto mehr Vorteile ergäben sich durch die Funketiketten: »RFID wäre insbesondere dann von Vorteil, wenn der Patient aus irgendwelchen Gründen die Pflegeeinheit wechseln muss. Während bei dem heutigen System viele Daten erneut eingegeben werden müssten, würden er oder sie mit einem Funkarmband alle relevanten persönlichen Daten mitnehmen können«, erläutert Luthe. Er ist sich sicher, dass das heutige System in die beschriebene Richtung weiterentwickelt werden wird. Aber er weiß auch, dass das dauert: »Ich muss ja nicht nur die Controller und Krankenhausgremien vom ökonomischen Sinn einer solchen Investition überzeugen, sondern auch Ärzte und Pflegepersonal davon, dass ein solches System ihnen letztlich die Arbeit leichter macht«. Bei dem jetzt eingeführten Barcode-System ist diese Überzeugungsarbeit gelungen. Das System ist vom Krankenhauspersonal gut angenommen worden und die Controller haben auch Freude: »Die Investitionskosten sind in anderthalb bis zwei Jahren wieder drin«, ist sich Luthe sicher.








