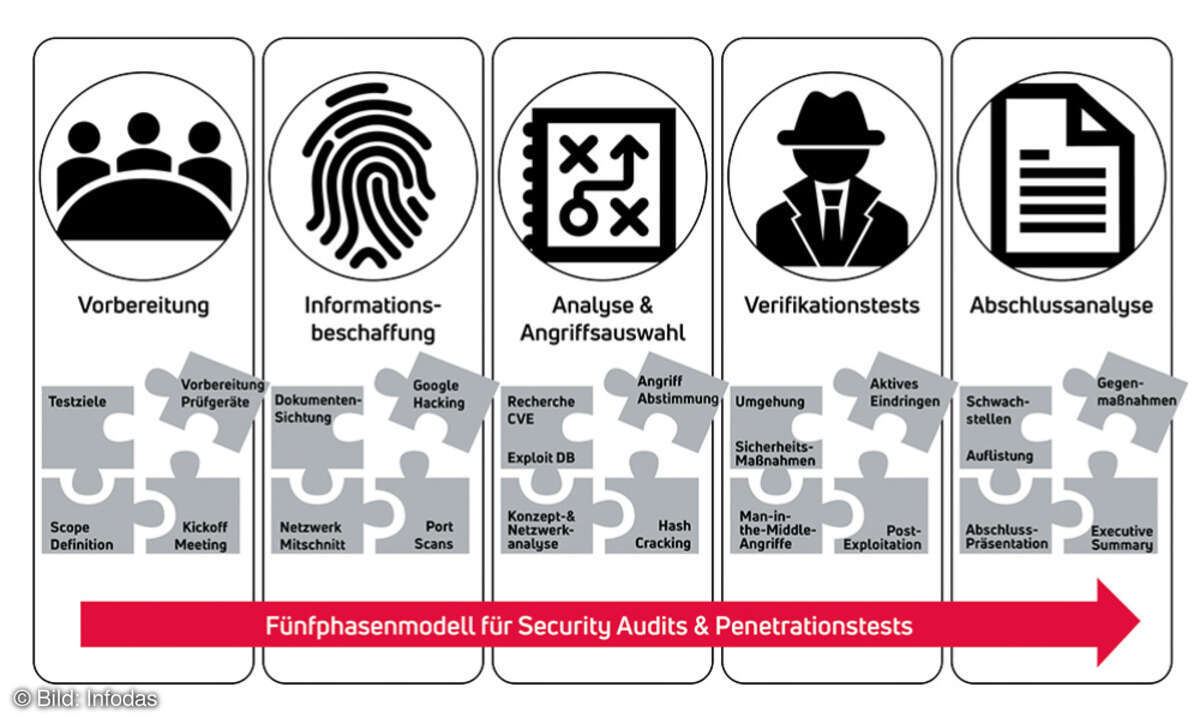Vom Kostentreiber zum Dienstleister
Vom Kostentreiber zum Dienstleister. Große und auch mittelständische Unternehmen geben zunehmend IT-Services an externe Firmen ab, um Kosten zu senken. Die internen IT-Abteilungen wandeln sich unter diesem Druck selbst zu Dienstleistern.
- Vom Kostentreiber zum Dienstleister
- Vom Kostentreiber zum Dienstleister (Fortsetzung)
Vom Kostentreiber zum Dienstleister
Beim Sourcing handelt es sich um die Beschaffung von Produkten oder Dienstleistungen, ohne Art und Umfang zu beschreiben. Sourcing ist damit ein durchaus üblicher Vorgang in jedem Betrieb. Jedes Unternehmen ist es gewohnt, auch kritische Aufgaben an andere Unternehmen abzugeben: zum Beispiel wenn es sich um Zulieferung von Rohstoffen oder speziellen Dienstleistungen wie Klimatisierung oder Energie handelt. Sourcing findet in beliebiger Komplexität statt: vom einfachen Abruf von Unterstützung bei mengenmäßig leicht abrechenbaren IT-Leistungen über Application Sourcing zur Bereitstellung betrieblicher Standard-Software bis zum Business Process Outsourcing zur Auslagerung kompletter Geschäftsprozesse mit hohen IT-Anteilen, etwa der Einkaufs- oder Personalabrechnungsprozesse.
Von der Betriebsabteilung zum IT-Dienstleister
Der erste Schritt in Richtung Sourcing, intern wie extern, besteht bei Mittelständlern ebenso wie bei Großunternehmen darin, die eigene IT als eine Querschnittsfunktion im Unternehmen zu begreifen, die bestmöglich die Anforderungen der Geschäftsprozesse unterstützen soll. Die Wandlung von einer technologiegetriebenen Betriebsabteilung zu einem prozessorientierten Dienstleister setzt allerdings voraus, dass auch die Spielregeln eines freien Marktes einziehen: Angebot und Nachfrage, Entlohnung und Kontrolle.
In der nächsten Phase gilt es, bei den bisher intern erbrachten IT Leistungen Transparenz zu schaffen. Wie viele Störungen werden bis wann zur Zufriedenheit der Anwender behoben? Wie lange dauert die Umsetzung einer fachlichen Anforderung, und was kostet der Betrieb für eine bestimmte Anwendung? Die Ergebnisse einer Ist-Analyse sind oft ernüchternd, weil dabei Schwachstellen aufgedeckt werden. Das bisherige Angebot aller IT-Leistungen wird dokumentiert, quantifiziert und mit Kosten versehen. Aussagen zu Verfügbarkeit und Antwortzeiten von Anwendungen, Ausfallsicherheit und Disaster-Recovery-Methoden, aber auch die Beschreibung der IT-Angebote wie E-Mail, Internet-Zugang und Betrieb eines Help Desks mit Erreichbarkeit und mittlerer Zeit bis zur Problemlösung gehören hierher.
Als nächster Schritt folgt die Festlegung der Anforderungen durch den Auftraggeber nebst Festlegung des Erfüllungsgrades durch die eigene IT, genannt Service Level Requirements (SLR), mit denen auch ein mögliches Delta zum Status Quo festgestellt werden kann.
IT-Service-Management als Methode
Streit ist hier nicht immer ganz vermeidbar. Die IT-Unterstützung geht zuweilen an den Anforderungen vorbei, die Kosten sind zu hoch oder die Prozesse nicht abgestimmt. Immerhin: Die erkannten Potenziale oder Missstände werden das Management zu Verbesserungen motivieren. Als Weg zur Optimierung der Abläufe für Service Delivery und Service Support bietet sich ein Vorgehen nach Grundsätzen des IT-Service-Managements an. Der Best-Practice-Ansatz der IT Infrastructure Library (ITIL) ist als Pflichtlektüre für IT-Manager anerkannt. Er gibt Vorschläge zum Aufbau von IT-Prozessen, ohne Details bei Service Delivery oder Service Support vorzuschreiben.
Zentraler Punkt aller Bemühungen ist das Service Level Management (SLM), sowohl bei In- als auch bei Outsourcing. Als zentraler Kontakt zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer wird hier vereinbart, was Leistungsbestandteil ist und damit eingefordert werden kann. Das gibt zum einen dem Auftraggeber die Gewissheit, dass alle von ihm als Service Level Requirements (SLRs) geforderten Leistungen mit allen Quantitäten und Qualitäten bereitstehen. Zum anderen hilft es dem Leistungserbringer, die Leistungen zu planen und vorzuhalten.
Eine wesentliche Aufgabe übernimmt hierbei der Service Level Manager als Vermittler von Angebot und Nachfrage. Er verhandelt über das Angebot an Leistungen und Entlohnung. Ihm kommt eine Überwachungspflicht der angebotenen Leistungen zu. Verstöße muss er sofort und konsequent verfolgen.
Der IT-Dienstleister wird einen Service-Katalog erstellen, der so etwas wie die Menü-Karte beim Restaurant um die Ecke darstellt. Und so wie der Restaurant-Manager die Zutaten seines Angebotes vorhalten und planen muss, so muss der Service Level Manager für die Bereitstellung der Dienste seines Service-Katalogs sorgen, indem er alle Produkte plant, in vordefinierter Qualität bereithält und einen Prozess zur Entwicklung neuer Produkte aufsetzt.
Die Bereitstellung von Service Desk, Incident Management, Problem und Change Management als weitere ITIL-Disziplinen ist die Grundlage für ein Sourcing von Prozessteilen. Soll etwa das Incident Management mit der Funktion Help Desk an einen externen Dienstleister gehen, müssen sowohl die Anforderungsprozesse (Schnittstelle Service Level Management) als auch die unterstützenden Prozesse (Schnittstellen zu Change und Problem Management) mit allen Details aufgesetzt werden. Eine (teilweise) Ausgliederung kommt auch bei den Themen Application Development, Application Hosting, Service Providing, Client Services oder Operating in Frage.
Nicht alle Prozesse eignen sich jedoch für eine Ausgliederung. Schlüsselaufgaben wie Business Continuity Planning, strategische Prozesse und natürlich das Sourcing Management müssen beim Auftraggeber bleiben. Ein weiteres Negativ-Beispiel sind Versuche, komplexe Anwendungen bei Offshore-Entwicklern billig einzukaufen. Niemand hat bisher gezeigt, wie sich die aus Sprachbarrieren, räumlicher Distanz, kulturellen Unterschieden und vager Zieldefinition ergebenden Reibungsverluste eingrenzen lassen.