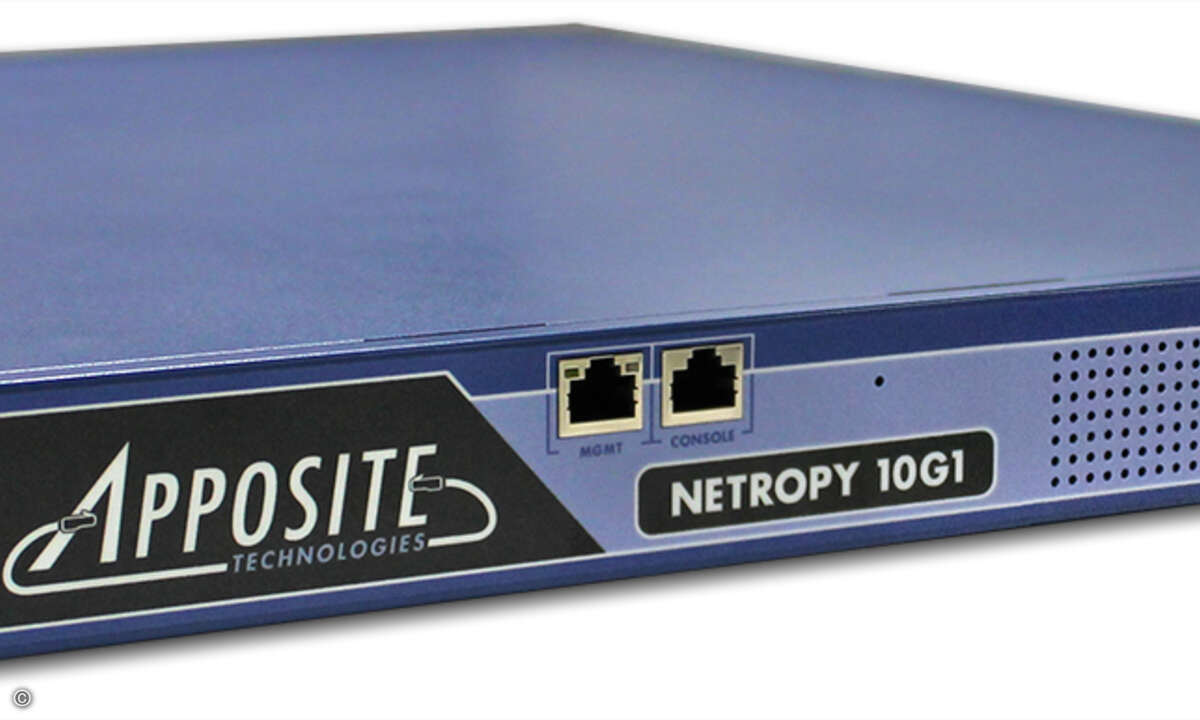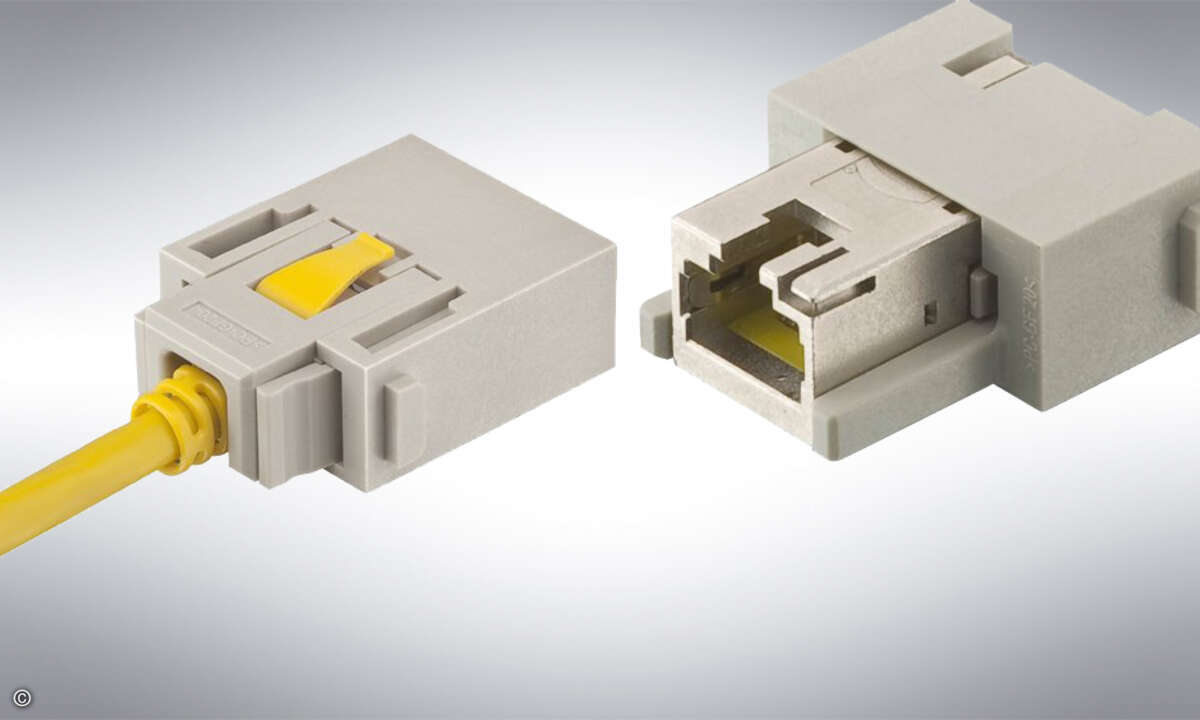Zeitdruck kostet Länge
Wie bei 1 GBit/s soll die Kupferversion von 10 GBit/s die Technik für die Breite attraktiv machen. Da 10GBaseT erst Mitte 2006 standardisiert ist, soll 10GBaseCX4 solange die Kupfer-Lücke schließen.
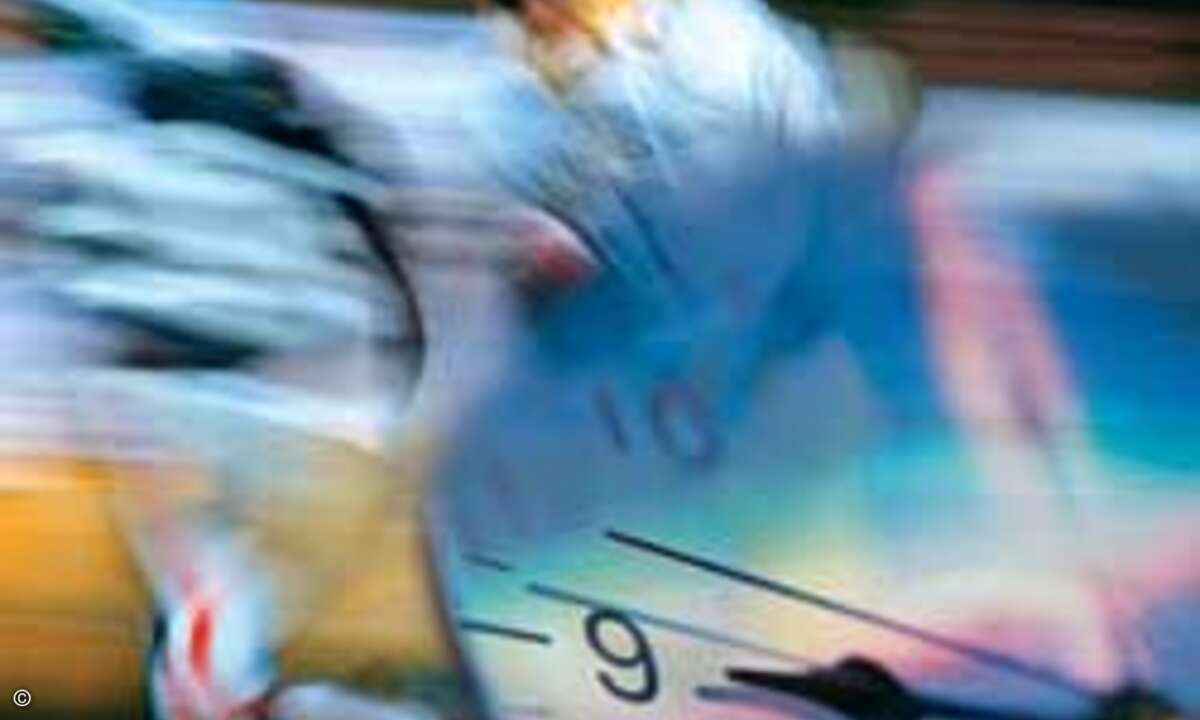
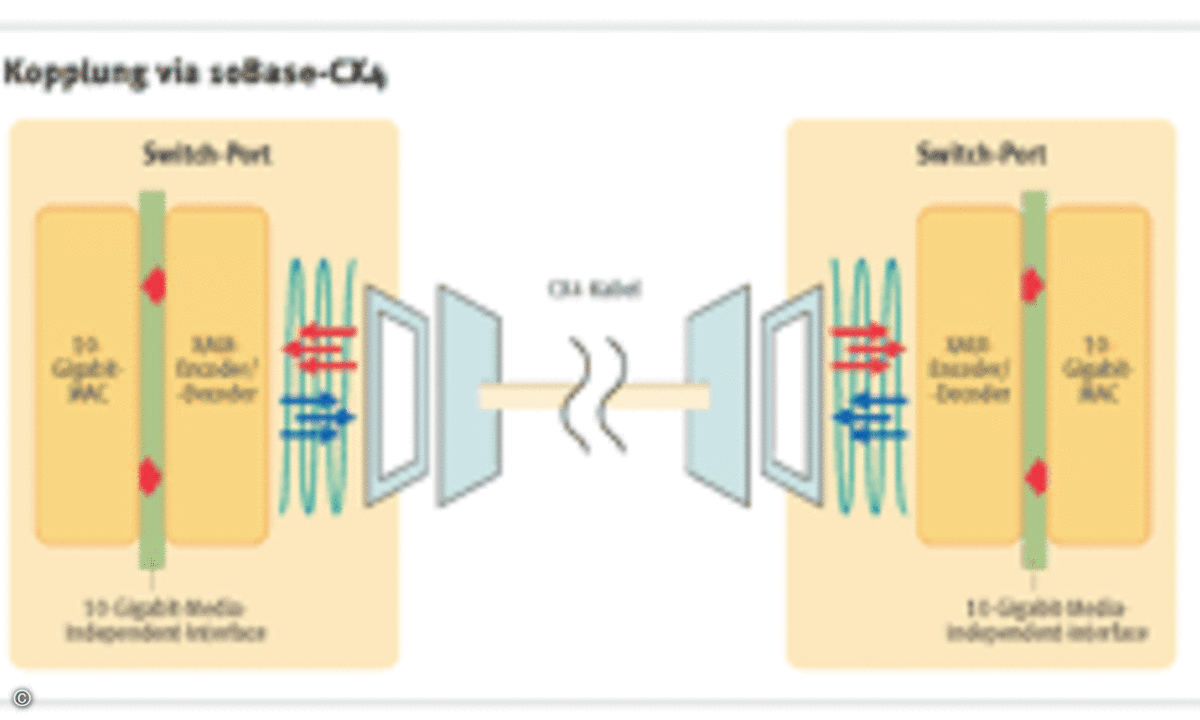
Technische Probleme machen der IEEE so sehr zu schaffen, dass sie die Längenrestriktion bei Class-E-Kabeln auf 55 Meter reduzieren musste.
Wie jeder Geschwindigkeitssprung des Ethernet, so ist auch 10 GBit/s zuerst für Glasfaserstrecken standardisiert worden. Wenig überraschend, ist es doch technisch gesehen um ein Vielfaches leichter, die Rahmenbedingungen für Ethernet auf Fiber abzustecken. Das Kupferkabel konfrontiert die IEEE-Ingenieure mit massiven physikalischen Phänomenen wie Crosstalk, Signalstreuungen und Emissionsbestimmungen. Diese Effekte haben schon bei der GBit/s-Ethernet-Entwicklung so viele Schwierigkeiten gemacht, dass die IEEE den Gigabit-Ethernet-Standard für Kupfer erst einmal ausklammerte und der gesonderten Task-Force IEEE 802.3ab zumutete. 1999 gegründet, haben die Spezialisten nahezu zwei Jahre investieren müssen, um die technischen Hürden zu nehmen. Am Ende stand ein 1000BaseT-Standard, der Cat-5-Kabel und höhere Kupfer-Kategorien unterstützt, und zwar über die aus den Vorgängerversionen bekannten und erwarteten 100 Meter.
Wie wichtig und nötig dieser Kupfer-Standard für die Bedeutung und die Chancen von 1 GBit/s war, belegt die Marktentwicklung. Jeder Hersteller und Analyst wird bestätigen, dass erst mit dieser Spezifikation der 1-GBit/s-Markt sein großes Gewicht erlangte. Heute kostet ein ungemanagter GBit/s-Switch mit acht Kupfer-Ports rund 100 Euro und ist tatsächlich schon für den Consumer-Markt attraktiv.
Verständlich also, dass die IEEE bei 10-GBit/s-Ethernet eine Kupferversion erarbeitet. Die Rahmenbedingungen sind einander in Kernpunkten zum Verwechseln ähnlich. Während die IEEE mit dem Dokument 802.3ae 10 GBit/s auf Glasfaser bereits im Jahr 2002 verabschiedete, ist ein echter 10GBaseT noch in weiter Ferne. Denn wieder hat die IEEE die Kupferschiene in eine separate Task-Force verlagern müssen. Aus ähnlichen technischen Gründen, wie es bei 1 GBit/s der Fall war. Diesmal trägt die Task-Force den Namen 802.3an. Vor Mitte 2006, andere sprechen von März, ist mit einem fertigen Standard nicht zu rechnen. Die Draft-Version soll immerhin schon Ende dieses Sommers veröffentlicht sein. Ende Februar zumindest hat die zuständige Task-Force getagt und weitere Details festgezurrt.
Info: Geschwindigkeitssog
Info: Längenrestriktionen für 10GBaseT, Twisted-Pair
Info: Längenrestriktionen für 10 GBit/s auf Glasfaser
Diese Zeitplanung war den Anbietern und dem großen IEEE-Standardgremium wohl zu großzügig. Kupfer sollte schneller verfügbar sein. Um die klaffende Lücke zu schließen, hat die IEEE im Jahr 2002 die Task-Force 802.3ak aufgestellt. Diese hat den Standard 10GBase-CX4 erarbeitet, eine auf Kupfer aufsetzende Niedrigpreis-Variante. Sie ist bereits verfügbar und soll 10 GBit/s auf Basis von Kupfer dorthin bringen, wo die Hersteller derzeit den größten Migrationsdruck vermuten: in einem Rack oder in nahe beieinander stehenden Racks des Datenzentrums, wo derzeit GBit/s-Switches, ob nun im Distribution- oder Backbone-Layer, mit mehreren getrunkten GBit/s-Ports gekoppelt sind. Kann und wird die CX4-Variante das ausgewachsene BaseT-Pendant zumindest zeitweise ersetzen können?
Der Lückenbüßer
Der 10GBase-CX4-Standard ist als kostengünstiges Switch-Interface konzipiert. Ein Port kostet derzeit bei fast allen Herstellern, ob sie nun 3Com, Cisco, D-Link, Extreme, Enterasys, Foundry, Hewlett-Packard oder Nortel heißen, mehr oder weniger um die 1000 Dollar. Das ist nur ein Fünftel dessen, was derzeit für den günstigsten Fiber-Port verlangt wird. Die Anbieter haben diese Module natürlich für ihre größeren Switches entwickelt. Wer demnach blockierungsfrei und ohne berüchtigtes Oversubscribing 10 GBit/s ausschöpfen möchte, muss bereits das richtige Modell im Netz haben oder ein entsprechend leistungsstärkeres kaufen.
Aber der günstige Preis hat einen Haken. Der Standard überbrückt eine Distanz von maximal rund 15 Metern, einige sprechen gar von 20 Metern. Für viele Einsatzfälle ist das aber zu wenig. Daher haben die Hersteller diese Portvariante konzeptionell eindeutig im so genannten Wiring-Closet vorgesehen, wo die Switches relativ nahe aneinander stehen. Hier soll der Standard, der im Februar vergangenen Jahres endgültig verabschiedet wurde, mit seinen Längenrestriktionen zurechtkommen.
Die Task-Force konnte den Standard innerhalb so kurzer Zeit verabschieden, weil sie auf bestehende Entwicklungen und Definitionen aus dem Infiniband-Sektor zurückgriff. So verwendet das Verfahren das »10-Gigabit-Attachment-Unit-Interface« (XAUI) des allgemeinen 10-GBit/s-Standards und bedient sich des 4X-Connectors, der in der Infiniband-Welt festgelegt ist.
Statt die gewaltigen Datenströme auf einem einzigen 10-GBit/s-Pfad über die Kupferader zu jagen, teilt der Standard die Daten auf vier Transmitter und Receiver auf. Sie sind jeweils über ein Bündel sehr dünner zweiadriger Kupferkabel (duale Twinax) miteinander verbunden. Jedes dieser Paare arbeitet mit einer Baud-Rate von 3,125 GHz pro Kanal und 8B10B-Coding. Physikalisch bedingt sind daher vier verschiedene Paare pro Richtung notwendig. Will jemand zwei Switches auf diese Weise koppeln, so ist ein Kabel mit acht Twinax-Kanälen erforderlich.
Die beteiligten Komponenten bedienen sich zweier Verfahren, um die Daten entsprechend aufzuarbeiten. Die Vorverzerrung (Pre-Emphasis) auf Sender- und die Entzerrung auf Receiver-Seite dienen beide im Prinzip dazu, das Originalsignal soweit zu verstärken, dass der Signalverlust über die hohe Frequenz kompensiert wird. Die Vorverzerrung verstärkt dazu den Hochfrequenzanteil eines übertragenen Signals oder dämpft Niedrigfrequenz-Inhalte. Der Receiver seinerseits arbeitet mit den gleichen Mechanismen, nur auf der Empfängerseite. Beiden Verfahren gelingt es am Ende, im Zusammenspiel die nötige dynamische Frequenzabtastung auf Empfängerseite zu reduzieren. Für die Hersteller der Chipsätze heißt das, dass diese Verfahren weitaus weniger feinfühlig arbeiten und weniger technische Kniffe beherrschen müssen und so leichter in Standard-Silizium zu gießen sind. Das Ganze wird deshalb in der Produktion auch um einiges billiger. Die Kabelanordnung ist ein wenig anders definiert als in dem ursprünglichen Infiniband. Die Task-Force hat sich dazu durchgerungen, die Anordnung viel präziser festzulegen, so dass einige Infiniband-Kabel die CX4-Spezifikation nicht erfüllen. Die Kabel müssen allerdings vom Hersteller fertig terminiert werden, so dass er vorher die Länge wissen muss. Mehr als 20 Meter gibt der Standard aber nicht her.
Interne und externe Störungen
Aus Sicht der Längenrestriktion ein klarer Vorteil für 10GBaseT, der nach dem bisher betriebenen Entwicklungsprinzip 100 Meter schaffen soll. Mit diesem Ziel ist die IEEE-802.3an-Arbeitsgruppe zumindest angetreten. Sie wollte einen BaseT-Standard entwickeln, der über Twisted-Pair funktioniert und folgende Ethernet-typische Kriterien einhält:
- 802.3-Frame-Format und MAC-Schnittstelle beibehalten,
- MAC-Interface für 10 GBit/s-Kapazitäten,
- Full-Duplex unterstützen,
- Betrieb über 4-paariges Twisted-Pair-Kupferkabel und die gängigen Distanzen,
- Emissionsanforderung nach »CISPR/FCC Class A« einhalten,
- Definition einer einzigen 10-GBit/s-PHY-Schnittstelle für die verschiedenen Kupferkabel.
Die IEEE hat bald feststellen müssen, dass die Interferenzen und physikalischen Störungen auf Kat-5e-Kabeln zu immens ausfallen. Wer also darauf hoffte, der IEEE gelinge der Zaubertrick, 10 GBit/s auf diesem Kabeltyp zu definieren, wird vorerst enttäuscht. Die Task-Group hat die Kat-5-Welt ausgeklammert und ihre Konzentration darauf gelenkt, den Standard auf Kat-7f- und Kat-6e-Kabeln zu definieren. Doch auch hier treten Probleme auf, die in internen und externen Störungen während des Datentransfers begründet sind. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem folgenden Phänomene: »Insertion-Loss« (IL), »Return-Loss« (RL), »Near-End-Crosstalk« (Next) und »Equal-Level-Far-End-Crosstalk« (Elfext).
Insertion-Loss oder Einfügungsdämpfung gibt einen Wert an, der den Signalverlust zwischen Sender und Empfänger widerspiegelt. Gewöhnlich ist er als Verhältnis zwischen Ausgangsleistung des Senders und Signalstärke beim Empfänger-Port angegeben. Der Return-Loss- oder Rückflussdämpfungs-Wert wiederum sagt aus, wie stark die beim Empfänger eingetroffenen Signale zum Sender reflektiert werden. Dieser Effekt wird auch Impendanz oder Scheinwiderstand genannt und ist frequenzabhängig. Er ist durch die Konstruktion des Kabels, beispielsweise seine Schirmung, mit bestimmt.
Der Next-Faktor wiederum bewertet, inwieweit Signale, die über Kupfer-Paare im gleichen Kanal verschickt werden, einander beeinflussen, koppeln und somit stören. Dieser Störfaktor ist bei BaseT von
besonderer Bedeutung, da hier mehrere Paare in einem Channel parallel arbeiten. Außerdem sieht Ethernet Full-Duplex-Betrieb vor, so dass die Transceiver auf beiden Seiten nonstop und simultan Signale generieren. Das Kabel wird also in beide Richtungen gleichzeitig genutzt, weshalb die Standardgruppe den Next-Faktor zu ergänzen hat.
Wenn einander mehrere Kupferadern im gleichen Kanal beeinflussen, nennt man das »Powersum Crosstalk«. Dieses Phänomen ist relativ leicht in einer mathematischen Gleichung umsetzbar und gibt folgendes Verhältnis an: Die gesamte Geräuschkopplung aller angrenzenden Paare gegenüber einem einzelnen Paar. Das Geräuschniveau, das den Empfang eines beliebigen Adernpaars stört, ist also direkt abhängig von der unerwünschten Geräuschentwicklung, die die benachbarten restlichen drei Adernpaare im Kabel zur gleichen Zeit produzieren. Alle diese Faktoren sind aus den vorherigen Standardbemühungen wohl bekannt und bereits in Modellen, entsprechenden Algorithmen und Komponenten abgebildet.
Unbekannter Faktor
Was der Task-Force richtig zu schaffen macht, sind die externen Faktoren bei 10GBaseT, insbesondere der »Alien Crosstalk«. Anders als die bisherigen Phänomene, die auch bei den Vorgängern gang und gäbe sind, tritt er bei der schnellsten Ethernetversion zum ersten Mal auf. Alien-Crosstalk gibt an, wie stark die Signale eines Adernpaares von einem oder mehreren benachbarter Kanälen beeinflusst werden. Dieser Faktor ist leider schwer in den Griff zu bekommen, da er sich statistisch gesehen extrem chaotisch und unregelmäßig verhält und sich daher nicht in Formeln und Regeln abbilden lässt. Dummerweise hat die 10GBaseT-Task-Force feststellen müssen, dass Alien-Talk der dominante Störfaktor bei dem schnellsten Ethernet ist. Im Gegensatz zu all den bisherigen internen Einflüssen lässt sich dieser nicht einmal mit fortschrittlichen Signalisierungsalgorithmen abfangen. Die Forschungsgruppe der IEEE befürchtet konkret, dass ihre theoretischen Längenziele dadurch massiv beeinträchtigt werden. In anderen Worten, mit dem Alien-Faktor stehen und fallen die 100 Meter Distanz bei 10GBaseT. Alien-Talk hat am Ende mit dazu beigetragen, dass die 802.3ak-Task-Force Kat-5e fallen ließ. Sie einigte sich auf einem ihrer Treffen, Class-E und Class-F zu definieren. Class-E lebt eine Kabelcharakteristik über eine maximale Bandbreite von 250 MHz, das Class-F-Kabel von 600 MHz. Die Spezialisten von Röwaplan haben ab der Seite 50 simuliert, inwieweit bestehende, gängige Class-E-Kabel die bisher bekannten Rahmenbedingungen von 10 GBit/s verkraften. Ihr Ergebnis fällt durchaus positiv aus.
Noch offene Fragen
Die Standardspezialisten haben einander Ende Februar getroffen, um die letzten Erweiterungen am Draft-Entwurf 1.4 vorzunehmen. Zu den wichtigsten Aufgaben des Treffens gehörte, weiter den »Physical Layer« auszuformulieren. Auf Grund der schwer zu handhabenden externen Einflüsse hat die Task-Force bei Kat-6e schon mal vermerkt, dass im Gegensatz zu Kat-7 und ihren 100 Metern mehr als 55 Meter nicht zu schaffen seien.
Die PHY wird in diesem IEEE-Schema wie üblich die Schnittstelle zwischen dem 10-Gigabit-Media-Access-Control (10G-MAC) und dem Gigabit-Media-Independent-Interface (XGMII) bilden. Die PHY enthält alle Funktionen, die den Transfer und Empfang kodierter Signale abwickeln, die aus dem Kabel herauskommen.
Die PHY basiert auf der »Pulse Amplitude Modulation« (PAM). Diese Modulationsart tastet ein kontinuierliches Signal mit Impulsen ab, deren Amplitude gemäß der primären Zeichenschwingung verändert wird. Jeder dieser Pulse hat eine separate Amplitude, wobei der Empfänger die Pulse wieder in analoge Daten zurückwandelt. Die gleiche Modulation wird übrigens auch bei 100BaseT und 1000BaseT verwendet, mit dem Unterschied, dass bei 10GBaseT die digitalen Signaturprozess-Techniken verbessert werden müssen.
Die Frage für die Task-Force ist, welches PAM-Encoding sie verwenden soll. Sie hat die Wahl zwischen zwei vorgeschlagenen Ansätzen: PAM12 und PAM8. Das erste Verfahren arbeitet mit 825M-Symbolen pro Sekunde und nutzt zu seinem Vorteil eine viel niedrigere Baud-Rate als PAM8 mit seinen 1000M-Symbolen pro Sekunde. Erste Analysen lassen darauf schließen, dass PAM8 20 Prozent mehr Nebengeräusche verkraften kann als PAM12. Weil PAM8 das zu sampelnde Signal in nur acht verschiedene Spannungsstufen überträgt, ist der Unterschied zwischen den einzelnen Stufen einfach größer als bei PAM12. Das würde rein technisch bedeuten, dass man die Spannungsstufe jedes umgewandelten Signals leichter feststellen könnte.
Zeitdruck
Alle diese Fragen möchte die Standardisierungsgruppe in den kommenden Monaten abschließend klären. Ein ehrgeiziger Zeitplan treibt die 802.3an zur Eile. Bereits in diesem März sollen die letzten neuen Funktionen in den Draft aufgenommen werden. Bei einem weiteren Meeting, das für November dieses Jahres anberaumt ist, sollen dann die letzten technischen Veränderungen an dem Draft vorgenommen werden. Kommt nichts mehr dazwischen, so darf die Netzwerkwelt den fertigen 10GBaseT-Standard für Juli 2006 erwarten.
Interessant wird sein, wann die Anbieter mit ersten 10GBaseT-Produkten auf den Markt kommen. Die Erfahrung mit 1 GBit/s besagt, dass kurz nach dem finalen Draft die ersten Module mindestens angekündigt, zum Teil aber schon verkauft werden. Denn zwischen letztem Draft-Entwurf und dem ratifizierten Standard sind technisch kaum noch gravierende Unterschiede sichtbar. Sollten sich noch Änderungen ergeben, so sind diese größtenteils im Software-Bereich angelegt. Sie lassen sich daher über ein einfaches Firmware-Upgrade aufspielen. Dies ist beispielsweise bei der Entwicklung von 1 GBit/s geschehen. Wer so lange nicht warten möchte, kann auf den Lückenbüßer 10GBase-CX4 ausweichen – mit der Einschränkung, dass dieses Verfahren maximal 15 bis 20 Meter überbrückt. Welche Rolle CX4 auf Dauer spielt, wird auch der Pro-Port-Preis für 10GBaseT bestimmen. Bislang erwarten Analysten, dass auf Grund der vielen Störfaktoren und des bislang unkontrollierten Alien-Talk teure, komplizierte Transceiver nötig werden. Dies treibt den Pro-Port-Preis in die Höhe. Wenn die Längenrestriktion von CX4 längerfristig reicht, warum also nicht diesen Port wählen anstelle eines BaseT-Anschlusses, dessen Verfügbarkeit und Preis noch nicht absehbar sind? [ pm ]