Zu viele Stolpersteine
Voice-over-IP wird von den Herstellern als gleichermaßen kostensparende wie standardisierte IP-Technologie gepriesen. Einige unter ihnen versuchen es noch immer. Doch diese Argumente sind nicht stichhaltig.
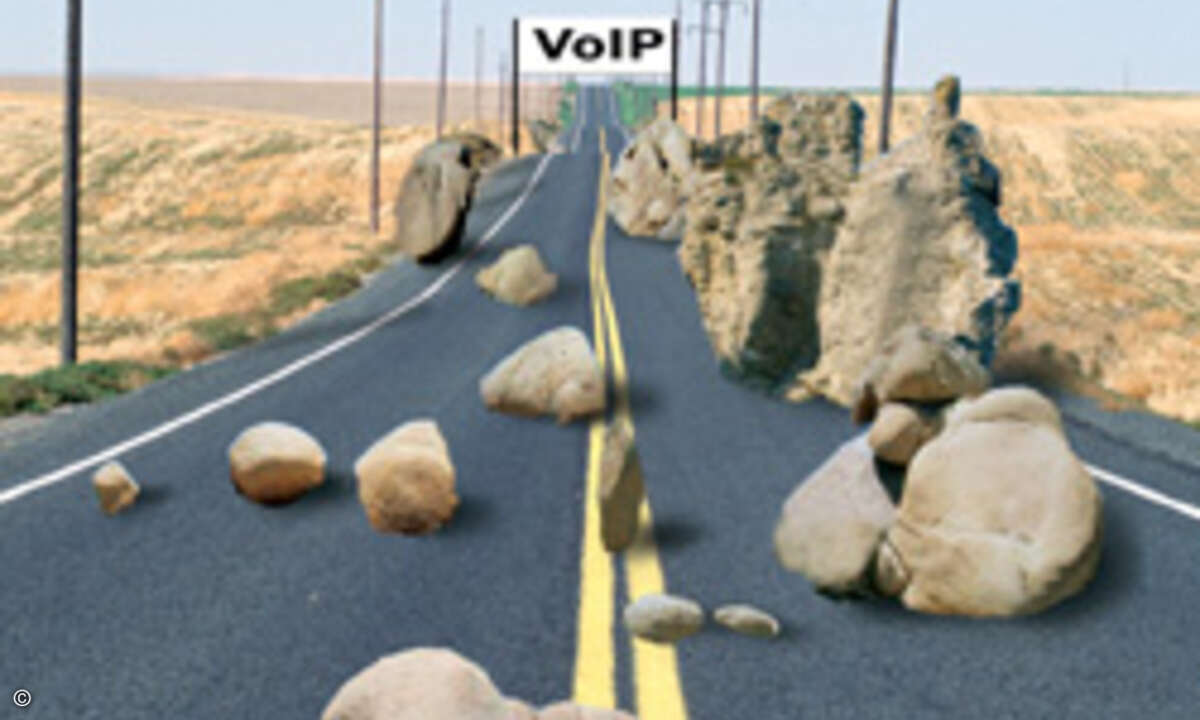
VoIP-Architekturen einschließlich IP-Telefone sind weiterhin zu komplex, zu teuer und zu proprietär. Der Migrationsweg dorthin ist noch lang.
Bereits in der Welt der reinen IP-Telefonie lauern Kosten, welche die Modellkalkulationen der Hersteller schnell zu Milchmädchenrechnungen verkommen lassen. Denn es bedarf einer hinreichenden Redundanz an Netzwerkkomponenten und Verbindungen, um sich über das verbindungslos arbeitende IP der von Haus aus hohen Verfügbarkeit der leitungsvermittelnden ISDN-Telefonie zumindest anzunähern. Das geht von gespiegelten Switch- und Router-Systemen sowohl im Backbone- als auch im Access-Bereich bis hin zur zentralen Stromversorgung für die IP-Telefone nach Standard 802.3af.
Hinzu kommt die doppelte Auslegung von Media-Gateways, Gatekeeper und Media-Server. Mit Blick auf die Verfügbarkeit von Basiskommunikation und Sprach/Daten-integrierten Anwendungen ist auch auf diesen Feldern mit einer zwangsläufigen Redundanz zu rechnen. Das gilt für CTI (Computer-Telephony-Integration)- und Instant-Messaging-Server ebenso wie für die Server, auf denen beispielsweise Communication-Center, CRM (Customer-Relationship-Management) und andere Sprach/Daten-fähige Applikationen laufen sollen.
Anders als auf Netzwerkebene ist für Gateways und Server die Hochverfügbarkeit zudem schwieriger umzusetzen. In diesem Fall sind komplexe Zusatztechnologien gefordert wie Failover/Fallback, permanente Datensynchronisation zwischen den Platten und, um zwischenzeitliche Performance-Einbußen auszuschließen, eine dynamische Lastverteilung (Load-Balancing) im laufenden Betrieb.
Derart komplexe Hochverfügbarkeits-Überlegungen ziehen nicht nur beträchtliche zusätzliche Produkt- und später Wartungskosten nach sich. Mit ihnen schießen auch die Aufwendungen für Planung und Realisierung in die Höhe. So müssen Protokolle wie OSPF (Open-Shortest-Path-First), STP (Spanning-Tree-Protocol), RSTP (Rapid-Spanning-Tree-Protocol), VRRP (Virtual-Router-Redundancy-Protocol) oder IEEE 802.1w (Rapid-Reconfiguration-of-Spanning-Tree) aufwändig auf die Nutzung des redundanten Netzdesigns ausgelegt werden.
Nicht zu vergessen im komplexen Szenario alternativer Streckenführungen die QoS (Quality-of-Service)-Ansprüche der Kommunikationsströme. Die doppelte Auslegung von Gateways und Servern macht beispielsweise Clustering erforderlich, das sich über alle drei Funktionen – Failover/Fallback, Datensynchronisation und Load-Balancing – als aufwändig in Planung und Umsetzung erweist. Zumal Server-Clustering immer plattformabhängig, also für jedes eingesetzte Server-Betriebssystem separat konzipiert und realisiert werden muss. Ebenso separat müssen später die einzelnen Server-Cluster administriert werden. Dazu kommen die komplexen Testszenarien, um die gesamte Hochverfügbarkeitskonstellation auf Tragfähigkeit in der Praxis zu überprüfen. Dabei ist im skizzierten Hochverfügbarkeits-Szenario ein Notfallkonzept mit Backup und schnellem Disaster-Recovery für Daten und Applikationen über ein Ausweich-Rechenzentrum nicht einmal berücksichtigt.
Obendrein muss auch das Netzwerk- und Systemmanagementsystem die jeweilige Redundanz erkennen, um sie professionell überwachen und steuern zu können. So sind bis heute nur wenige IT-Managementsysteme in der Lage, auf Server-Ebene zwischen Normal- und Ausweichbetrieb zu unterscheiden. In diesen Fällen hilft nur teure Individualprogrammierung weiter.
Komplexes Management und seine Auswirkungen
Derart durchgehend redundant ausgelegt, um Sprache und künftig der Videoübertragung im IP-Netz und auf Anwendungsebene annähernd die gleiche Verfügbarkeit wie der separaten ISDN-Telefonie zu verleihen, bleiben im Rahmen des Netzwerk- und Systemmanagements bis hin zur Netzwerkanalyse die Folgen nicht aus. Denn mit jedem Schritt tiefer in die Systemredundanz wachsen die Systemkomplexität und parallel dazu das Fehlerrisiko im Netz. Ein auf Regeln basierendes Netzwerkmanagement – erweitert um ein professionelles Systemmanagement – wird dadurch für die meisten Unternehmen zur Pflicht, ebenso wie leistungsfähige Netzwerkanalysatoren.
Alle diese Werkzeuge setzen wiederum teure Spezialisten zu ihrer Handhabung voraus. Zusätzlich gesteigert werden die Komplexität und dadurch der Überwachungs- und Steuerungsbedarf durch den Einsatz von QoS-Verfahren zur Priorisierung, Bandbreitenreservierung, zum Warteschlangenmanagement und der Verkehrseingrenzung durch VLANs, angesiedelt zwischen Ebene 2, beispielsweise IEEE 802.1p/q, und Ebene 6/7, beispielsweise RTCP- (Realtime-Control-Protocol) Monitoring.
Layer-4-Switching, TOS (Type-of-Service) mit IP-Precedence oder DSCP (DiffServ-Code-Points) sowie RSVP (Resource-Reservation-Protocol) sind weitere standardisierte QoS-Mechanismen, um der Sprach- und später der Videoübertragung via IP Beine zu machen. Solche Mechanismen sind notwendig, um das Manko des verbindungslos arbeitenden IP gegenüber dem leitungsvermittelnden ISDN einigermaßen wettzumachen. Um diese Lücke ganz zu schließen, warten einige Hersteller wie Cisco mit Dutzenden weiterer QoS-Funktionen auf, durchweg proprietär und damit herstellerbindend. Jeder QoS-Mechanismus, der zusätzlich zum Einsatz kommt, verkompliziert die Konfiguration, Überwachung und Steuerung weiter und steigert parallel die Fehleranfälligkeit im Netz.
Darüber können auch Netzwerk-Managementsysteme kaum hinwegtäuschen, die solche QoS-Regeln mit verändertem Verkehrsverhalten dynamisch zuweisen. Diese Dynamik macht weder Administratoren mit Spezialistenwissen überflüssig, noch reduziert sie die Komplexität und Fehleranfälligkeit im Unternehmensnetz. So wird mit diesem Automatismus das reduzierte Risiko von Fehlerzuständen durch Fehlkonfigurationen schnell durch jene Probleme, die aus der komplizierten dynamischen Konfiguration heraus entstehen, wieder aufgewogen. Zudem verstellen solche Automatismen den Administratoren und Operatoren den Blick für die realen Vorgänge im Netz und verhindern so adäquate Eingriffe im Fehlerfall.
Bleibt, dass mit jeder weiteren Feinabstimmung des Netzwerk-Managementsystems auf die Netzwerkkomponenten und die darüber abgewickelten QoS-Verfahren dieses Herstellers zwangsläufig die Produktabhängigkeit von diesem Anbieter wächst.
Netzwerkmanagement im freien Preisfall
Immerhin hat das Gros der Hersteller angesichts dieser Ausgangssituation für die Kunden mittlerweile erkannt, dass mit Policy-Managementsystemen & Co. kein Geschäft mehr zu machen ist. Cisco veranschlagt den Kostenanteil für den eigenen QPM (Quality-Policy-Manager) gemessen an den Investitionen für die IP-Telefonie-Lösung bei einer Installationsgröße von 1000 IP-Telefonen auf lediglich 2,6 Prozent, die neuen Netzwerkkomponenten – Gateways und Server ebenso wie ihre redundante Auslegung nicht eingerechnet. Für die IP-Telefonie-Lösung dieser Größenordnung fallen bei Cisco Systems laut Liste 565000 US-Dollar an.
Enterasys hat im Rahmen seines Policy-Managements die Funktionalität des User-Personalized-Network ohne Aufpreis in seinen Switch-Systemen integriert. Die Zusatzinvestition für den ergänzenden Policy-Manager stuft man auch hier als verschwindend gering ein. Diese mittlerweile verhaltene Preispolitik der Hersteller für die Werkzeuge des Netzwerkmanagements ist auch ein Indiz dafür, dass es um die Akzeptanz, das Kosten-Nutzen-Verhältnis, die Komplexität und Interoperabilität ihrer VoIP-Lösungen bis heute nicht zum Besten bestellt ist.
Mangelnde Interoperabilität paart sich mit zu hohen Investitionskosten. Das wird auch anhand der IP-Telefon-Offerten deutlich. Für ein Endgerät muss das Unternehmen heute, je nach Hersteller, zwischen 250 und 550 Euro auf den Tisch legen, für ein PC-installiertes IP-Softphone immerhin noch die Hälfte. Das ist deutlich mehr, als ein ISDN-Telefon kostet.
IP-Telefon-Auswahl mit Folgen
Auch mit der von den Herstellern viel beschworenen Standardardtreue im IP-Umfeld ist es in puncto IP-Telefone nicht weit her. Ganz im Gegenteil: Funktioniert jedes klassische Telefon, unabhängig davon, von welchem Hersteller es stammt, an jedem ISDN-Anschluss, heißt es bei den Produzentenim VoIP-Bereich: aufgepasst.
Bei 3Com gibt man generell zu, dass kein IP-Telefon mit dem eines Konkurrenten interoperiere, weil jeder dieser Hersteller das H.323-Protokoll unterschiedlich, also proprietär, implementiere. Diese Ausgangssituation werde sich erst mit dem Einsatz von SIP (Session-Initiation-Protocol) allmählich ändern.
Obendrein entwickeln die Hersteller für eine komfortable IP-Telefonie ihre speziellen Leistungsmerkmale und versuchen so, ihre Kunden enger an sich zu binden. Sie legen also genau das Verhalten an den Tag, das sie den Herstellern von TK-Anlagen seit langem vorwerfen. Noch schlimmer: Viele nutzen für ein Migrationsszenario aus klassischer und IP-Telefonie nicht einmal die begrenzten Signalisierungsmöglichkeiten der Standardschnittstelle QSIG (Quer-Signalisierung), um darauf aufsetzend ihre Leistungsmerkmale für die Welt der IP-Telefonie abzustimmen.
Dieses proprietäre Herstellergebaren auch bei den IP-Telefonen steigert zusätzlich die Komplexität innerhalb der VoIP-Installation, zumindest dann, wenn das Unternehmen trotz allem IP-Telefone anderer Hersteller einsetzen will. Dann ist Zusatzsoftware wie bei Enterasys CEP (Convergence-Endpoint-Detection) erforderlich, die automatisch die anderen IP-Telefone erkennt und zwischen den unterschiedlichen Images vermittelt. Direkte Wettbewerber bleiben bei dieser Vermittlung natürlich ausgeschlossen.
Avaya dagegen fordert andere, ausgesuchte Hersteller dazu auf, innerhalb ihres Developer-Connect-Programms ihre Geräte mit den IP-Telefonen von Avaya auf Interoperabilität zu testen. Als einzige, die bisher diesen Test absolviert haben, werden Spectralink und Polyspan genannt. Innovaphone, ohne eigene IP-Telefone, verweist auf Endgeräte von Spectralink, Snom, Siemens und Swiss Voice. Cisco wiederum macht kein Hehl daraus, dass die IP-Telefonie nur mit IP-Telefonen aus dem eigenen Haus funktioniere. Was den Unternehmen, die von der Endgerätedespotie der Hersteller befreien wollen, heute bestenfalls bleibt, ist also eine begrenzte Auswahlmöglichkeit.
Resümee
Aktuelle VoIP-Architekturen einschließlich der IP-Telefone sind weiterhin zu komplex, zu teuer und zu proprietär. Damit sind sie, mit allen notwendigen Maßnahmen umgesetzt, nur in wenigen Fällen für die Unternehmen eine lohnende Angelegenheit, die sich für sie unter dem Strich in einem vertretbaren Return-on-Investment (ROI) auszahlt. Zumal in der Regel zwischenzeitlich im Sinne einer Migration beide Welten, die klassische und IP-Telefonie, separat betrieben werden müssten. Das würde in der Übergangsphase zusätzlich die Komplexität im Unternehmensnetz steigern und parallel die Kosten weiter in die Höhe treiben. Ein ROI der angestrebten VoIP-Lösung rückt so in weite Ferne.
VoIP wird dennoch auf lange Sicht für Unternehmen aller Größenordnungen zu einem Muss werden. Denn Sprach/Daten-integrierte Anwendungen, gefolgt von einer (synchronisierten) Videointegration werden innerhalb ihres Geschäfts eine immer wichtigere Rolle spielen. Dass die Zeit für diesen notwendigen Wechsel in den Unternehmen schon reif ist, ist jedoch fraglich. Zumal der Start für die Sprach/Daten-Integration via IP, so Marktkenner, weniger vom Enterprise-Bereich ausgehen wird.
Den Startschuss werden vielmehr die Service-Provider geben, mit einer öffentlichen IP-Telefonie zum kleinen Preis auf Basis von SIP. In diesem Bereich steckt das eigentliche Wirtschaftlichkeitspotenzial von VoIP. Hadi Stiel












