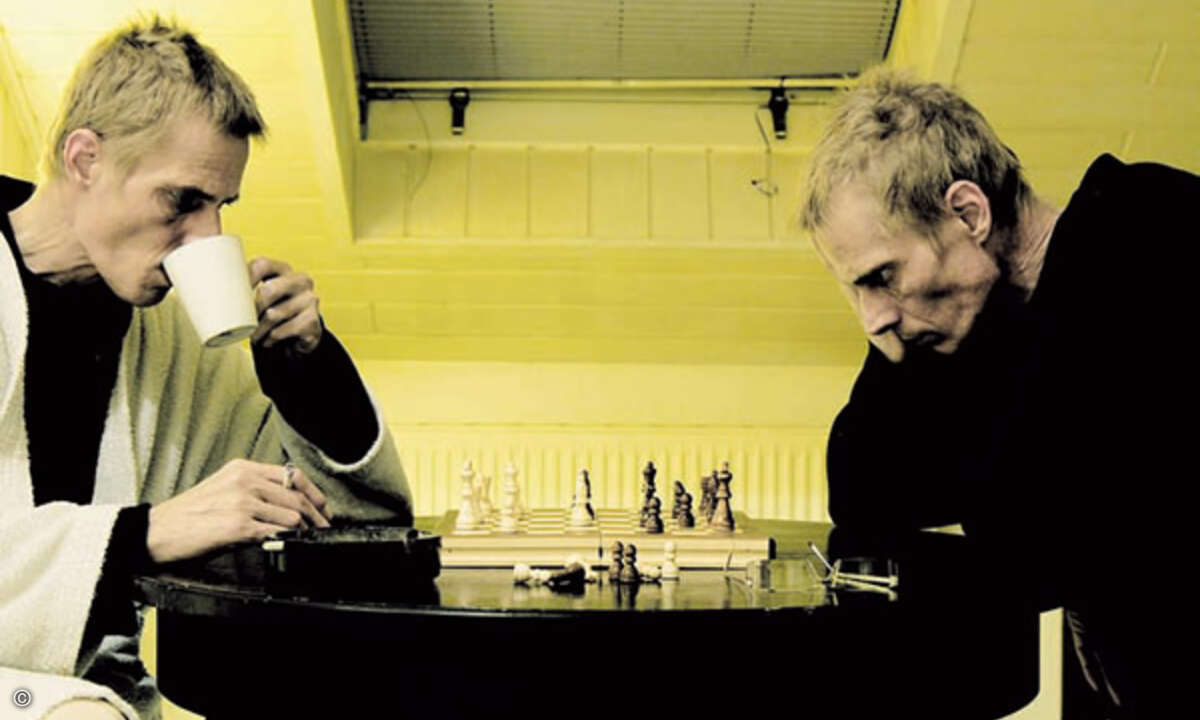Zwischen Industrialisierung und Innovation
Zwischen Industrialisierung und Innovation. Auch bei IT-Services ist der Trend zur Modularisierung und Standardisierung unverkennbar. Doch nicht überall, wo Standards prinzipiell möglich wären, machen sie auch Sinn.
Zwischen Industrialisierung und Innovation
Standardisierung, Modularität, Vereinfachung ? das sind die Schlagworte, die sich in den letzten Jahren durchgesetzt haben, wenn es um die Optimierung von IT-Infrastrukturen geht. Viele Unternehmen setzen in ihren Rechenzentren mittlerweile konsequent auf Industrie-Standards und haben dadurch Kosten reduziert und Flexibilität gewonnen. Doch wie sieht es mit IT-Dienstleistungen und den korrelierenden Geschäftsprozessen aus? Gerade bei IT-Services lässt sich durch Standards aufgrund von Skalen Effekten viel Geld sparen. Der Kostensenkungs-Effekt kann abhängig vom IT-Service und der Größe des Unternehmens bis zu 30 Prozent ausmachen.
Viele Unternehmen trauen sich jedoch noch nicht im gleichen Maße an einheitliche IT-Services heran wie an eine einheitliche IT-Infrastruktur. Schließlich beeinflussen die IT-Dienstleistungen direkt die Geschäftsprozesse und damit den einzelnen Anwender. Deshalb ist es entscheidend, bei größeren Standardisierungsvorhaben die Anwender rechtzeitig einzubinden. Die Industrialisierung von IT-Services kann für Unternehmen in Zukunft einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil bedeuten.
ITIL ? IT-Services im Dienste ihrer Majestät
Vorreiter in Sachen Standardisierung von IT-Dienstleistungen war Anfang der 90er Jahre die britische Regierung: Die Verantwortlichen wollten einen Teil ihrer IT auslagern und standen auf einmal vor der Frage: Welche IT-Dienstleistungen nutzen wir überhaupt? So entstand mit der Dokumentation der IT-Services für die britische Regierung mit IT Infrastructure Library (ITIL) das erste Rahmenwerk für IT-Dienstleistungen. Es sorgt dafür, dass die IT die Geschäftsprozesse in den einzelnen Unternehmensbereichen optimal unterstützen kann. ITIL ist mit seinen Prozess-Modellen ? beispielsweise für Service Support und Service Delivery ? eine hervorragende Grundlage für die Implementierung von standardisierten IT-Dienstleistungen.
Neuere Rahmenwerke bauen auf ITIL auf und gehen noch einen Schritt weiter. Dazu gehören beispielsweise das Microsoft Operations Framework (MOF) oder das HP IT-Service Management-Referenzmodell (HP ITSM).
Kein IT-Service ohne Service Level
Inzwischen sind solche Standardwerke die entscheidende Basis für jedes Standardisierungsvorhaben. Bestimmte Kernelemente der Standardwerke müssen implementiert sein, damit sich IT-Dienstleistungen wirkungsvoll standardisieren lassen: Service Level Management, Configuration Management, Change Management sowie Incident und Problem Management sind unabdingbar. Werden beispielsweise neue Standard-Images auf die Desktops eines Unternehmens gespielt, sorgen Change Management und Configuration-Prozesse dafür, dass das Zusammenspiel mit anderen IT-Services optimal funktioniert. Denn alle Desktop-Standards enthalten in der Regel auch Rechenzentrums Komponenten, die die IT-Administration im Rahmen des Change Managements berücksichtigen muss. Incident Management hat dagegen die Aufgabe, den Anwender vor Ausfällen und Störungen zu bewahren, die sich unter anderem auf grund von Changes ergeben können.
Wichtigster Aspekt ist allerdings das Service Level Management (SLAs). Denn in den Service Level Agreements werden letztendlich die Service Parameter beschrieben, die den neuen Standard ausmachen. Welche Applikationen braucht der Anwender auf seinem Desktop? In welcher Zeit ist die Störung zu beheben, damit der Anwender seinen Desktop wieder in gewohnter Weise nutzen kann? Was geschieht im Eskalationsfall? Diese Fragen müssen in den SLAs eindeutig geklärt sein. Das gilt auch für korrelierende IT-Services, die aus dem Rechenzentrum geliefert werden, zum Beispiel die Softwareverteilung. Mit Standards Komplexität abbauen
Wann und wo kann jetzt das Unternehmen von standardisierten Services profitieren? Grundsätzlich bewegen sich die IT-Abteilungen ständig im Spannungsfeld zwischen der von Anwendern geforderten Komplexität und Standards. Will eine interne IT-Abteilung, oder auch der externe Dienstleister, den Fachabteilungen jeden Wunsch erfüllen, schlägt dies mit größerer Komplexität und höheren Kosten zu Buche. Ein Unternehmen muss sich deshalb im Klaren darüber sein, welche Services es tatsächlich benötigt ? und zwar unabhängig davon, ob die IT-Services intern oder vom IT-Dienstleister erbracht werden.
Eine weitere Voraussetzung für den Erfolg von Standards ist ein hoher Zentralisierungsgrad der Unternehmens-IT. Denn selbst wenn ein Unternehmen beispielsweise im Applikationsumfeld auf Standard-Software setzt, heißt das nicht, dass in allen Landesgesellschaften, Unternehmensbereichen oder Abteilungen dieselben IT-Services erbracht werden. Möchte das Unternehmen jetzt seine Applikationen auf SAP standardisieren, gilt es zunächst die verschiedenen IT-Ebenen (Layer) zu betrachten, die diesen Prozess unterstützen. Auf dem Applikations-Level ist eine Standardisierung vielleicht nur bedingt möglich, weil Spezifika in den einzelnen Geschäftsprozessen eine wichtige Rolle spielen und das Know-how des »Kunden« nicht verzichtbar ist. Bei der Standardisierung der Datenbank ? eine Ebene darunter ? gilt das allerdings nur noch in Einzelfällen. Backup- sowie Monitoring-Dienste lassen sich dann in der Regel immer zentralisieren und damit standardisieren. Denn unabhängig davon, welche Applikationen und Geschäftsprozesse hier aufsetzen ? der darunter liegende Service ist immer derselbe. Generell gilt: Umso besser sich eine IT-Dienstleistung in eine Black-Box verpacken lässt, desto eher kann man sie auch standardisieren. Weil das auf Rechenzentrums-nahe Dienstleistungen wie SAP Services bis hin zur Applikations Ebene meistens zutrifft, liegt hier auch das größte Potenzial, um durch Standards Kosten zu senken. Keine Standardisierung ohne Governance
Der Anwender setzt sich an seinen Desktop und muss sich mit neuen Applikationen vertraut machen. Viele Anwender sind von den Standardisierungsbemühungen der IT-Verantwortlichen zunächst nicht besonders begeistert. Deshalb sollten die Verantwortlichen die von Veränderungen betroffenen Mitarbeiter der IT- und Fachabteilungen rechtzeitig in den Change-Prozess einbeziehen: Der Governance kommt bei Standardisierungsprojekten eine besondere Bedeutung zu. Vergibt das Unternehmen beispielsweise Desktop Services an einen externen Dienstleister, muss es der Definition von Schnittstellen besondere Aufmerksamkeit widmen. Aufgabe des Dienstleisters oder der internen IT-Abteilung ist es, dem Kunden zu vermitteln, welche Standards warum sinnvoll sind. Schließlich sollte sich der Kunde erst damit anfreunden, dass die IT-Dienstleistungen aus einer Black-Box kommen, bei der er die darunter liegenden technischen Ebenen nicht mehr betrachtet. Besonders wichtig bei der Standardisierung von IT-Diensten: Abteilungsleiter und Key User sollten frühzeitig in den Änderungsprozess eingebunden werden.
Standardisierung von IT-Services ? ein Allheilmittel?
Die Industrialisierung von IT-Dienstleistungen stößt auch bei optimal modellierten Prozessen mitunter an ihre Grenzen. Führt ein Unternehmen beispielsweise eine innovative IT-Lösung ein, ist es eine gemeinsame Herausforderung für den Auftraggeber und den IT-Service Provider Service Parameter und Service Level festzuschreiben. Der Grund hierfür: Es gibt noch keine Erfahrungswerte und an der Lösung wird eventuell doch noch einiges geändert. Denn hier können sich die Geschäftsprozesse schnell wieder ändern. Im Desktop-Umfeld dagegen haben die Dienstleistungen schon eine gewisse Reife erreicht und damit ist eine Standardisierung immer sinnvoll. Der Treiber für Standardisierung sollte also immer der Geschäftsprozess selbst sein. Hartmut Schultze, Client Manager HP Services