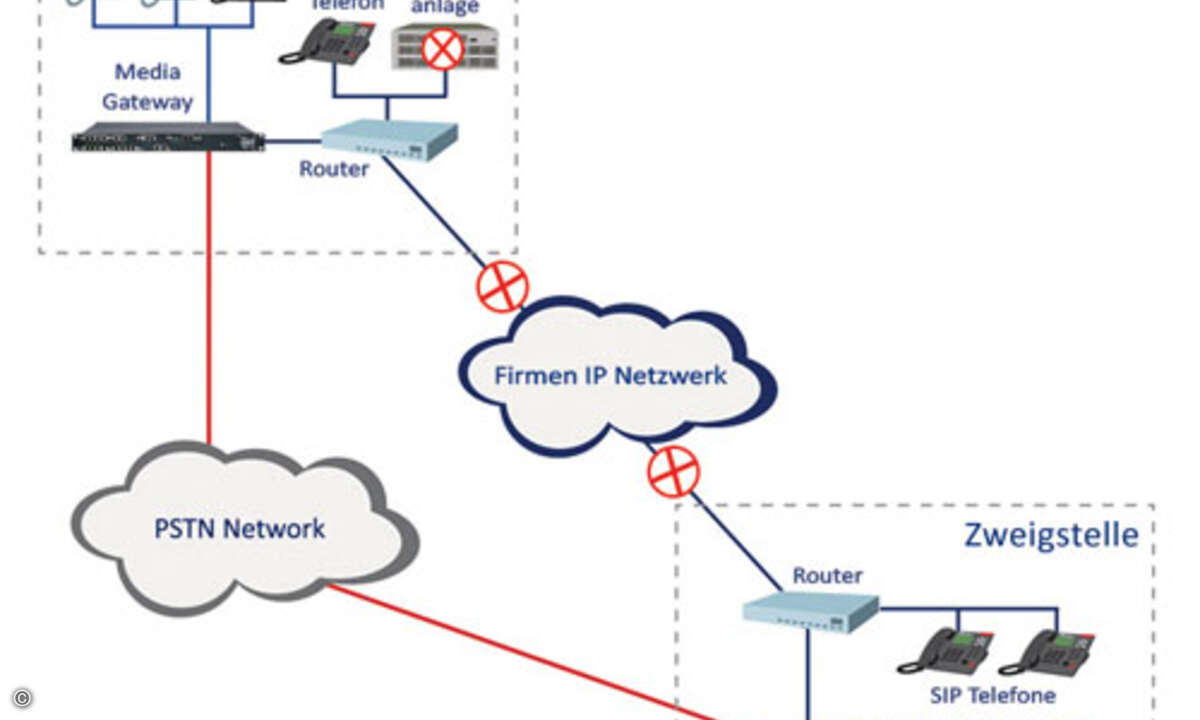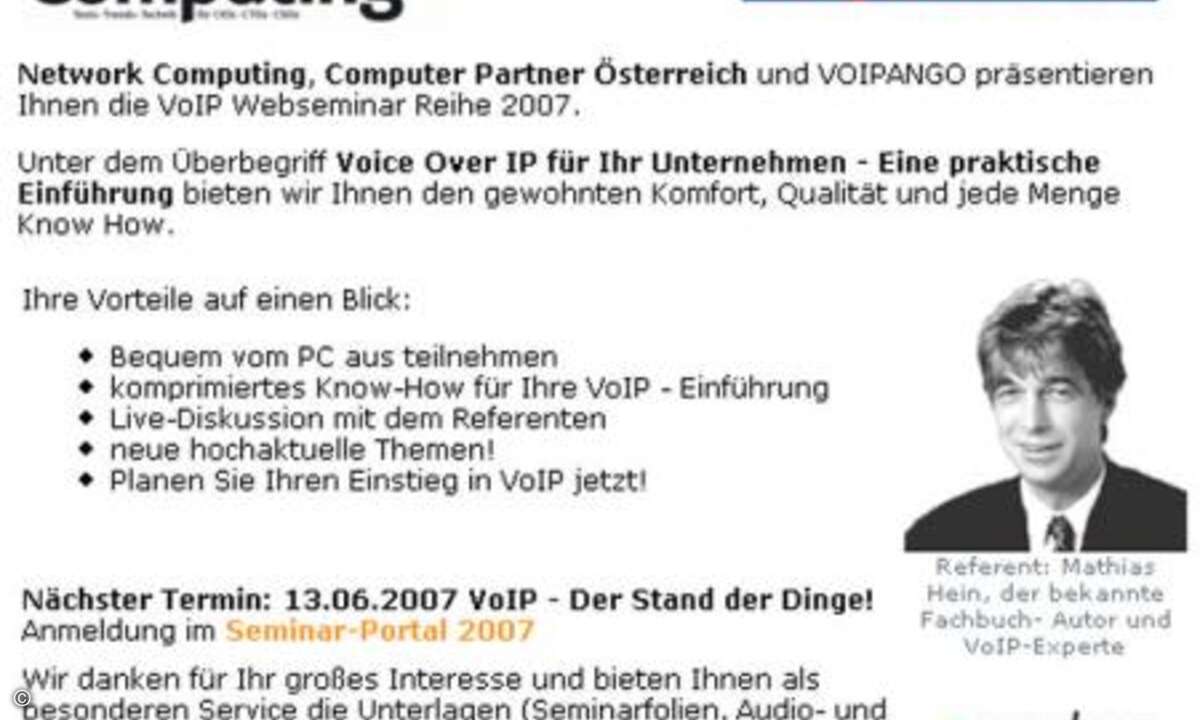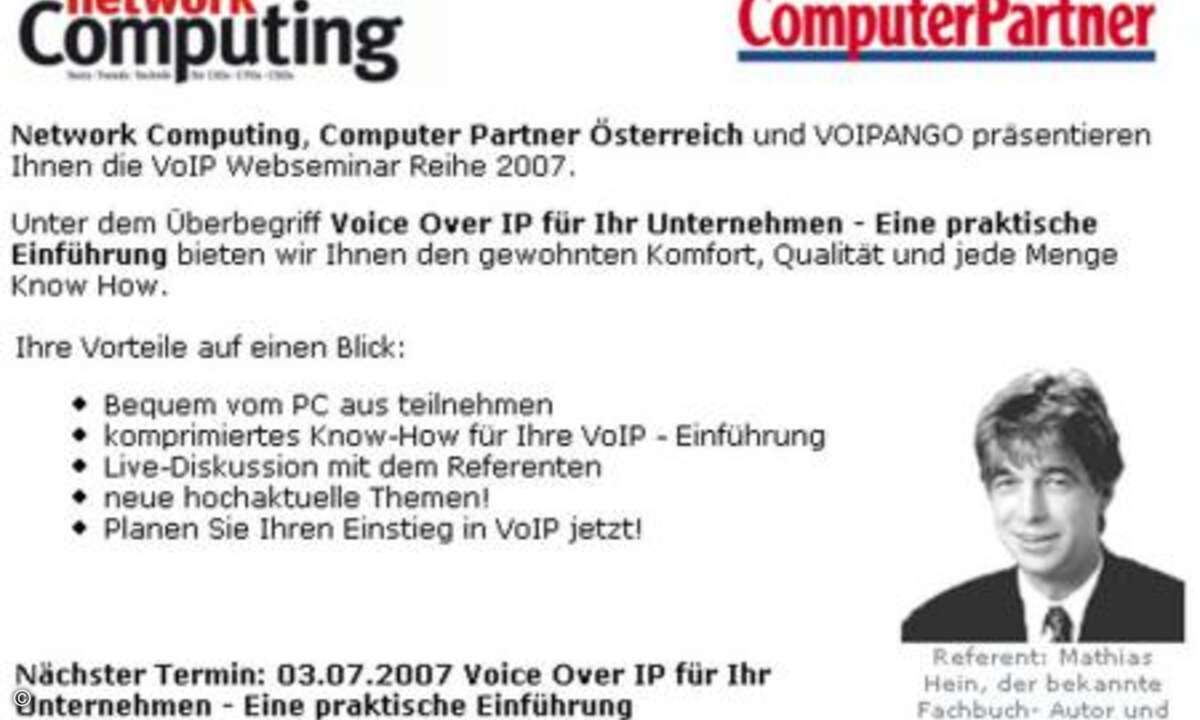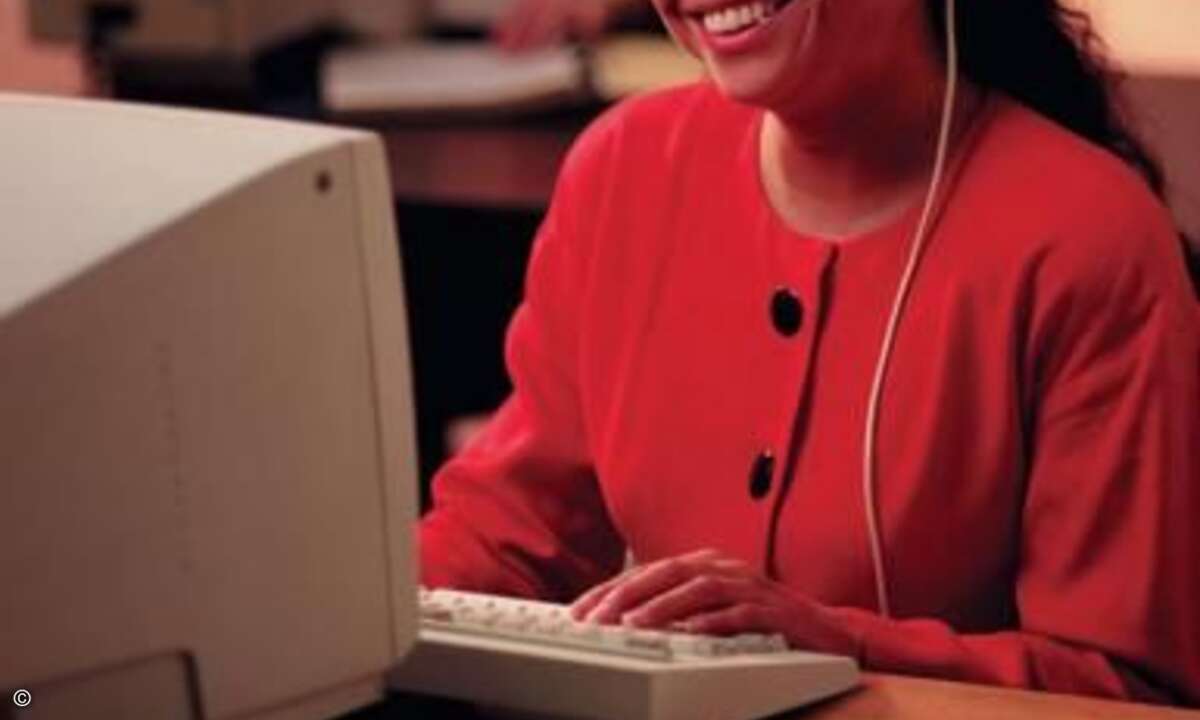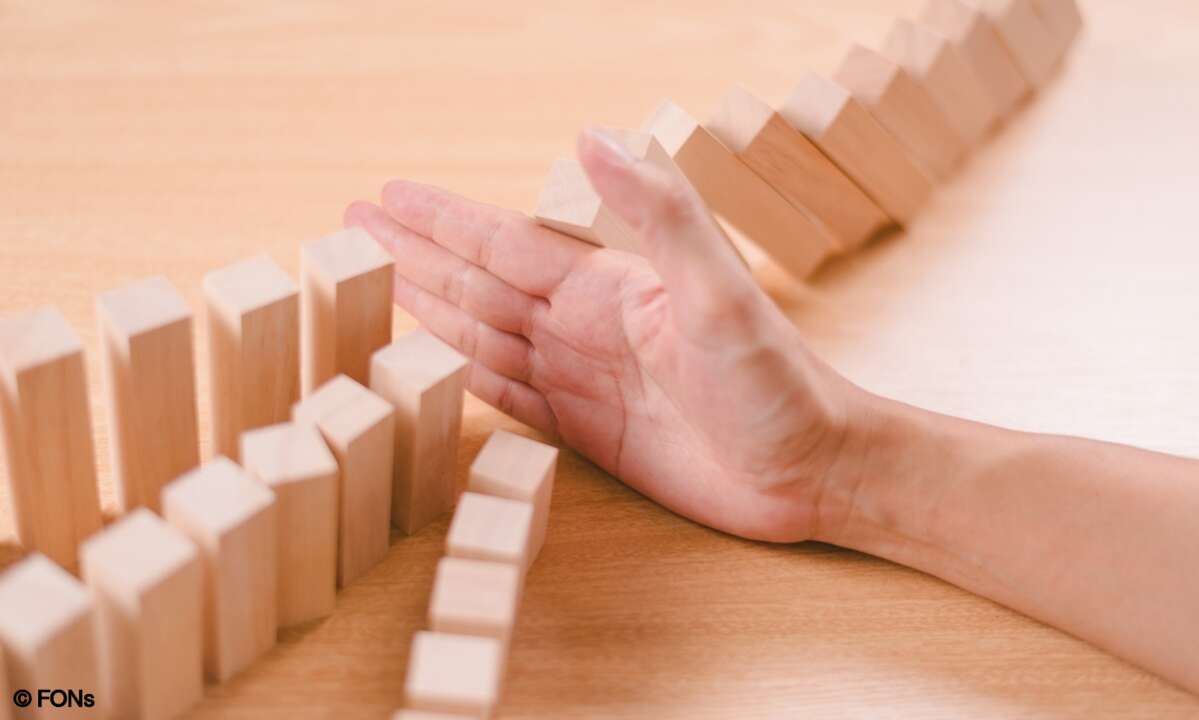Hohe Anforderungen an VoIP-Sicherheit
Während sich im privaten Bereich die Telefonie über das Internet auf Grund kostenloser Gespräche wachsender Beliebtheit erfreut, ist die Motivation zur Migration auf Voice over IP (VoIP) bei Unternehmen eine andere. Zwar ist auch hier das Sparpotenzial ein treibender Faktor für die Einführung von VoIP-Lösungen. Doch erreichen will man diese eher durch die Zusammenlegung zweier bislang getrennter Infrastrukturen, die Einsparung von Fachpersonal, neue Anwendungen, Prozessoptimierung, eine günstigere TK-Anlagenvernetzung zwischen mehreren Standorten über private IP-Netzwerke sowie per VPN/Internet für die bessere Integration von Telearbeitern.
In den letzten Jahren hat dabei die Sicherheit in der Wahrnehmung von VoIP-Systemen eine eher
untergeordnete Rolle gespielt. Dies ist wohl vorwiegend auf die vergleichsweise geringe Zahl
veröffentlichter Angriffe auf VoIP-Telefoniesysteme zurückzuführen. Doch inzwischen ist bei den
IT-Verantwortlichen das Sicherheitsbewusstsein in Bezug auf IP-Telefonie gewachsen, sodass die
Absicherung einer IP-basierten Telefonieinfrastruktur eindeutig an Stellenwert gewinnt.
Will man die Herausforderungen betrachten, die die Absicherung von VoIP-Verkehr mit sich bringt,
so können diese schnell mehrere hundert Seiten füllen. Eine umfassende Einführung in die
Problematik bietet beispielsweise die "Voipsec Studie zur Sicherheit von Voice over Internet
Protocol" des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und die "Special Publication
800-58" des National Institute of Standards and Technology (NIST) mit dem Titel "Security
Considerations for Voice over IP Systems". Die folgenden Beispiele beschränken sich daher
ausschließlich auf VoIP-Installationen im Intranet, wie sie für Unternehmen heute typisch sind.
Gefahren und Maßnahmen
Da klassische TK-Anlagen meist nur aus wenigen zentralen Komponenten und einer dedizierten
Verkabelung für den Anschluss der Endgeräte bestehen, lässt sich eine herkömmliche TK-Infrastruktur
bereits durch die Installation der TK-Anlage in zugangsgesicherten Räumen vor Abhörmaßnahmen und
Manipulationen weitgehend schützen. IP-basierte Sprachdienste sehen sich hingegen mit sämtlichen
klassischen Angriffen konfrontiert, denen alle IP-basierten Komponenten wie Server, Switches und
Arbeitsplätze heute ausgesetzt sind: das Abhören des Verkehrs an Span-Ports, Routing-Umlenkungen,
Denial-of-Service-Angriffe, Man-in-the-Middle-Attacken und viele mehr. Dazu kommen neue, speziell
auf VoIP-Protokolle abzielende Angriffe wie beispielsweise die Manipulation von
Call-Routing-Tabellen.
Phyische Sicherheit und VLANs
Um eine VoIP-Infrastruktur grundlegend abzusichern, gilt es daher zunächst, alle betroffenen TK-
und LAN-Komponenten zum Schutz vor Manipulationen über lokale Schnittstellen physisch zu sichern,
indem das Unternehmen sie in nur für autorisiertes Personal zugänglichen Räumen aufstellt. Zudem
muss der Administrator dafür sorgen, dass der Standardanwender und dessen Passwort auf allen
Netzwerkgeräten geändert wird. Da es bei Voice over IP mehrere Möglichkeiten zur Anbindung von
Endgeräten an das Datennetz gibt (zum Beispiel PC hinter dem Telefon), können auch
Standardfunktionen auf den Switches zu Sicherheitsrisiken wie beispielsweise VLAN-Hopping führen.
Auch besteht die Möglichkeit, dass ein Mitarbeiter sein Telefon vom Netzwerk trennt und über dessen
Port andere Endgeräte mit dem Netzwerk verbindet, um auf diesem Weg Angriffe zu initiieren.
Um Manipulationen am und über das Netzwerk zu verhindern, gibt es wiederum eine ganze Reihe von
Möglichkeiten. So sollte der Administrator das Sprach- vom Datennetzwerk entweder durch VLANs oder
die Verwendung separater Ports für Sprach- und Datenendgeräte trennen. Des Weiteren empfiehlt sich
eine Härtung der LAN-Komponenten – der Admin könnte zum Beispiel alle Standardkonfigurationen wie
Trunking-Auto-Negotiation ausschalten und alle unbenutzten Ports sperren. Empfehlenswert ist zudem
die Konfiguration von Port-Security und/oder die Verwendung des Standards 802.1X zur
Authentifizierung.
Weitere Herausforderungen gibt es bei der Administration: So lassen sich beispielsweise die
VoIP-Komponenten über verschiedene Protokolle wie Telnet, HTTP, SSH oder HTTPS administrieren.
Einige dieser Protokolle übertragen die Benutzer- und Passwortdaten im Klartext und lassen sich
somit leicht abhören. Gelangt ein Unbefugter in den Besitz dieser Informationen, kann er
beispielsweise Daten auf den VoIP-Komponenten verändern oder abfragen, Richtlinien und
Rufnummernpläne ändern oder Gespräche umleiten. Um eine manipulations- und abhörsichere
Administration der VoIP-TK-Komponenten zu gewährleisten, müssen daher die administrativen
Verbindungen entweder verschlüsselt sein (SSH, HTTPS) oder über einen gesonderten Netzbereich (out
of band) erfolgen.
Aber auch die Endgeräte wie VoIP-Telefone, PCs mit Softphones oder WLAN- Phones sind angreifbar
und müssen in das Sicherheitskonzept einbezogen werden. So kann zum Beispiel die Manipulation der
Konfiguration eines VoIP-Endgeräts durch Einspielen gefälschter Konfigurationen oder veränderter
Firmware zu einer Gefährdung der kompletten VoIP- und Netzwerkinfrastruktur führen. Um dies zu
verhindern, ist es im Rahmen der zentralen Konfiguration der VoIP-Endgeräte notwendig, die
Konfigurationsänderungen wie auch deren Sicherungen nur zentral über eine Applikation an einzelnen
Geräten oder Gerätegruppen vorzunehmen und zuzulassen. Schon diese wenigen Beispiele verdeutlichen,
dass die Absicherung einer VoIP-Infrastruktur deutlich komplexer ist als die einer herkömmlichen
TK-Landschaft. Das bedeutet wiederum, dass Unternehmen zwar Personal bei der TK-Betreuung einsparen
können, gleichzeitig aber massiv in personelle und materielle Ressourcen in der IT-Abteilung
investieren müssen – insbesondere um ihre VoIP-Installation abzusichern.
Hosting oder Remote-Management
Erleichterung kann hier der Einsatz eines spezialisierten Dienstleisters bringen, der die
Betreuung der VoIP-Infrastruktur übernimmt. Dabei gibt es zwei Serviceansätze: So verbleiben beim "
Remote Managed VoIP" die VoIP-Systeme beim Kunden und werden durch den Dienstleister aus der Ferne
administriert, während beim "Hosted VoIP" die Systeme soweit wie möglich ins Rechenzentrum des
Dienstleisters wandern. Durch die enge Verzahnung von VoIP- und LAN-Sicherheit ist ein Outsourcing
der VoIP-Sicherheit allein in den meisten Fällen nicht sinnvoll. Falls dies doch gewünscht ist,
müssen die entsprechenden Servicevereinbarungen wirklich eindeutig geregelt sein.
Die Entscheidung für eine vollständig im Rechenzentrum des Dienstleisters gehostete
VoIP-Infrastruktur bietet sich immer dann an, wenn für die Verbindung von den
Unternehmensstandorten zum Rechen-zentrum ein Redundanzkonzept vorliegt. Denn fiele die Verbindung
zwischen Call-Server im RZ und den IP-Phones beim Kunden komplett aus, so käme die Telefonie dort
zum Erliegen. Der Vorteil einer gehosteten Lösung liegt dabei in der hochverfügbaren und sicheren
Bereitstellung der VoIP-Komponenten durch die Spezialisten des Outsourcers. Das Unternehmen muss
vor Ort lediglich die IP-Telefone installieren, wofür normalerweise kein Fachpersonal nötig ist.
Die Absicherung der LAN-Komponenten vor Ort liegt wahlweise in der Verantwortung des Unternehmens
(nach Vorgaben des Outsourcers) oder beim Dienstleister.
Zentralisierung nicht ohne Nachteile
Ein Nachteil der Zentralisierung kann dabei sein, dass der Kunde seinen alten Rufnummernplan
aufgeben muss. Denn bei einem zentralen Media Gateway sind alle Niederlassungen des Kunden nur über
eine Rufnummer aus dem Vorwahlbereich des RZs oder über eine Mehrwertnummer erreichbar, da der
Übergang vom IP- in das Telefonnetz über das Gateway im RZ erfolgt. Dafür spart sich das
Unternehmen wiederum sämtliche Telefonanschlüsse in den Niederlassungen. Stellt dies ein
organisatorisches oder politisches Problem dar, könnte beispielsweise als Kompromiss ein Media
Gateway in die Niederlassungen des Kunden wandern und vom Dienstleister remote administriert
werden, während der Call-Server im sicheren Rechenzentrum verbleibt.
Zertifizierungen bringen Sicherheit
Bei der Wahl des geeigneten Dienstleisters ist es für Unternehmen schwer, aus dem großen Angebot
den richtigen Partner zu finden. Wichtig ist vor allem, dass ein Vertrauensverhältnis zum
Dienstleister vorliegt und dieser die Bedürfnisse seines Kunden versteht – sich sozusagen auf
gleicher Augenhöhe befindet. Neben diesen weichen Faktoren können auch Zertifizierungen der
Dienstleister bei der Auswahl helfen. Den sicheren RZ-Betrieb bescheinigt beispielsweise die "
Trusted Site Infrastructure" der TÜV IT, einer Tochter der TÜV-Nord-Gruppe. Zu den Unternehmen, die
ihre RZs nach diesen Maßstäben bereits zertifiziert haben, gehören beispielsweise der Flughafen
München, Accenture, das IZB Informatikzentrum und Infineon. Eher in der Finanz- und Bankenwelt
verbreitet ist die Zertifizierung "Sicherer IT-Betrieb" des SIZ (Informatikzentrum der
Sparkassenorganisation). ISO/IEC 27001:2005 spezifiziert hingegen die Anforderungen für
Herstellung, Einführung, Betrieb, Überwachung, Wartung und Verbesserung eines dokumentierten
Informationssicherheits-Managementsystems unter Berücksichtigung der Risiken innerhalb der gesamten
Organisation.