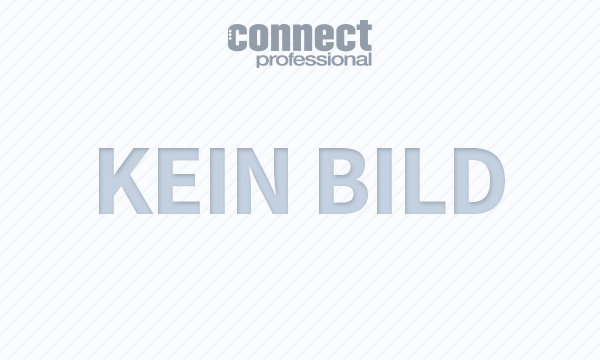Die Ungleichzeitigen
Vor lauter Fortschritt wird leicht übersehen: Menschen und Märkte verhalten sich erstaunlich trotzig und renitent. Und das ist gut so, denn Geld verdienen lässt sich nicht allein nur mit der Zukunft.
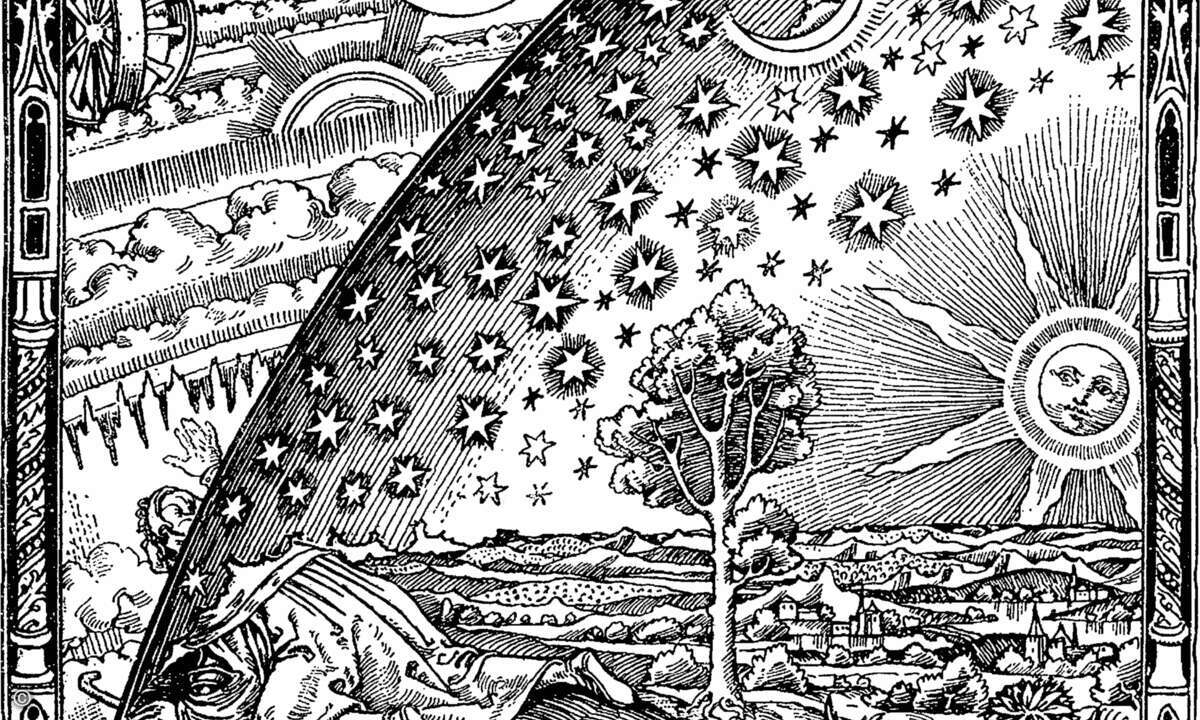
Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen gehört zu den am meisten bestaunten Phänomenen bei Studenten im Erstsemester. Angehende Geisteswissenschaftler lernen, dass es keine starren Epochengrenzen gibt und fließende Übergänge ein paar Jahrhunderte dauern können. Als die letzte »Hexe« in Deutschland in der Ostsee ersäuft wurde, startete zwischen Fürth und Nürnberg 1835 der erste dampfbetriebene Personennahverkehr. Die Eisenbahn revolutionierte Mensch und Wirtschaft. Wo die Inquisition noch lange und mächtig in den Köpfen nachwirkte, bracht sich die Innovation bereits ihre Bahn. Hier die Pferdefuhrwerker, die um ihre ökonomische Existenz fürchteten und das »Dampfross« verfluchten. Dort die ersten Börsenmillionäre, die an der neuen Mobilität traumhaft verdienten.
Erst der Rückblick schärft ein Bewusstsein für die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, und er macht deutlich, dass Menschen, Gesellschaften und nicht zuletzt die Wirtschaft und ihre Märkte schon immer ihren Platz zwischen Fortschritt und Tradition, zwischen alt und neu suchten. Das ist heute nicht anders als in früheren Zeiten. Innovative, auf die Zukunft gerichtete Branchen wie der ITK-Sektor sind Paradebeispiele dafür, wie sich neue Märkte formieren und wie schwer Unternehmen bisweilen solche Transformationen bewältigen. Vorschnell abschreiben sollte man Firmen indes nicht, deren verblassende Vergangenheit heute eher als Last beschrieben wird.
Zu den Ungleichzeitigen im Digitalen gehören etwa 14 Millionen Deutsche zwischen 18 und 74 Jahren, die noch nie im Internet waren. Während die Diskussion um die Gigabit-Gesellschaft und vernetzte Mobilität entbrannt ist, lebt ein nicht gerade kleiner Teil der Gesellschaft unter uns, der zu den digitalen Analphabeten gezählt wird. Auch sie sind Kunden, wenn auch nicht jene, die sich die ITK-Branche wünscht.
Ein Blick in ärmere Länder Südeuropas und außerhalb des Alten Kontinents ist nicht einmal nötig, um zeitlich parallele Entwicklungen in schon etablierten Hightech-Märkten zu beobachten. Vom Internet ausgeschlossene Verbraucher, Unternehmen ohne eigene Homepage, Behörden mit rudimentären E-Government-Angeboten, Kreidetafel statt Whiteboard in Klassenzimmern und gedruckte Zeitungen, Zeitschriften und Bücher anstelle von Portalen und Content: Die viel beschriebene digitale Spaltung in Deutschland geht quer durch die Bundesländer, differenziert sich nach Haushaltseinkommen, nach dem Bildungsgrad, dem Alter der Bevölkerung und den Gewohnheiten, wie Verbraucher Informationen, Dienstleistungen oder Produkte nutzen.
Zu den Aufgaben der Trend- und Zukunftsforscher und ihrer Institute gehört es, solche Parallelentwicklungen an Zahlen festzumachen. Nicht selten werden dabei die großen Linien als Mängelzustände diagnostizieren und auf die Gefahren hingewiesen, wenn eine Transformation in Richtung Zukunft schleppend voranschreitet oder gar unterbleibt.
Was Visionäre vielfach nicht berücksichtigen: Das Potenzial noch immer existenter und funktionierender Märkte wird vielfach ausgeblendet und unterschätzt. Wollen Kunden Software künftig nur noch aus der Cloud beziehen und Anwendungen mieten statt kaufen? Werden künftig noch mehr Menschen in urbanen Ballungszentren mit bestens vernetzten Infrastrukturen in »Smart Home« arbeiten und wohnen? Naturlandschaften mögen in einem solchen Szenario real immer weniger Platz finden, vergessen ist der romantisierende Rückzug ins Dörfliche indes nicht. Im Gegenteil. Solange er der Zeitschrift »Landlust« traumhaft hohe Auflagen beschert, lässt sich mit dem gedruckten Wort neben dem Internet immer noch gutes Geld verdienen.