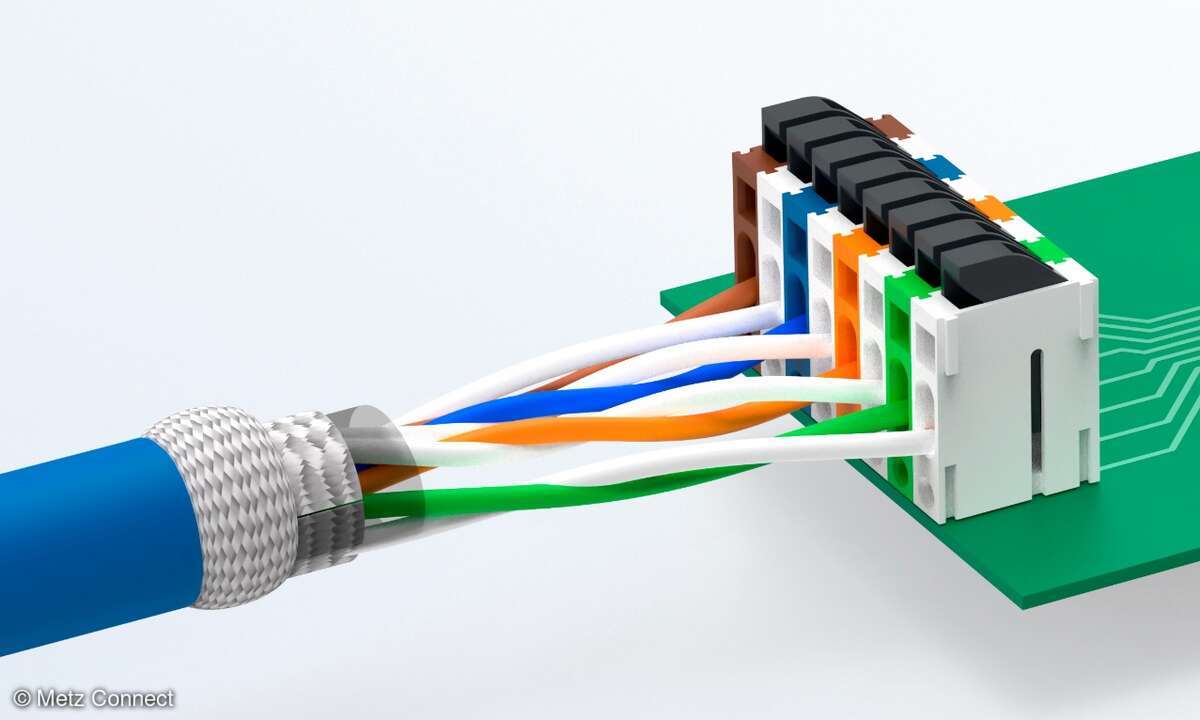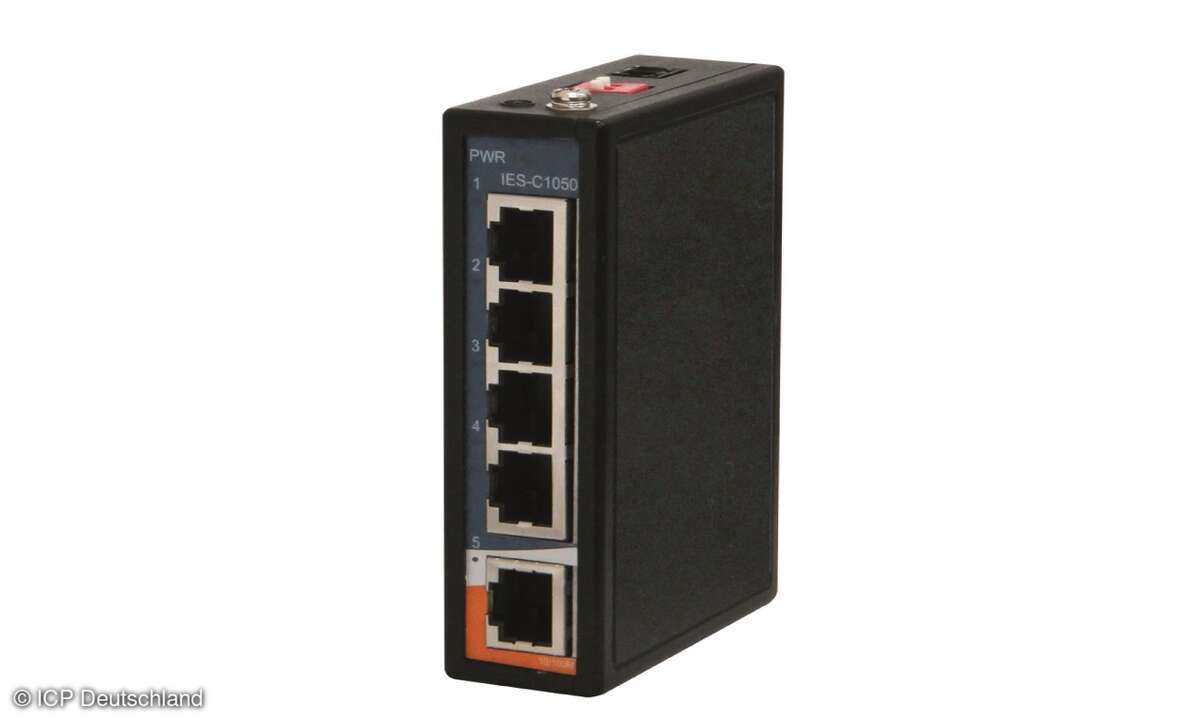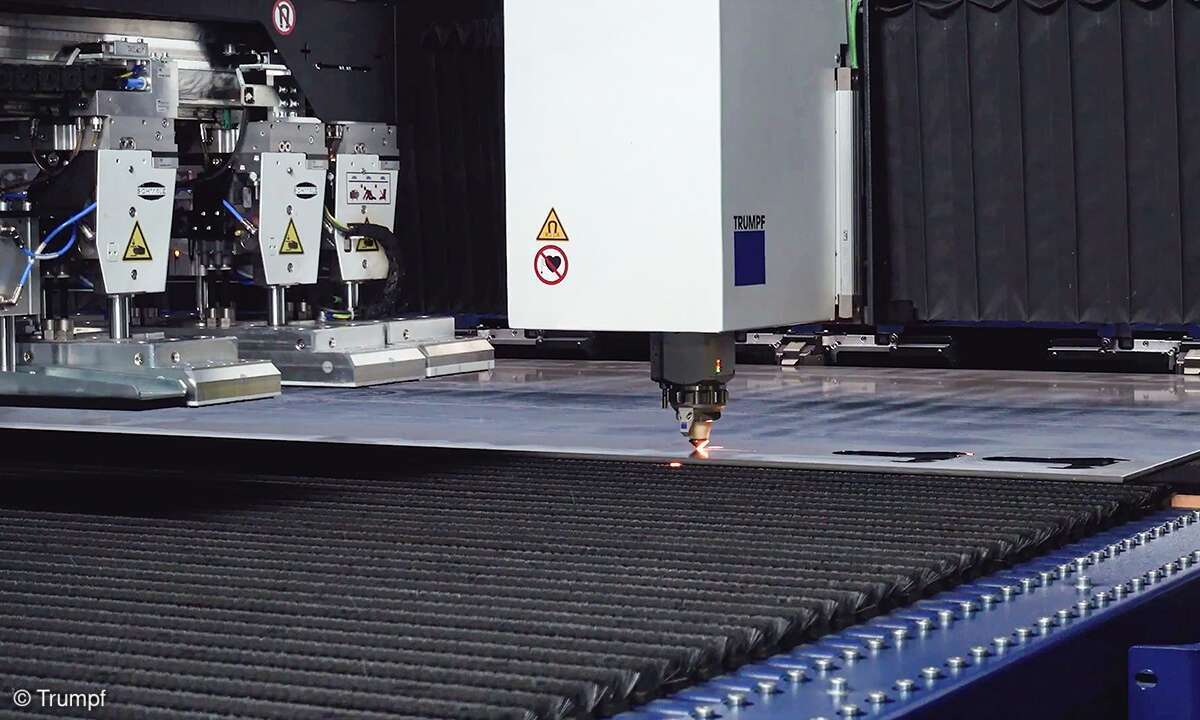Drahtlose Dienste erfordern Umdenken
Eine der größten Herausforderungen für Telekommunikationsanbieter ist die Bereitstellung ausreichenden Backhauls zur Deckung einer überaus hohen Datennachfrage. Daten-, Video- und Audioübertragung finden aufgrund eines Paradigmenwechsels immer häufiger auch in drahtlosen Netzwerken statt. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, beginnen Netzbetreiber ihre herkömmlichen Zeitmultiplex(TDM)-Links auf neue Ethernet-Links mit höherer Geschwindigkeit umzustellen.
Der Schritt von einer auf Zeitmultiplex (TDM) basierenden Architektur zum Carrier-Ethernet
bedarf jedoch neuer Testanforderungen und -nachfragen. Netzbetreiber und Netzwerkausrüster müssen
Vorabtests besondere Aufmerksamkeit schenken, um ihren Kunden einen nahtlosen Übergang in die
permanent verbundene und ständig mobile Welt zu gewähren. Bevor Netzbetreiber in größerem Umfang
IP/Ethernet in mobilen Backhaul-Netzen einsetzen, müssen sie sicherstellen, dass die Netze bei den
entscheidenden Leistungsmerkmalen Zuverlässigkeit, Sprachqualität und Synchronisation genau denen
gleichkommen, die die TDM-Technik bereits aufweisen.
Explosion bei mobilen Breitbanddaten
In den nächsten Jahren wird eine riesige mobile Breitbandflutwelle auf uns zurollen: Laut
Infonetics Research besitzen mehr als vier Milliarden Menschen ein mobiles Endgerät, doch nur 350
Millionen nutzen diese Breitbandverbindungen auch aktiv. Im Laufe des Jahres 2010 wird die Anzahl
der Mobilfunk-Breitbandzugänge mit 540 Millionen bereits die Zahl der Festnetz-Breitbandzugänge
(480 Millionen Teilnehmer) übertreffen. Und mit einer jährlichen Gesamtwachstumsrate von 37 Prozent
steigt die Anzahl der Mobilfunk-Breitbandzugänge von 2009 bis 2014 von 354 Millionen auf 1,7
Milliarden. Damit verbunden wächst natürlich auch der gesamte mobile Datenverkehr.
Erst der Dezember des letzten Jahres wurde eine historische Zäsur erreicht: Zum ersten Mal
wurden weltweit mehr mobile Daten als Sprachdaten übertragen. Dieser Umbruch zeigte sich bei etwa
140.000 TByte im Monat sowohl im Sprach- als auch im Datenverkehr. Dabei wuchst der Datenverkehr in
2008 und 2009 jährlich um 280 Prozent und soll sich voraussichtlich über die nächsten fünf Jahre
jährlich verdoppeln. 2017 soll der Datenverkehr bei monatlich 1,8 Exabytes liegen. Einige
Branchenanalysten gehend davon aus, dass dieser Datenverkehr in naher Zukunft zu 75 Prozent aus
Videodaten bestehen wird.
"Mobile Backhaul" ist das Netz für den Transport des Funkverkehrs zwischen Funkbasisstationen
(FBS/Node-B) und den Funknetzsteuerungen (BSC/RNC). Das Backhaul-Netz trägt dabei entscheidend zu
den hohen Kosten beim Ausbau und Betreiben eines Funknetzes bei – mit einem geschätzten Anteil von
ungefähr 25 bis 30 Prozent der Gesamtbetriebskosten. Um den stetig wachsenden Datenaufkommen
gerecht zu werden, müssen Funknetzwerkbetreiber ihre Netzwerke mit den kosteneffektiven
Backhaul-Techniken optimieren.
In der Vergangenheit haben Zeitmultiplex-(TDM-)Schaltkreise Basisstationen mit den regionalen
Funknetzsteuerungen verbunden – was für reine Sprachsysteme oder Datenverkehr geringer Bandbreite
gut funktionierte. Das rapide Anwachsen des mobilen Breitbandverkehrs hat jedoch die
TDM-Schaltkreise überlastet. Die Anbieter sind jetzt nicht in der Lage, mit dem Aufwärtstrend beim
Funkverkehr mitzuhalten. Auch das Hinzufügen weiterer TDM-Schaltkreise, um diese Herausforderung zu
meistern, stellt keine brauchbare Lösung dar, denn die monatlich anfallenden Kosten für alte
Backhaul-Technik (PDH, ATM over PDH und SONET/SDH) steigen linear mit dem Datenverkehr. Da der
relativ niedrige durchschnittliche Umsatz pro Nutzer (APRU), den ein Betreiber für verbesserte
Dienste erzielen kann, Netzbetreiber davon abhält, die höheren Kosten an die Verbraucher
weiterzugeben, tendieren Betreiber stattdessen zu paketbasierenden Backhaul-Techniken, die IP und
Ethernet nutzen. So lassen sich die Kosten pro Bit senken.
Mit Carrier-Ethernet für drahtloses Backhaul können Betreiber allerdings hohe
Bandbreitenzuwächse von Cell Sites aus unterstützen und gleichzeitig die Betriebskosten unter
Kontrolle halten.
Der Übergang von TDM- zu Ethernet-basierendem Transport vollzieht sich nicht ohne Probleme.
TDM-Schaltkreise bieten eine vorhersehbare Dienstgüte (QoS), nahezu 100-prozentige Zuverlässigkeit
und Uhrzeitsynchronisierung über das Netzwerk. Um genau diese Leistungsmerkmale zu erreichen, sind
neue Techniken und Verbesserungen der nativen Ethernet-Netze notwendig.
Im Hinblick auf die Anforderung an die Dienstgüte hat das Metro Ethernet Forum (MEF) die
technische Spezifikation MEF 10.2 entwickelt, die Dienstattribute anhand von Traffic-Klassen
definiert. Für die Nutzung der Prioritätsbits ist dazu VLAN Tagging nach IEEE 802.1Q erforderlich.
Durch die Einführung einer Dienstgüte können Service-Level-Vereinbarungen (SLAs) und Diensteprofile
angeboten werden. Dienstprofile lassen sich nach verschiedenen Parametern wie Bandbreite, Latenz,
Frame Delay Variation und Frame Loss Ratio spezifizieren. Geräte im Netzwerke steuern und
priorisieren die ankommenden Daten nach Tags und zugehörenden Profilen. Wichtig ist es, ein Gerät
oder System darauf zu überprüfen, ob Ethernet Virtual Circuits (EVCs) auch mit einer definierten
Service-Leistung unterstützt werden.
Im Gegensatz zu SONET steht bei Ethernet keine "Out of Bound"-Kontrolle zur Verfügung. Für die
erforderliche Verfügbarkeit von 99,999 Prozent gibt es jetzt eine Ethernet-Untergruppe für OAM
(Operations Administration and Maintenance). Mit der OAM-Technik können Betreiber über Ethernet
Links und End-to-End-Dienste Fehler erkennen, überprüfen, isolieren, beheben und melden. Vor dem
Einsatz muss allerdings bei allen Netzgeräten die Ethernet OAM-Technik im Hinblick auf
Funktionalität, Konformität und Interoperabilität getestet werden.
Das MEF hat eine Reihe von Zertifizierungsstandards (MEF 9, 14 und 21) veröffentlicht, mit denen
sich die Einhaltung der Standards und die Interoperabilität der Carrier-Ethernet-Geräte
formalisieren lassen. QoS und OAM-Erweiterungen von Ethernet schaffen eine realisierbare Technik
für den Diensttransport über Mobile Backhaul.
In einer kürzlich von Infonetics durchgeführten Befragung globaler Diensteanbieter gaben 100
Prozent der Teilnehmer an, noch im Jahr 2010 IP-/Ethernet-Backhaul bereitstellen zu wollen. Nach
dem Mobile Backhaul Implementation Agreement MEF 22 wird die Migration sich in "Phasen"
vollziehen.
In der ersten Phase erfolgt die Implementierung einer Hybridstruktur, in der Carrier-Ethernet
für den Paket-Offload der Datendienste genutzt und TDM für Sprache beibehalten wird, da für den
Rufaufbau und das Handover im ganzen Netz eine Uhrzeitsynchronisierung erforderlich ist. Dies ist
keine Ideallösung, da die Betreiber gezwungen sind, zwei getrennte Netze zu unterhalten und zu
finanzieren.
Endziel ist die Phase 2, bei der ein einziges Carrier-Ethernet-Netz für das Backhauling aller
Dienste zum Einsatz kommt. Aus der Befragung von Infonetics geht auch hervor, dass 65 Prozent der
Diensteanbieter planen, letztlich auf ein einzelnes IP-/Ethernet-Backhaul umzusteigen. Vor der
Umsetzung dieser letzten Phase der Migration müssen Betreiber darauf vertrauen haben, dass die
ToP-Technik (Timing over Packet) die strengen Uhrzeitsynchronisierungsanforderungen drahtloser
Standards erfüllen.
ToP-Technik
Im Gegensatz zu TDM war Ethernet vom Entwicklungsansatz her nicht für die Übertragung synchroner
Informationen gedacht und kann über alle Netzwerkgeräte hinweg nicht "von sich aus" die
Uhrzeittaktfrequenz mit der Genauigkeit und Stabilität anpassen, die für den Rufaufbau, das
Handover und die Zuverlässigkeit von Mobilfunkverbindungen erforderlich sind. Zur Behebung dieses
Problems empfiehlt MEF 22 den Einsatz von Lösungen gemäß IEEE 1588 und ITU-T SyncE (Synchronous
Ethernet).
Diese ToP-Technik synchronisiert die Taktfrequenz für alle Geräte im Ethernet-Backhaul-Netzwerk
und verbessert deutlich die Taktgenauigkeit und -stabilität zur Erfüllung der
Synchronisierungsanforderungen unterstützter Mobile-Voice-Abonnenten.
Bei SyncE handelt es sich um eine Technik mit der eine Taktsynchronisierung (auch "Syntonization"
genannt) über alle Geräte im Ethernet-Netzwerk erreicht wird. SyncE-Schnittstellen leiten die
Frequenz aus dem empfangenen Bit-Strom ab und geben diese Information an die Systemuhr weiter.
Welcher Empfänger-Port (und eingehende Bit-Strom) von der Systemuhr dabei verwendet werden soll,
wird durch das ESMC-Protokoll (Ethernet Synchronization Messaging Channel) gesteuert. Das
ESMC-Protokoll verwendet Synchronisierungsstatusmeldungen (SSMs). Dabei werden zehn Pakete pro
Sekunde gesendet, die die Uhrzeitqualität jedes Ingress-Ports mitteilen. Wichtig ist, dass das
Gerät den Ingress-Port mit der höchsten Uhrzeitqualität erkennt und für das Einstellen der
Systemuhr auswählt, da die übertragenden Schnittstellen mit der Systemuhr gekoppelt sind und
anschließend den Bit-Strom an die Downstream-Knoten verteilen.
Für Betreiber von Interesse ist der Umstand, dass die Uhrzeitsynchronisierung sprunghaft auf der
physikalischen Ebene und in ähnlicher Weise wie bei TDM-Netzen erfolgt. Neben der
Taktsynchronisierung erfordert die Multi-Channel-Kommunikation für die Phasenanpassung jedoch die
Synchronisierung der Tageszeit (ToD) in Form eines präzisen Wertes der aktuellen Zeit.
Für die Synchronisierung von Ethernet-Netzen mit einer Vielzahl von Cellular-Techniken sowie
Video-Streaming und interaktiven Spieleanwendungen ist IEEE 1588 zusändig. Dieser Standard
spezifiziert das PTP-Protokoll (Precision Timing Protocol) für die Netzwerksynchronisierung. Im
Gegensatz zu Synchronous Ethernet handelt es sich bei IEEE 1588/PTP um eine rein paketbasierende
Lösung, bei der die tatsächlichen Uhrzeitwerte in speziellen, für diese Aufgabe bestimmten Paketen
übermittelt werden. IEEE 1588 stellt eine Master-Slave-Hierarchie der Uhren in einem Netzwerk her,
wobei jeder Slave sich mit einer Master-Uhr synchronisiert, die als Hauptquelle für die Uhrzeit
fungiert. Synchronisierungspakete werden zwischen Master und Slave ausgetauscht (mindestens 32
Pakete pro Sekunde), sodass der Slave seinen Oszillator kontinuierlich anpassen kann.
In Version 2 des IEEE 1588 Precision Time-Protokolls (IEEE 1588v2) wurden kürzlich zwei weitere
logische Gerätetypen eingeführt, die in der Regel in Switches und Router zwischen den Master- und
Slave-Uhren eingebaut werden:
Eine Boundary Clock (BC), die als Slave-Uhr einer Upstream-Master-Uhr und als Master für mehrere
Downstream-Slave-Uhren fungiert, erhöht die Skalierbarkeit des Systems. Eine Boundary Clock hat
einen eigenen internen Oszillator, der von dem Upstream-Master gesteuert wird. In großen Systemen
ermöglicht die Einführung von BCs den Einsatz von weitaus mehr Slave-Uhren, als ein einziger Master
verwalten kann.
Jeder Ethernet Switch, der in einem PTP-Netzwerk die Auswirkungen von Verzögerungen bei der
Weiterleitung (z.?B. aufgrund von Paketwarteschlagen im Switch) abschwächen soll, verfügt über eine
Transparent Clock (TC). Andernfalls könnten diese Verzögerungen die Genauigkeit des Uhrenabgleichs
beeinträchtigen. Die TC misst die Verzögerung bei der Weiterleitung der
PTP-Zeitsynchronisierungspakete, die durch den Switch geschickt werden. Diese
Weiterleitungsverzögerung wird bei einigen PTP-Paketen in deren Correction-Factor-Feld
verschlüsselt. So können die Slave-Uhren Netzwerkverzögerungen korrigieren und – zumindest in der
Theorie – für eine perfekte Synchronisierung sorgen.
Vorabtests sind ein Muss
Aufgrund bestehender Industrienormen treffen SyncE- und IEEE-1588v2-Technik in der Branche auf
eine breite Akzeptanz und werden heute in Ethernet-Chipsätzen eingesetzt. "Industrienormen"
garantieren jedoch nicht, dass die verschiedenen Netzwerkgeräte mit diesen Techniken miteinander
arbeiten können, denn bei kleinsten Details, wie beispielsweise bei spezifischen Feldwerten, haben
die einzelnen Gerätehersteller Entscheidungsfreiheit. SyncE- und 1588v2-Interoperabilitätstests
zwischen Geräten unterschiedlicher Hersteller müssen deshalb vor dem Einsatz durchgeführt werden,
damit die Uhrzeitsynchronisierung im gesamten Netzwerk sichergestellt ist.
Anlässlich des EANTC-Showcase auf dem Ethernet-Weltkongress vom 20. bis 23. September in
Warschau lag der Hauptschwerpunkt auf der Phasen- und Taktsynchronisierung mit 1588v2 und SyncE.
Testgeräte spielten bei diesem Event eine wichtige Rolle, denn es ging darum, Kommunikationshürden
zwischen den Geräten verschiedener Hersteller zu ermitteln und zu beheben sowie Lösungen zu
finden.