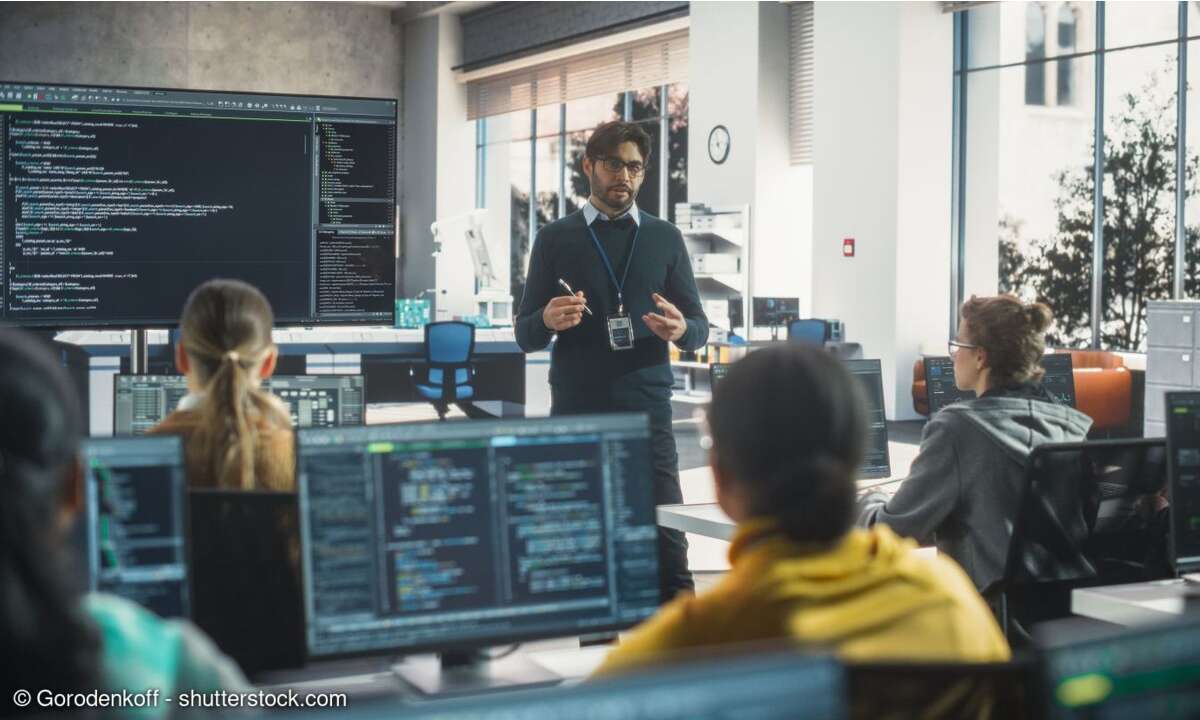Informatik-Ausbildung nicht mehr zeitgemäss (Fortsetzung)
- Informatik-Ausbildung nicht mehr zeitgemäss
- Informatik-Ausbildung nicht mehr zeitgemäss (Fortsetzung)
Frage der Qualifikation
Mittlerweile mussten jedoch viele schmerzlich erfahren, dass ein bloßer Vergleich von Stundensätzen der Komplexität von Offshoring nicht gerecht wird. Deshalb wird sich die Branche mit den langfristigen Folgen auseinandersetzen müssen. Im Zentrum steht die Frage, welche Qualifikationen in der IT-Branche am Standort Deutschland in den nächsten Jahren benötigt und nachgefragt werden ? denn nur durch bessere Ausbildung und höhere Kompetenz können Unternehmen in unseren »Hochlohnländern« langfristig bestehen.
Der Lehrstuhl für Software & Systems Engineering der Technischen Universität München (TUM) wollte es genau wissen: Die TUM-Informatiker befragten im Frühjahr 2005 knapp 300 Embedded-Systems-Experten aus aller Welt nach den erforderlichen Inhalten einer zeitgemäßen Informatik-Ausbildung. Die Befragten waren sich einig, dass heutige Informatik-Absolventen zu wenig Praxisbezug mitbringen. Sie empfehlen neben studienbegleitenden Praktika vor allem einen intensiveren Austausch zwischen Unternehmen und Universitäten. Nach Meinung der Fachleute ist das Lehren von formalen Grundlagen und logisch-analytischem Denken weitaus wichtiger als das von Programmiersprachen. Denn derartige Fähigkeiten können dann in kurzer Zeit im »Training-on-the-Job« erlernt werden ? zumal reine Entwicklungsaufgaben sowieso an Bedeutung für den Akademiker-Nachwuchs in Deutschland verlieren. Ein Beispiel ist die Webasto AG: Sie betreibt seit einigen Jahren erfolgreich das Offshoring einzelner Software-Entwicklungsleistungen und hat aufgrund der dadurch gestiegenen Wettbewerbsfähigkeit zusätzliche Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen. Aber die Aufgabenteilung hat sich geändert: »Die Produktion von Code wird verstärkt in andere Länder verlagert. Was hier bleibt sind die anspruchsvollen Aufgaben wie Analyse, Projektplanung oder Integration«, kommentiert Joachim Klesing, Abteilungsleiter bei der Webasto AG. »Darauf müssen die Absolventen vorbereitet sein«.
Praxis und Grundlagen ? ein scheinbarer Widerspruch
Auf den ersten Blick widersprechen sich die Forderungen: Einerseits sollen die Lehrpläne den Grundlagen mehr Aufmerksamkeit schenken ? und gleichzeitig eine stärkere Praxisorientierung aufweisen? »Dieser scheinbare Widerspruch der Aussagen kann von den Universitäten nur dadurch gelöst werden, dass wir eine breite Grundlagenausbildung unseren Studenten gewährleisten und gleichzeitig in den anwendungsnahen Lehrinhalten einen intensiven Austausch mit der Praxis ermöglichen«, sagt Manfred Broy, Professor für Informatik an der TUM. Nicht zuletzt werden dadurch eine »breitere Systemperspektive« und eine stärkere Interdisziplinarität erreicht, da sich die Studenten beispielsweise mit physikalischen oder betriebswirtschaftlichen Problemen auseinander setzen. »Die wirkliche Welt der Software-Entwicklung beinhaltet auch derartige Fragestellungen. Daher müssen wir sie bereits im Studium aufzeigen«.
Vorbild könnte in dieser Hinsicht ein internationales Projekt sein, an dem sechs Universitäten aus Europa, Indien, Brasilien und den USA teilnehmen und das von Siemens Corporate Research (SCR) in USA koordiniert wird. Sieben Teams mit insgesamt 35 Studenten, darunter eine Studentengruppe der Technischen Universität München, arbeiteten in einem globalen Software-Entwicklungsprojekt zusammen. Die Idee: Ein weltweit verteiltes Softwareentwicklungs-Projekt wird simuliert und die Anlehnung an ein »echtes« Großprojekt von Siemens zur Entwicklung einer komplexen Web-Applikation sorgt für die nötige Realitätsnähe. Allerdings stand nicht die Generierung von Code im Vordergrund. Vielmehr sollten sich die Studenten in einem internationalen Team integrieren. Die Studenten diskutierten zunächst über verschiedene Vorgehensmodelle zur Steuerung des Gesamtprojektes. Welche agilen Methoden für das Entwicklungsteam in München anwendbar und sinnvoll waren, wurde genauso untersucht, wie technische und organisatorische Fragen der Versionsverwaltung oder der Integration von Ergebnissen mehrerer Teams. Insgesamt analysierten und gestalteten die Studenten alle Aspekte der frühen Phase eines verteilten Projektes. »Natürlich erfordern solche Angebote einen intensiven Kontakt zwischen Universität und Unternehmen«, sagt Manfred Broy. »Die Investition in solche Beziehungen zahlt sich aber langfristig für beide Seiten aus.«
Vielzahl von Erfahrungen
Und die Studenten profitieren schon kurzfristig davon. Dass das Projekt mit Siemens »im Lebenslauf gut aussieht«, so ein Teilnehmer, ist nur ein Effekt und weitere ergeben sich aus der Vielzahl von Erfahrungen: Das fängt an mit scheinbar banalen Dingen wie englischsprachiger Kommunikation und der Koordination über Zeitzonen hinweg. Und geht weiter mit dem Lösen von Konflikten im Team, dem Erkennen von individuellen Stärken des Einzelnen oder mit dem Umgang mit Mentalitätsunterschieden in anderen Gruppen. Diese Unterschiede können verteilte Projekte massiv behindern; sie zu sehen und Lösungen dafür zu erarbeiten war eine wichtige Erfahrung. Daneben ermöglicht das Projekt das Lernen durch Improvisation. »Auf Verzögerungen, geänderte Anforderungen oder den Wechsel von Ansprechpartnern richtig reagieren ? in Vorlesungen können wir solche Themen nicht lernen«, sagt ein Student. Dass diese Herausforderungen manchmal zu »Frustphasen« geführt haben, spricht dabei nicht gegen das Experiment.
Die Lehren
Letztendlich ging es für die Studenten darum, ihren theoretischen Wissenshintergrund in ein Team einzubringen und auf eine reale, verteilte Projektumgebung zu übertragen. Praktika im Studium können das nur bedingt leisten. Die Lehren aus dem Projekt: Der Informatik-Nachwuchs sollte eine Kombination von technischen, menschlichen und organisatorischen Fähigkeiten gepaart mit Berufserfahrung vorweisen. Davon ist auch Manfred Broy überzeugt und beteiligt sich mit einem neuen Studententeam aus München am weiteren Verlauf des Siemens-Projektes. »Denn nur durch die Vermittlung dieser Fähigkeiten wird es uns gelingen, Absolventen, Unternehmen und letztendlich den ?Hochlohn-Standort? Deutschland wettbewerbsfähig zu halten.«
Dipl.-Volksw. Patrick Keil ist wissenschaftl. Mitarbeiter am Lehrstuhl für Software & Systems Engineering TUM