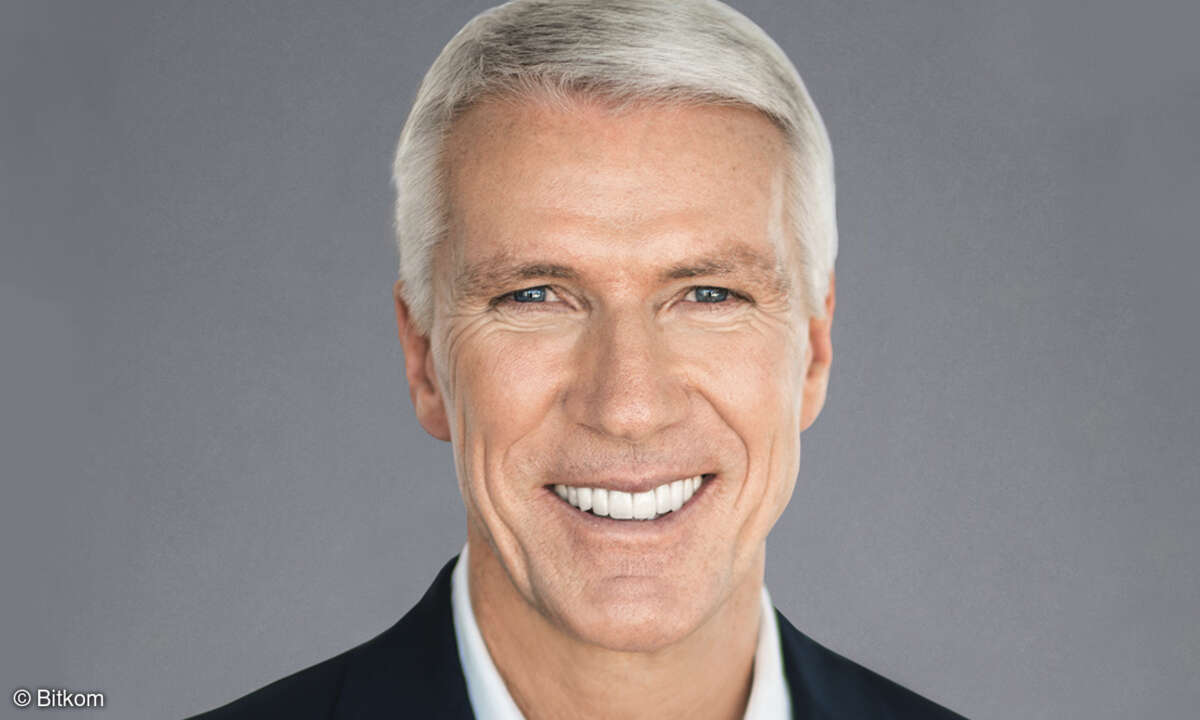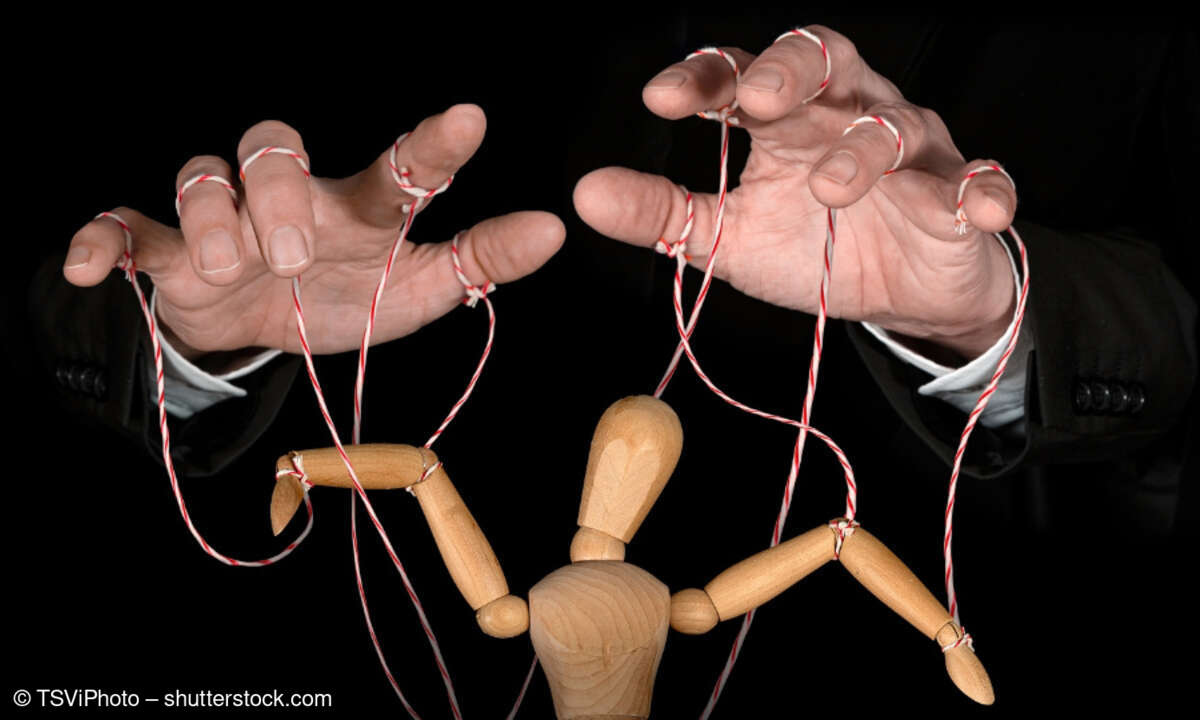Internationalisierung der Rechnungswesen-Software
Internationalisierung der Rechnungswesen-Software. Nicht zuletzt aufgrund von Änderungen gesetzlicher Rahmenbedingungen, eines komplexeren Nachfrageverhaltens auf Anwenderseite sowie der Ausweitung kollaborativer Netzwerke befindet sich der Markt für Rechnungswesen-Software in einem ständigen Wandel.
Internationalisierung der Rechnungswesen-Software
SOA zur optimalen Prozessorientierung
Die optimale Unterstützung der organisatorischen Abläufe und betriebswirtschaftlichen Prozesse zwischen Standorten über Ländergrenzen hinweg durch adäquate IT-Konzepte und -Lösungen ist eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg eines Engagements auf einem oder mehreren Lokalmärkten. Die innerhalb der vergangenen zwei Jahren oftmals diskutierte Service-orientierte Architektur (SOA) ist nach wie vor in diesem Zusammenhang ein Thema für viele Unternehmen, die eine verbesserte technologische Basis für eine konsequente Prozessorientierung im Rechnungswesen und Controlling schaffen wollen. Der damit versprochene Return on Investment liegt dabei nicht in der SOA selbst, sondern im Wesentlichen in der Möglichkeit, die Prozesse flexibel und unabhängig von den Applikationen zu gestalten und auf dynamische Änderungen von Rahmenbedingungen optimal reagieren zu können.
Eine genaue Bezifferung der Optimierungs- und Einsparpotenziale ist daher allerdings, sofern überhaupt, nur schwer möglich. Für den Aufbau einer IT-Architektur nach SOA-Prinzipien werden heute kaum größere Budgets bereitgestellt, so dass man hinsichtlich der Umsetzung in den kommenden Jahren von einem zunächst schrittweisen Fortschritt ausgehen kann. Die von vielen Management-Verantwortlichen geforderte Kosten-Nutzen-Planung erliegt allerdings oftmals der Intransparenz eines messbaren Erfolges. Abgesehen von dieser besonderen Problematik stellen Anbieter wie SAP, Microsoft oder der Finanz-Softwareanbieter Coda Financials schon Lösungen bereit, die die Funktionen ihrer SOA auf Basis von Webservices anbieten. Bislang sind echte SOA-Ansätze und -Implementierungen in Deutschland eher noch die Ausnahme.
Im Rahmen der Studie »Rechnungswesen-Software 2006« der Hamburger Unternehmensberatung SoftSelect wurden insgesamt 61 Rechnungswesen- und ERP-Systeme untersucht. Im Vergleich zu der Vorjahresuntersuchung wurde ebenfalls deutlich, dass insbesondere technologische Anpassungen bei den Systemen zu verzeichnen sind. So stieg der Anteil der Portallösungen von 31,4 auf 40 Prozent, die Anzahl der Web-basierten Lösungen stieg um 5,7 Prozent.
Wesentliche Vorteile
Mit der globaleren Ausrichtung deutscher Handels- und Industrieunternehmen und dem immer stärker zusammenwachsenden Binnenmarkt wird auch der grenzüberschreitende Rechnungsdatenaustausch immer wichtiger. Zumal mit dem Versand von elektronischen Dokumenten grundsätzlich auch erhebliche Kostensenkungs- und Nutzenpotenziale realisiert werden können.
Auf Seiten des Rechnungsstellers braucht eine Rechnung nicht erst gedruckt, verpackt und versandt werden. Der Empfänger profitiert zudem von schnelleren Durchlaufzeiten, geringerem Bearbeitungsaufwand oder Skontorabatten oder optimierten Zahlungsläufen. Doch gerade bei den
E-Rechnungen gibt es vielfach noch Unsicherheit und Handlungsbedarf, sowohl bezüglich der inhaltlichen Anforderungen an eine Rechnung, als auch hinsichtlich gesetzlicher Anforderungen an Inhalt, Übertragung und Archivierung. Dies betrifft nicht nur den Nachweis der Zustellung und des Empfanges, sondern auch die Relevanz für die Steuer. Zwar sind in den GDPdU wesentliche Rahmenparameter festgelegt, doch die betriebliche Praxis zeigt beim Umgang mit digitalen Rechnungen häufig noch große Defizite.
E-Rechnungen müssen, analog zu herkömmlichen Dokumenten, ebenfalls zehn Jahre aufbewahrt werden, und daneben im Originalzustand (also in Dateiform) jederzeit vorgelegt werden können. Ein Ausdruck oder eine Ablage reicht demnach nicht. Falls die Dateiform eines Dokumentes einem Prüfer nicht mehr vorgelegt werden kann, verliert das Unternehmen das Recht auf Vorsteuerabzug gemäß des Umsatzsteuergesetzes und muss stattdessen eine Nachforderung für zuviel einbehaltene Vorsteuer gegen sich wirken lassen. Grundsätzlich wird das nationale Recht des Lieferanten angewandt, bei Rechnungen in das europäische Ausland ist daher das deutsche Umsatzsteuergesetz einschlägig.
Deshalb muss jede E-Rechnung mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen und eindeutig authentifiziert werden können. Heute nehmen immer mehr Unternehmen externe Dienstleister für den Umgang mit digitalen Signaturen in Anspruch, da der Aufbau einer entsprechenden Sicherheits-Infrastruktur und die Zertifizierung als Signaturersteller zum Teil mit erheblichen Kosten verbunden ist. Zur Überprüfung elektronisch signierter Rechnungen beim Empfänger stellen zertifizierte Hersteller heute schon Lösungen online zum kostenlosen Download bereit, mit dem Mittelständler sowie Finanz- und Controllingabteilungen von Unternehmen signierte PDF-Rechnungen im Adobe Reader auf ihre Rechtmäßigkeit überprüfen können.
Wird die Signaturerstellung selbst in die Hand genommen, so müssen die entsprechenden Abstimmungen, wie zum Beispiel der Signaturschlüsselaustausch, in Eigenregie durchgeführt werden. Werden elektronische Rechnungen mit einer elektronischen Signatur empfangen, muss ebenfalls die Gültigkeit der Signatur überprüft und das Ergebnis mit den zugehörigen Signaturschlüsseln archiviert werden.