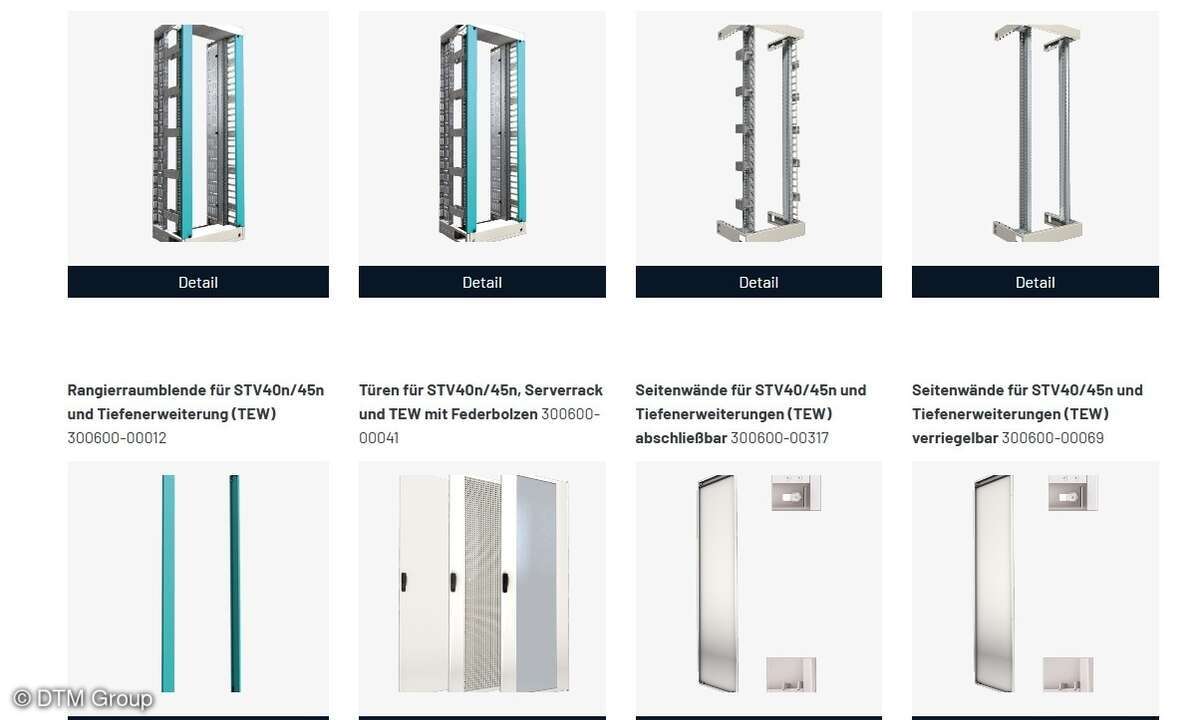IP-Domäne dehnt sich aus
Buyer’s Guide – Videoüberwachung – Das Duo aus IP und Ethernet mischt inzwischen auch hier mit. Die Argumente sind wohl bekannt: Standardtreue, Skalierbarkeit, weit verbreitete, bekannte Technik. Den beiden hat die alte analoge CCTV-Welt wenig entgegenzusetzen.


Dem Gespann aus Ethernet und IP hängt ein Stallduft von Revoluzzertum an. Haben die Beiden doch nahezu überall, wo sie auftauchten, Wirbel und bahnbrechende Veränderungen verursacht. Danach funktionierte der jeweilige Markt nach anderen Gesetzen. Ähnliches zeichnet sich in der Videoüberwachung ab. Bislang dominieren Closed-Circuit-Television-Anlagen (CCTV) das Segment. Eine Installation, bestehend aus analogen Kameras, prorprietärer Verkabelung, analogen Videomultiplexern, Fernsehern als Darstellungsmedium und Videorekordern als Aufzeichnungssysteme. Die typische CCTV-Technik baut eine Systeminsel auf, mit all den Vorteilen aus Sicherheitssicht und all den Nachteilen bei Skalierbarkeit, Kompatibilität und Preis.
Wirkt anachronistisch verglichen mit der digitalen Videotechnik des den Globus umspannenden IPs und Ethernets. Das Doppel schickt Bilder bereits in Form von MPEGs an Clients weltweit, legt sie auf Festplatten ab und organisiert die Videos mit hochskalierbaren Server- und Datenbanktechniken. Die Qualität der Bilder nimmt dabei von Kopie zu Kopie nicht ab, auch über Jahre hinweg. Und die anachronistische Videokasette der CCTV-Welt mit ihren 180 Minuten Speicherzeit?
Gemeinsamkeiten
Herstellern aus der CCTV-Welt sind die Nachteile ihrer antiquierten Technik so weit klar geworden, dass sie schrittweise IP in ihre Lösungen einbauen. Auf dem Markt der Videoüberwachung sind sich alle einig, dass die Bildarchivierung, Auswertung, Betrachtung digital und auf Basis von IP und Ethernet erfolgt. Die von den Kameras aufgezeichneten Bilder werden also in einem digitalen Codec-Format, seien es nun eines der MPEG-Derivate oder M-JPG, auf typischen Storage-Systemen gesammelt und organisiert. Wegen des Datenvolumens sind klassische Server- und Storage-Architekturen auf Grund ihrer weiten Verbreitung, des Standardisierungsgrads und der verfügbaren Software für diese Aufgabe prädestiniert. Der Anwender, sei es nun der Türwächter oder das Personal im Überwachungsraum, sieht die Bilder auf seinem PC. Die Programme, ob Java-Applets als Browser-Plugin oder dezidierte Windows- oder Linux-Applikationen, zeigen mehrere Bilder simultan an. Diese so genannten Split-Screens sind flexibel, zeigen die Bilder pro Kamera in verschiedenen, justierbaren Größen. Verglichen mit der alten CCTV-Welt, die entweder mit Hilfe teurer Multiplexer mehrere Bilder auf einen Fernseher brachte oder pro Kamera einen Apparat verlangte, ein großer Schritt.
Was die Software jedoch auszeichnet, sind die intelligenten Regelwerke, die exakt das Beobachtungsziel wiedergeben. Diese Policies sind vom Prinzip vergleichbar mit denen der Firewalls, die für bestimmte Ereignisse und Bedingungen entsprechende Maßnahmen und Verhaltensnormen festlegen. Auch die Form und der Inhalt der Regeln sind ähnlich. Wie bei der Firewall bezieht sich die Videoüberwachungs-Policy auf Objekte, diesmal die zu observierten Türen oder Einfahrten. Und wie in der IT-Security lassen sie sich abhängig von Ort, Zeit und einer Kombination weiterer Parameter aktivieren, sozusagen scharf schalten. Statt dass der Anwender diese Anforderungen manuell umsetzt, denkt die Software diese Bedingungen für ihn mit. Das entlastet das Überwachungspersonal und steigert dessen Effizienz.
Religionsfrage
Es herrscht jedoch ein großer Dissens auf Kameraseite. Einige Hersteller wie Axis, Mobotix oder Sony bauen inzwischen reine IP-Versionen. Diese wandeln die Bilder mit Hilfe von Encoding-Chipsätzen gleich in digitale Formate um und komprimieren sie. Sei es MPEGs, M-JPGs oder H.264. Sie besitzen RJ45-Anschlüsse, einige sind sogar PPPoE-fähig oder sprechen ISDN, um ihre Daten auf den Weg ins LAN oder WAN zu schicken. Auf Grund ihres komplexeren Innenlebens sind die IP-Kameras teurer als ihre analogen Pendants. Die CCTV-Gemeinde argumentiert weiter, dass die IP-Welt auch bei der Variantenvielfalt noch hinten anstehe. Das stimmt, die Betonung liegt aber auf »noch«. Wer spezielle Lösungen wie IP-Infrarot-Kameras oder bewegbare Dome-Geräte sucht, wird jetzt schon fündig. Natürlich ist die Auswahl noch nicht so groß wie bei den analogen Kameras.
Dass sich dies ändert, ist nur eine Frage der Zeit. Als Analogie eignet sich die Entwicklung bei der digitalen Fotokamera. Die digitalen Spiegelreflexversionen dringen mit ihren Megapixel-Chipsätzen selbst in den hochspezialisierten Profibereich ein. Der Überwachungsbereich profitiert übrigens enorm von den Chipentwicklungen und der Massenfertigung aus diesem Segment. Auch der Wissenstransfer auf Anwenderseite ist nicht zu unterschätzen, sind Begriffe wie Megapixel doch längst Allgemeingut.
Einen Streit »analog versus digital« auf Kameraseite auszurufen, ist im Prinzip überflüssig, denn es geht beides. Die Hersteller von Videoüberwachungssystemen haben dazu unabhängig von ihrem Ursprung CCTV oder Netzwerkerei so genannte Videoserver entwickelt. Diese Maschinen bauen einen sanften Migrationspfad auf, indem sie analoge und digitale Kameras ankoppeln und ihre Bilder lokal in ein einheitliches IP-fähiges Format umwandeln. Wer seine analogen Geräte behalten oder für bestimmte Bereiche Spezialversionen kaufen möchte, kann diese über den Videoserver in die digitale Welt einbinden.
Zweisprachigkeit
Als zweisprachiges System für beide Welten sind Kameraserver das Kernelement eines hybriden Konzepts. Ähnlich einer Appliance platzieren sie sich über einen oder mehrere 10/100-MBit/s-Ports in das Netzwerk. Per IP- und MAC-Kennung adressiert, zeichnen sie Videosignale auf internen Festplatten auf und schicken sie bei Bedarf direkt an den Zuschauer. Die Kameras klinkt der Server per BNC- oder CAT-5-Kabel ein, wobei er analoge Bilder in PAL- oder NTSC-Formaten intern in digitale und webfähige Video-Codecs umwandelt, bevor er sie speichert oder weiterreicht.
Kameraserver unterscheiden sich darin, wie viele Kameras sie einbinden, welche Bildqualität sie liefern und wie viele der um eine Kamera angeordneten Peripherie-Systeme sie unterstützen. Für jede Kamera ist intern ein Videokanal reserviert, für die der Verantwortliche individuell die Bildqualität bestimmen darf. Allein der benutzte Videocodec, sei es MPEG2, MPEG4 oder H.323, legt schon fest, in welcher Auflösung aufgezeichnet wird. Zusätzlich lässt sich in den meisten Kameraservern einstellen, in welcher Bildfolge der Server die Signale in das Netz leitet. Auch dies hat Auswirkungen auf die Bildqualität und auf die erforderliche Bandbreite. Ein Kameraserver sollte daher mehrere Codecs unterstützen und die Bildfolge individuell für jeden Kanal anpassen. Einige Hersteller haben in diesem Punkt durchaus ihre Hausaufgaben gemacht. Ihre Kameraserver fixieren die Datenmenge für jeden Videokanal, so dass der Administrator die erforderliche Bandbreite exakt kalkulieren kann. Als Prinzip gilt, das Netz so wenig wie möglich mit Daten zu belasten. Deshalb speichern die Server ihre Daten auf internen Festplatten, um sie lediglich im Ereignisfall über das Netz an den Zuschauer zu senden.
Fortschrittliche Appliances markieren den ausgehenden Datenstrom mit Multicast-Bits, damit das dahinter liegende Netz den Broadcast nur an die jeweiligen Empfänger durchreicht. Zu diesem Zweck muss Multicast im Netz eingerichtet sein. Auch eine nach Diffserv, IP-TOS oder IEEE 802.1p/Q standardisierte Datenpriorisierung wird in modernen Konzepten berücksichtigt.
Startfragen
Ob pur IP oder ein Hybrid-System mit analogen Teilbereichen, hängt am Ende immer vom Beobachtungsziel ab. Denn es legt fest, ob nachts, tags, innen oder außen, in dunklen Ecken gefilmt wird. Muss der Beobachter das Bild in Echtzeit sehen, oder interessiert ihn nur der Ereignisfall, wenn sich nachts jemand einer wichtigen Tür nähert? Muss das Personal die Kamera bewegen können, soll ein Bewegungsmelder, ein Türsensor oder ein Mikrophon angebunden werden? Diese Fragen legen am Ende wie in einem Dominoeffekt den Kameratypen, die erforderliche Bildqualität, damit den Codec und die Netzwerk-Bandbreiten fest.
Die erforderlichen Bandbreiten spiegeln das Datenvolumina wider und damit die Belastung für das Netz und teils die Anforderungen an den Storage-Bereich. Bei Echtzeit empfiehlt jeder Hersteller, noch ein separates Netz zu legen, bei großen Daten mit GBit/s-Anschlüssen zum Storage-Sektor. Ob nun das Produktionsnetz oder ein eigenes, die Daten sollten aus Sicherheitsgründen über VLANs getrennt sein. Für eine strengere Segmentierung und geographisch weit entfernte Kameras hat die EDV mit Layer-3-Switches, Remote-Access-Routern, Wireless, SSL und IPsec-VPNs längst entsprechende Konzepte parat. Hierbei ist die IP-Kamera oder der Videoserver nur ein weiterer Endpunkt. Sollen die Daten an mehrere Personen gleichzeitig geschickt werden, setzen die Hersteller von Videoüberwachungsanlagen auf standardisierte IP-Multicast-Verfahren. Damit kann der Administrator seine bekannte Messtechnik und gewohnte Management- und Troubleshooting-Tools weiter verwenden. Denn im Grunde ist auf IP basierende Videoüberwachung ein Heimspiel für jeden IT-Verwalter. Bei der Position der Kameras sowie juristischen Fragen gerade im Zusammenhang mit dem Datenschutz und Fragen der Privatsphäre sollte er sich aber fremde Hilfe holen.
pm@networkcomputing.de