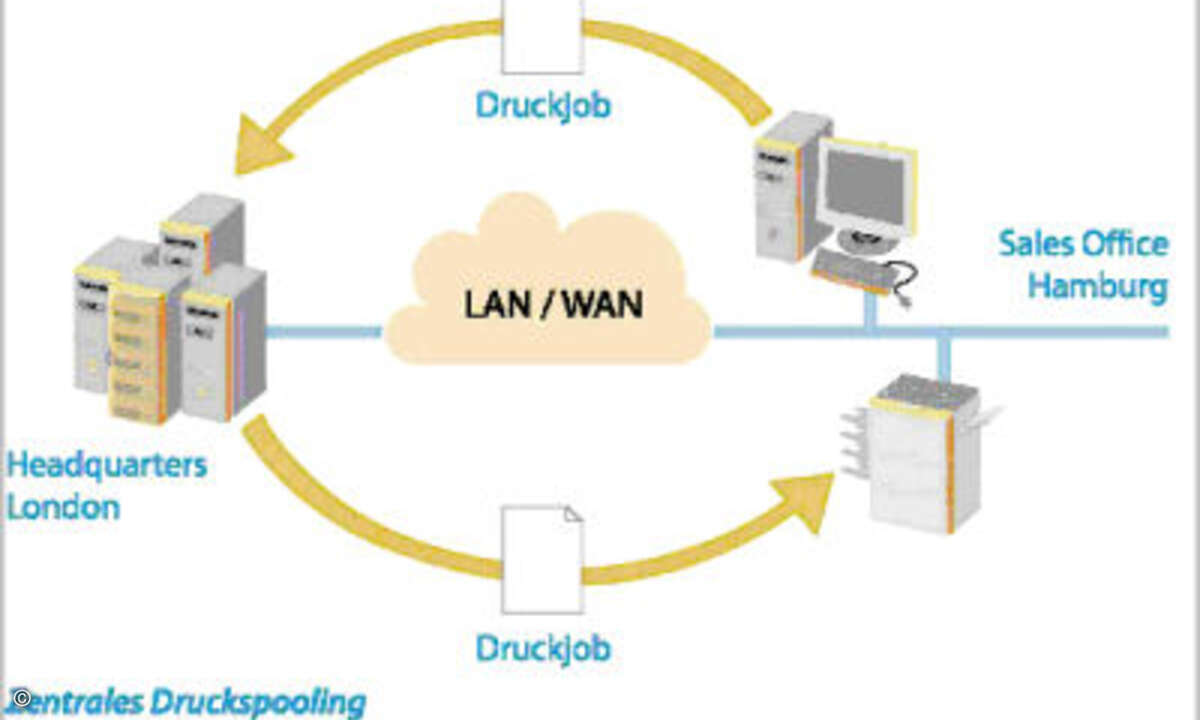Maßgeschneidert und effizient
Appliances – Spezialisierte Lösungen mit Hard- und Software aus einer Hand lösen zunehmend Server mit entsprechenden Applikationen ab. Solche Appliances bieten in vielen Fällen eine attraktive Kosten-Nutzen-Relation.

Die IT war und ist letztlich nie Selbstzweck in den Unternehmen und muss sich gerade in Zeiten eines höheren Kostendrucks ihrer Aufgabe als interner Dienstleister stärker bewusst werden. So besteht ihre wesentliche Rolle darin, die internen Prozesse inklusive der Kommunikation mit externen Beteiligten wie Kunden oder Partnern zu verbessern, Kosten zu senken und damit einen Beitrag zur Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu leisten. Daher lautet eine der zentralen Aufgaben der zuständigen IT-Verantwortlichen, nicht unbedingt State-of-the-Art-Lösungen, sondern vielmehr unter einer ausbalancierten Kosten-Nutzen-Relation die bestmögliche Infrastruktur bereitzustellen.
Dementsprechend wird die allgemeine Diskussion über die IT und ihre Zukunft in den Unternehmen zunehmend von der Wirtschaftlichkeit getrieben. Dazu gehören unter anderem bekannte Stichworte wie SOA, Virtualisierung oder aber der zur Zeit besonders im Fokus der Öffentlichkeit stehende hohe Energieverbrauch von Serverlandschaften. Innerhalb dieser Diskussionen geraten dabei, und dies völlig zu Unrecht, Appliances oftmals aus dem Blickfeld der Beteiligten. Diese bieten sowohl den mittelständischen als auch den Großunternehmen zahlreiche Möglichkeiten, modernste und bewährte Technologien in einer dezidierten und auf das individuelle Aufgabenfeld abgestimmten Form einzusetzen. Daher sollte sich bei jeder Hardware-Neuinvestition der Blick automatisch auch auf Appliances richten. Dies gilt zumindest dann, wenn bei den Investitionskosten mit spitzem Stift gerechnet werden muss.
Technisch up-to-date
Die Grundvoraussetzung für einen Markterfolg von Appliances stellt in erster Linie der Rückgriff auf aktuelle, bewährte und leistungsfähige Technik dar. Die früher anzutreffende Überzeugung, Appliances setzten auf minderwertige, zweitklassige Technologie oder seien in ihrer Haltbarkeit herkömmlichen Servern unterlegen, kann mittlerweile mit Fug und Recht als Mythos bezeichnet werden. Denn beim Einsatz in Appliances kommt schon aus Gründen der Preisgestaltung nur Technologie auf Basis des Industriestandards zum Einsatz.
Dabei handelt es sich augenscheinlich um die selben Produkte – wie die bekannten Prozessor-Baureihen –, die auch in ihren »großen Brüdern« Verwendung finden. Für Appliance-Hersteller muss darüber hinaus jedoch auch der Tatsache Rechnung getragen werden, dass die verwendeten Bauteile innerhalb des erwartbaren Lebenszyklus der Baureihe in der geplanten Stückzahl als Ersatzteile verfügbar bleiben. Betrachtet man dabei die Prozessor-Baureihen, so stehen für den Appliance-Produzenten gesondert getestete Chargen des im OEM-Markt wiederzufindenden Typs bereit.
Im Laufzeitverhalten steht eine Appliance der verwendeten Technik eines herkömmlichen Servers in nichts nach. Ohne Service-Level-Agreements (SLAs) können die mit der Zeit ausgefallenen Komponenten zumeist durch entsprechende Standardprodukte ersetzt werden. Der Interoperabilität mit anderen Hardwareprodukten etwa im Rahmen einer großen Serverfarm oder als integraler Bestandteil einer mittelständischen Infrastruktur steht damit ebenso wenig entgegen, wie der Zukunftssicherheit einer solchen Investition.
Und auch im Worst-Case-Szenario, einem kompletten Ausfall des Systems, erfolgt Dank des Einsatzes von Standardprodukten in der Regel innerhalb von 24 Stunden eine Ersatzlieferung. So zeigt sich an dieser Stelle einer der maßgeblichen Vorteile einer Appliance: ihre im Vergleich größere Variabilität und Wirtschaftlichkeit. Sie kann individuell in genau der Weise zusammengestellt werden, wie es für das jeweilige Einsatzgebiet oder die technischen Rahmenbedingungen erforderlich ist. Dadurch erhält der Anwender ein dezidiertes Gerät, das nur auf das individuelle Szenario hin angepaßt wurde und dessen Komponentenauswahl sich seinen Wünschen und Bedürfnissen anpasst – und nicht umgekehrt.
Darüber hinaus sind Appliances sogenannte Black-Box-Lösungen, die etwa als Ein-Höhen-Gerät passgenau für vorhandene Racks vorkonfiguriert angeliefert werden können und bei deren Einrichtung kein Techniker über einen langen Zeitraum vorgehalten werden muss. Für die weitere Nachbearbeitung beziehungsweise Betreuung einer Appliance ist ebenfalls ein Kostenplus zu verbuchen, ist doch das Vorhalten von speziellem Know-how und teurem Personal nicht erforderlich. So muss etwa bei dem klassischen Einsatzfeld von Appliances als spezifische Security-Lösung nur das jeweils aktuelle Software-Release beziehungsweise ein Update für die Security-Software eingespielt werden. Da die Abstimmung von Hard- und Software bereits bei der Anschaffung für das Kundenszenario vorgenommen wurde, steht einer sofortigen Wiederaufnahme des Produktivbetriebes nichts im Wege.
Appliances können gerade in puncto Kühlung weitere Pluspunkte sammeln, werden doch bei der Planung des Gehäuses Lüftungskanal und Intensität auf die jeweilige Wärmeabgabe des verwendeten Prozessors abgestimmt. Sparsamere Architekturen ermöglichen hier auch die Reduzierung der notwendigen Lüfterleistung und bauen so einer möglichen Überbelastung vor. Sorgfalt ist auch hinsichtlich einer Abstimmung von Interrupted-Requests (IRQs) und IO-Kanälen in Verbindung mit den anzusprechenden IRQs angezeigt – jeder leidgeprüfte Administrator wird ein Lied davon singen können.
Gerade bei der Integration optimierter Spezialkarten sind Fallstricke bei den hierzu erforderlichen Treiberversionen inbegriffen. Betrachtet man die Unterstützung der Multiprozessorfähigkeit, liegt die Herausorderung des Appliance-Produzenten in der Notwendigkeit, alle eingebundenen Funktionseinheiten – wie PCI-Slot-Erweiterungen, analoge Ansteuerung oder RAID-Funktionalitäten – über passende Treiber miteinander in Einklang zu bringen. Dies ist ein ganz und gar nicht trivial lösbares Problem. Fortschrittliche Produzenten bieten neben den oft gegen Aufpreis erhältlichen SLAs bereits integrierte Chipsatzlösungen, die unter anderem eigenständig die Kommunikation zu zentralen Bauteilen überwachen und in Grenzen Fehlfunktionen über spezielle Boot-Prozeduren bereinigen können. Als Folge dieser Möglichkeiten sind dem Einsatzgebiet der Appliances in den Unternehmen neben den klassischen Feldern wie Security- oder E-Mail-Server keine Grenzen gesetzt. So erobern Appliances zunehmend neue Segmente hinzu, ob als Datenbank-, File- beziehungsweise Dokumentenserver oder als Firewall, Router und Kommunikations-Gateway.
Schlanke und leistungsfähige Voice-over-IP
Auf Grund dieser Vorteile hat sich beispielsweise die Networkx entschieden, ihre Serversystemlösung »IPBrick.GT« als Voice-over-IP- und Telefonanlagen-Gateway in Form einer Appliance anzubieten. In der Praxis erhalten die IT-Verantwortlichen nach Definition der gewünschten Performance und der Analyse der gegebenen Infrastruktur eine Appliance, in der die erforderliche Technik ohne Performance-Einbußen in einer kostengünstigen Konfiguration vorinstalliert ist. Die Erfahrungen haben erwiesen, dass für die meisten Einsatzgebiete die Verwendung eines Low-Budget-Prozessors wie des Intel-Celeron-D mit 2.6 GHz, ein Arbeitsspeicher von 512 MByte und eine 80-GByte-Festplatte vollkommen ausreichen. Die Verwendung des preiswerten Celeron-Prozessors verringert in diesem Fall auch das Wärmeproblem in der Appliance, so dass auf den Einbau eines großen Lüfters verzichtet werden kann. Positiver Nebeneffekt dieser Maßnahme: Eine solche Konfiguration ermöglicht eine kompakte Bauweise in 19-Zoll und kann so platzsparend als Stand-alone-Gerät oder in den gängigen Racks betrieben werden.
Trotz dieser auf den ersten Blick sparsamen Hardware-Konfiguration ist ein solches Gateway in der Lage, die komplette Telefonie mittelständischer Unternehmen mit mehreren Hundert parallel geschalteten Leitungen abzudecken. Der Einbau der entsprechenden Interface-Karte zur klassischen PBX und der Karten, die eine Kombination unterschiedlicher Bus-Techniken bereit stellen, genießt eine gegenüber den anderen Komponenten höhere Priorität. Denn genau diese Produkte entscheiden über Einsatz- beziehungsweise Leistungsfähigkeit einer solchen Lösung und sollten daher mit der gebotenen Aufmerksamkeit ausgewählt werden.
Hinsichtlich der Total-Cost-of-Ownership einer VoIP-Lösung sollten gerade die Administrationskosten nicht aus dem Auge verloren werden, wie rückblickend die auf dem H.323-Standard aufsetzenden Lösungen gezeigt haben. Sicherlich spielt hier das international standardisierte SIP seine Vorzüge aus: Es ist einfach und leicht zu routen und eröffnet Real-Time-Protokollen nach dem initialen Session-Aufbau auch die Verwendung von Proxy-Gateways. Gerade die Anpassung vorhandener Firewall-Systeme wird von der Verringerung der zu berücksichtigenden Port-Anzahl profitieren. Nicht nur das Logging auf den hauseigenen Netzübergängen, auch die Kontrolle bei den zunehmend attraktiver werdenden SIP-Providern wird die Einbindung des VoIP-Services in den ausgereiften und eingeführten DNS-Dienst vereinfachen. Über statische IP-Adressen sind Spoofing-Attacken, die zwangsläufig zu abrechnungsrelevanten Mehrkosten beim Kunden führen, System-immanent ausgeschlossen. Den Vergleich zum proprietären Skype-Ansatz braucht eine solche Geschäftskunden-taugliche SIP-Lösung nicht mehr zu scheuen, bietet sie – Dank Standard – auch die Integration mehrerer voneinander unabhängiger Provider.
Schließlich garantiert eine derartige VoIP-Lösung die gesicherte Übertragung der VoIP-Sprachdaten über definierte VPN-Tunnel und entkoppelt die ISDN-Anbindung einer vorhandenen klassischen Telefonanlage. Alle Ausgangs- und Eingangsgespräche können über das Web oder über die ISDN-Leitung in das Telefonnetz in klassischer IT-Manier geroutet werden. Letztlich sind der Skalierbarkeit einer solchen Appliance-basierten Lösung keine Grenzen gesetzt. Wächst die Zahl der Mitarbeiter in den Unternehmen über die zur Verfügung stehende Kapazität hinaus, so kann durch den Einsatz einer weiteren kostengünstigen Appliance das Gateway den wachsenden Ansprüchen angepasst werden. Einzige technische Voraussetzungen für den weiteren Ausbau sind die entsprechende Bandbreite der Datenleitung und eine ausreichende Zahl von ISDN-Kanälen.
Appliances können folglich beim Aufbau einer qualitätsgesicherten, kostengünstigen IT-Infrastruktur und im Wettbewerb mit ihren »großen Brüdern« problemlos bestehen. Auf Grund der Möglichkeit, sie individuell und Aufgaben-spezifisch auszugestalten, bieten sie zahlreiche Vorteile, was ihre Zukunftsfähigkeit, Konfiguration und Leistungsfähigkeit anbetrifft. Gerade vor dem Hintergrund abnehmender IT-Budgets und begrenzter Ressourcen in den Unternehmen wird ihre Marktposition in weiten Teilen der IT sicherlich steigen oder anders gesprochen – die Hardware-Zukunft in der IT ist ohne Appliances schlichtweg nicht vorstellbar.
Ralf Zerres,
Geschäftsführer Networkx