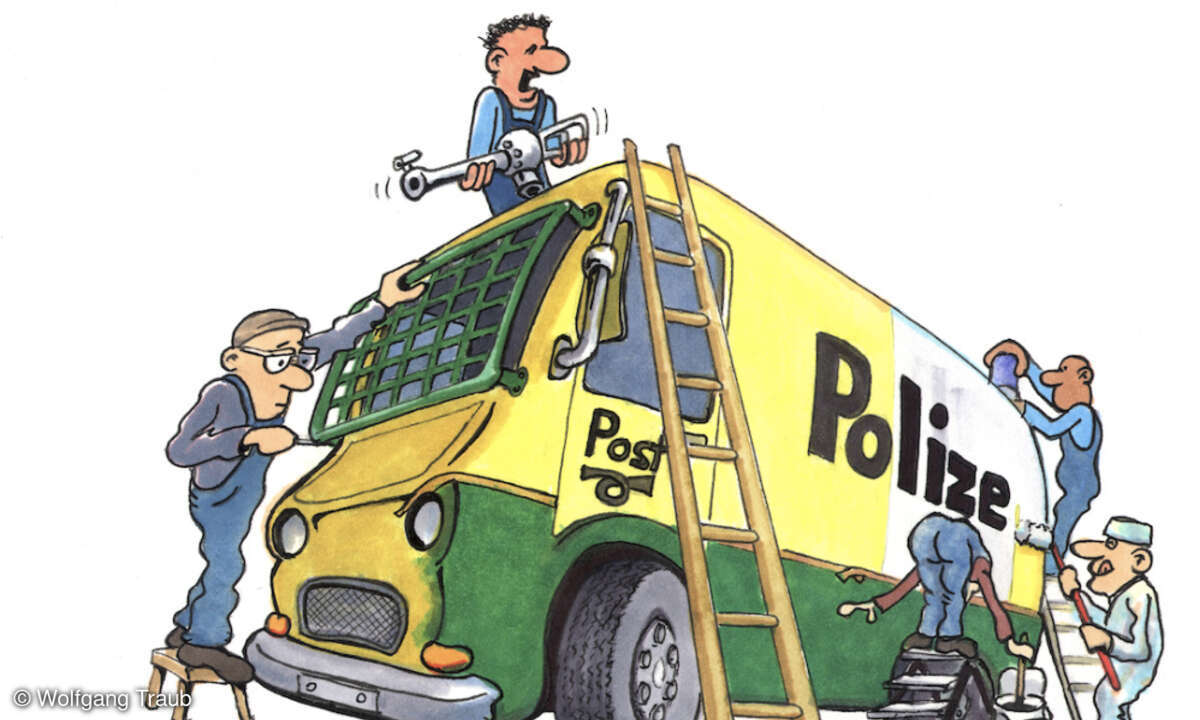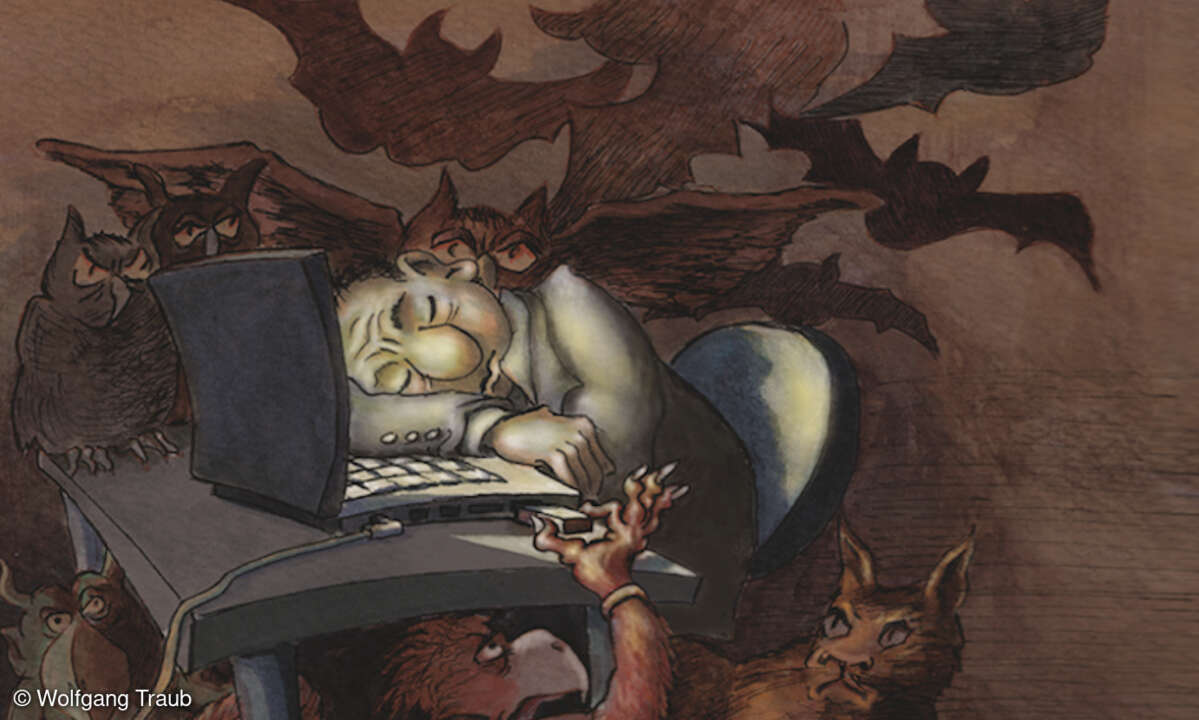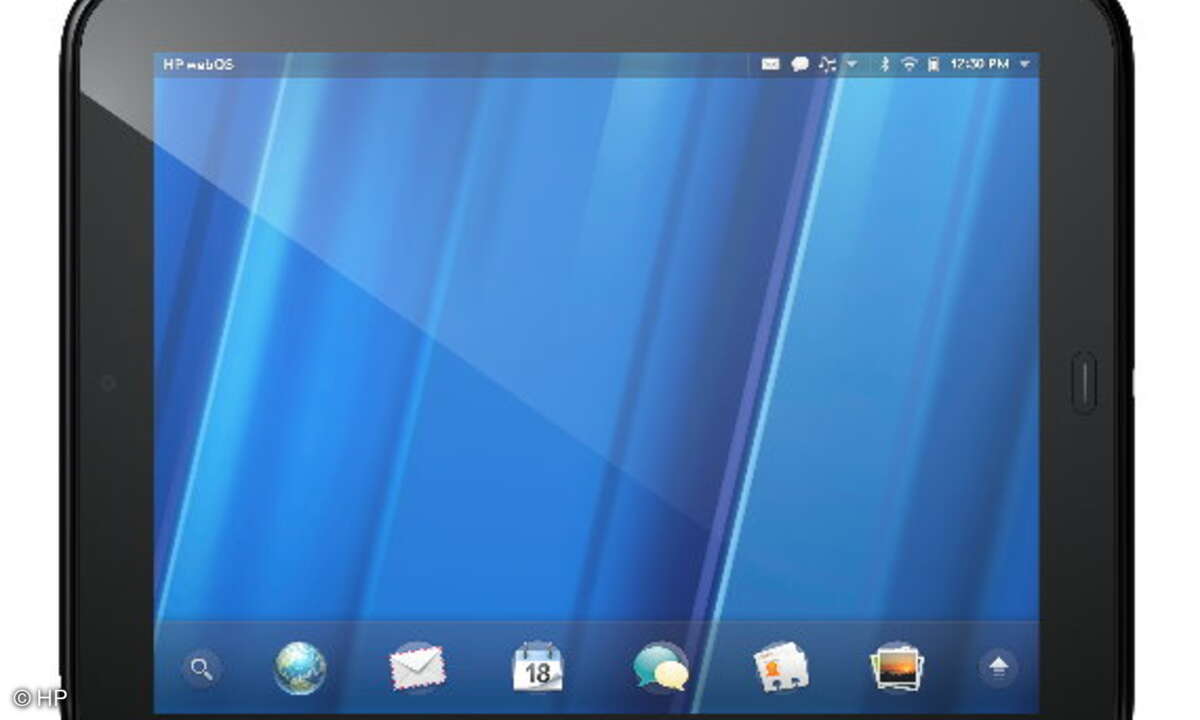Vorsorgepflicht des Anbieters
- Prüfungspflichten von Portalbetreibern
- Datenschutz schützt Täter
- Vorsorgepflicht des Anbieters
In einem Urteil vom 19.April 2007 hat der Bundesgerichtshof (Az. I ZR 35/04 – »Internet-Versteigerung II«) nun etwas konkreter hierzu Stellung genommen. Danach müsse beim Ebay-Angebot von Luxusuhren der Diensteanbieter (also Ebay) nicht nur das konkrete Angebot sperren, sondern »Vorsorge treffen, dass es bei den Angeboten derartiger Uhren nicht zu weiteren klaren Rechtsverletzungen kommt.« Dabei sei zu beachten, dass dem Diensteanbieter auf diese Weise keine unzumutbaren Prüfungspflichten auferlegt werden dürften, die das gesamte Geschäftsmodell infrage stellen würden. Unstreitig könne sich der Diensteanbieter aber »jedenfalls in gewissem Umfang einer Filtersoftware bedienen, die durch Eingabe von entsprechenden Suchbegriffen Verdachtsfälle aufspürt, die dann gegebenenfalls manuell überprüft werden müssen.« Die Grenze des Zumutbaren sei dabei jedenfalls dann erreicht, wenn »keine Merkmale vorhanden sind, die sich zur Eingabe in ein Suchsystem eignen«. Leider belässt es der Bundesgerichtshof bei diesen abstrakten Ausführungen. Das ist gerade für diesen konkreten Fall zu bedauern, weil der Bundesgerichtshof an anderen Stellen des Urteils auf eine alltägliche Problematik bei Internetversteigerungen hinweist: Eine Markenrechtsverletzung liegt nämlich in der Regel nur dann vor, wenn der Verkäufer »im geschäftlichen Verkehr gehandelt« hat. Wie soll aber ein Filter überprüfen können, ob das konkrete Angebot von einem gewerblichen oder nicht gewerblichen Verkäufer online gestellt wird? Zwar führt der Bundesgerichtshof aus, dass in Fällen, in denen ein Anbieter wiederholt mit gleichartigen, insbesondere auch neuen Gegenständen handelt oder in denen er von ihm zum Kauf angebotene Gegenstände erst kurz zuvor erworben hat, vieles für ein Handeln im geschäftlichen Verkehr spreche. Wie ein Web 2.0-Plattformprovider derartige Merkmale im Vorfeld einer künftigen Rechtsverletzung aber über einen Filter erkennen können soll, beantwortet der Bundesgerichtshof leider nicht. So bleibt der Umfang der Prüfungspflichten in den zahlreichen derzeit anhängigen Verfahren bei den Instanzgerichten weiter nicht eindeutig geklärt – in rechtlicher Hinsicht bleibt in Sachen Web 2.0 also vieles in Bewegung.
Dr. Hermann Lindhorst ist Rechtsanwalt bei CMS Hasche Sigle in Hamburg