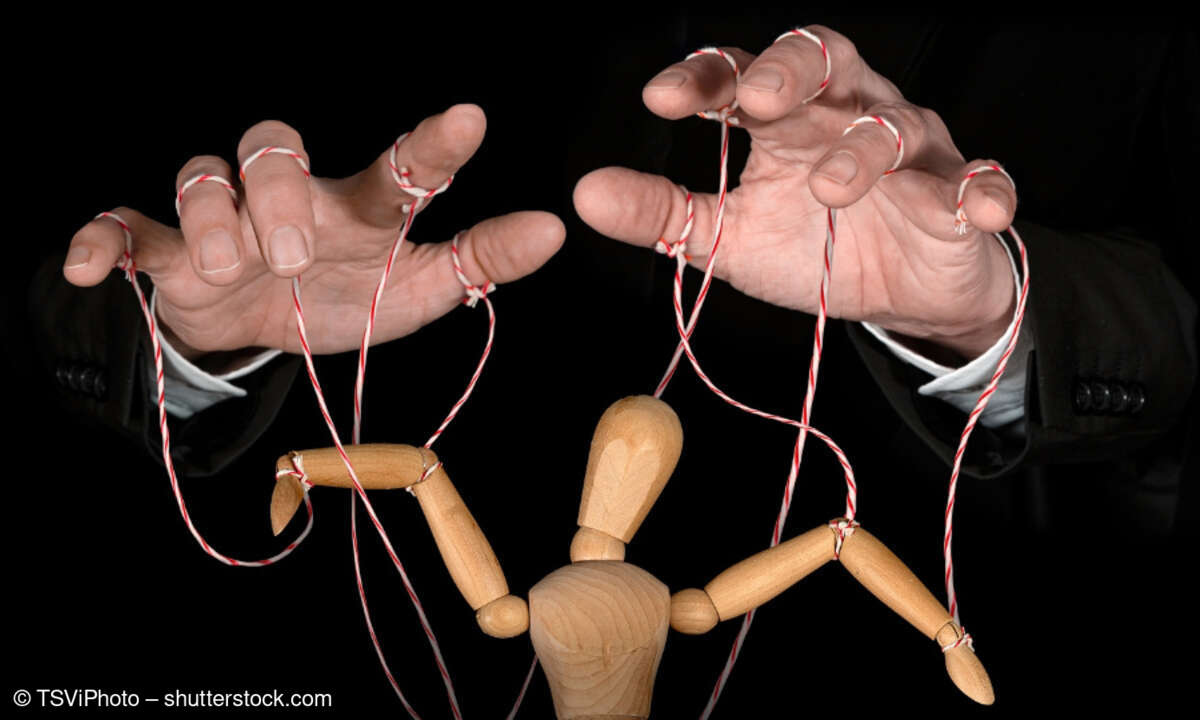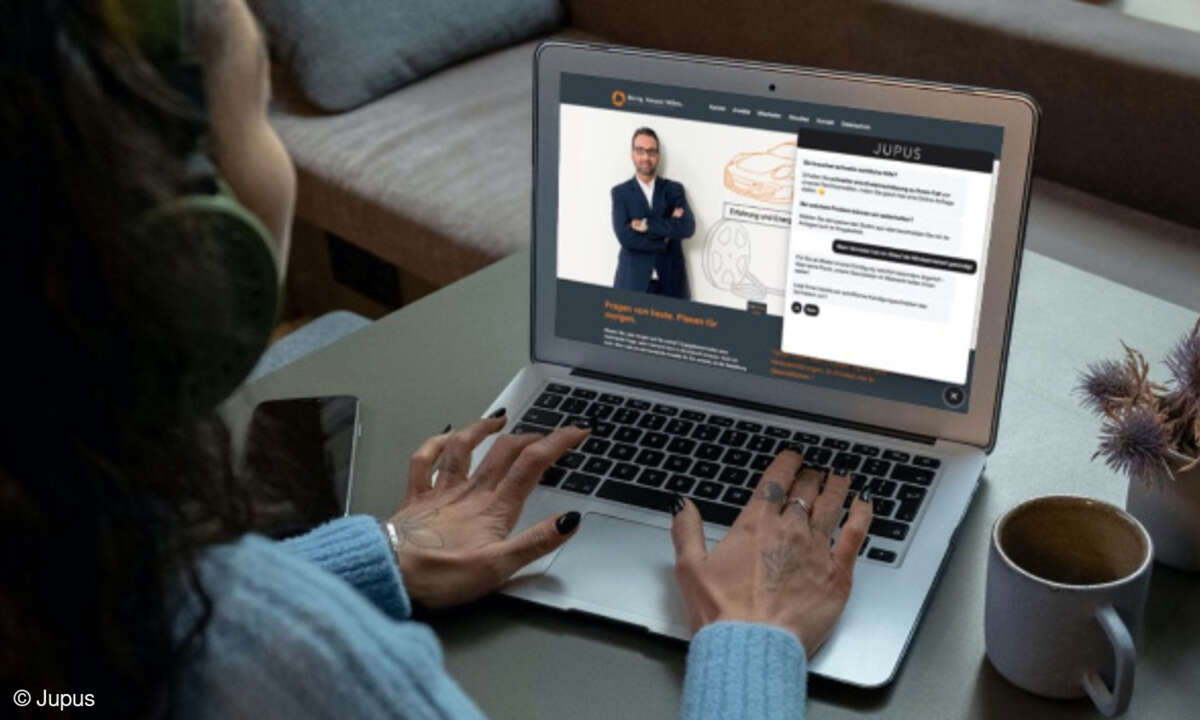Rechte und Pflichten für Opensource-Nutzer - Teil 2
Rechte und Pflichten für Opensource-Nutzer - Teil 2. Viele IT-Unternehmen schätzen an Opensource-Software (OSS) die wirtschaftlichen Vorteile: Der Nutzer erhält die Programme nicht nur vermeintlich »geschenkt«, er hat sogar das Recht, diese beliebig oft zu kopieren, für eigene Zwecke zu verändern und ? so scheint es zumindest ? ohne Beschränkungen weiterzuverteilen. Diese Vorstellung entspricht aber nicht der tatsächlichen Rechtslage und kann zu urheberrechtlichen Haftungsfällen und hohen Schadensersatzforderungen führen.
Rechte und Pflichten für Opensource-Nutzer - Teil 2
Autor: Dr. Jyn Schultze-Melling/
Wie weit die Idee von kostenloser und zumindest vom Namen her freier Software von der Realität abweicht, wird schnell ersichtlich, wenn man sich mit den vielen unterschiedlichen Opensource-Lizenzen näher auseinandersetzt. Die älteste und weitestverbreitete Opensource-Lizenz ist die GNU General Public License (GPL). Formuliert von Richard Stallman, dem Gründer des GNU-Projektes, und dem Rechtsprofessor Eben Moglen, wurde die GPL 1989 zum ersten Mal veröffentlicht.
Opensource-Software als Anwendung
Sie ist damit der Ursprung aller heutigen Opensource-Lizenzen und stellt auch die wohl striktesten Anforderungen an ihre Nutzer. Die in ihr festgehaltenen Pflichten machen schnell deutlich, dass Opensource-Software mitnichten ein rechtsfreies Gut ist, sondern ihre Benutzung an die strikte Einhaltung verschiedener Pflichten geknüpft ist.
Die Nutzer von Opensource-Software lassen sich grob in zwei Gruppen einteilen. Auf der einen Seite stehen die reinen Endnutzer, die sich schlicht Software wünschen, die möglichst kostengünstig und dabei sicher ist. Diese Nutzer haben meist kein Interesse daran, den Sourcecode der Software einzusehen oder diesen selbst zu verändern. Diesen Nutzern räumt die GPL ein einfaches, nicht ausschließliches Nutzungsrecht im Sinne des § 31 Abs. 2 UrhG ein. Hierbei bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich der Art der Nutzung, ihrer Dauer oder des Nutzungsortes. Lediglich die rechtliche Haftung des Erstellers ist im Interesse dessen Schutzes vor rechtlichen Konsequenzen seiner Entwicklerarbeit ausgeschlossen.
Der Vertrieb von Opensource-Software
Dem gegenüber steht die Gruppe von Nutzern, deren Interesse an Opensource-Software zumindest auch darin besteht, diese in eigene Softwareprojekte zu integrieren, oder die Programme zu eigenen Zwecken weiterzuentwickeln und hierbei zum Beispiel an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Softwarehersteller oder Systemhäuser verwenden heute vielfach Opensource-Software, um ihren Kunden kostengünstige Produkte anbieten zu können. Auch eine ganze Reihe von Herstellern von Netzwerk-Hardware (Router, Firewalls, etc.) haben mittlerweile die Vorzüge von Opensource-Software für sich entdeckt. Für diese Nutzer von Opensource-Programmen, die ihre selbst weiterentwickelten Produkte anschließend weiterverteilen wollen, gelten spezifische Pflichten.
Die gute Nachricht ist zunächst, dass es die GPL grundsätzlich erlaubt, das jeweilige Programm zu vervielfältigen und diese Kopien weiterzuverteilen. Entgegen der landläufigen Meinung ist dies auch gegen Entgelt möglich ? Opensource-Software muss nicht zwingend kostenlos sein. Die GPL sieht in § 1 sogar ausdrücklich vor, dass für den eigentlichen Kopiervorgang eine Gebühr verlangt werden darf. Wer dies gerne möchte, darf zudem auch gegen entsprechendes Entgelt eine Garantie für das jeweilige Opensource-Programm anbieten. Der Nutzer ist bei der Verbreitung der Software aber immer verpflichtet, neben den entsprechenden Urhebervermerken und einem GPL-konformen Haftungsausschluss eine Kopie der GPL selbst und den vollständigen, maschinenlesbaren Sourcecode beizulegen.
Übrigens: Wer den Sourcecode des Programms, aus welchen Gründen auch immer, nicht von vorneherein mitliefern mag, muss diesen zumindest für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren auf Nachfrage zur Verfügung stellen oder zumindest ein entsprechendes Angebot eines Dritten vorweisen können.
Die Arbeit mit Opensource-Software
Die GPL erlaubt nicht nur die Weitergabe von Opensource-Programmen. Das Opensource-Modell basiert darauf, dass jeder Nutzer diese Programme auch selbst weiterentwickeln dürfen soll. Es ist daher unter der GPL erlaubt, den Sourcecode der Software zu verändern oder in eigene Projekte zu integrieren. Selbstverständlich darf dann auch diese modifizierte Version des Programms vervielfältigt und verbreitet werden. Die GPL legt dafür jedoch sehr enge Rahmenbedingungen fest. Die wichtigste und für den jeweiligen Programmierer wohl entscheidende ist: Die neue Software darf grundsätzlich wiederum nur als Opensource-Software unter der GPL lizenziert werden. Bei eigenen Projekten, bei denen zumindest teilweise Opensource-Software verwendet wird, bedeutet dies in der Praxis, dass man seine Software zur allgemeinen Verwendung und Weiterverbreitung freigibt. Ausnahmen bestehen nur, wenn die proprietären Teile eigenständig sind und sich funktional vom Rest der Lösung trennen lassen. Ob und wann dies jedoch der Fall ist, ist bislang noch völlig ungeklärt und ? gerade im Zusammenhang mit Linux-Kernel-Modulen ? Gegenstand erbitterter Debatten in der Opensource-Community.
Wird Opensource-Software nicht als Ganzes in eine Lösung integriert, sondern lediglich verändert oder modifiziert, müssen die jeweiligen Änderungen im Sourcecode hervorgehoben und das Programm mit einem entsprechenden Hinweis versehen werden. Dieser Hinweis muss neben einem Copyright-Vermerk, einen Haftungsausschluss und auch die Belehrung enthalten, dass die Software nur unter den Bedingungen der GPL weitergeben werden darf.
Gibt jemand die Opensource-Software ausschließlich im Objektcode weiter, so hat er noch zusätzliche Anforderungen zu erfüllen. Der Software muss dann ein gesonderter Hinweis beigelegt werden, der auf die GPL verweist und die entsprechenden Informationen (Copyright und Haftungsausschluss) trägt. Im Hinblick auf den Sourcecode hat der Benutzer wiederum die Wahl, entweder diesen auf einem gesonderten Datenträger beizulegen, oder ihn zumindest während eines Zeitraumes von mindestens drei Jahren auf Nachfrage zur Verfügung zu stellen.
Diese Zusatzanforderungen treffen insbesondere die Anbieter von Linux-basierenden Embedded-Systemen. Wer zum Beispiel unter Zuhilfenahme von freier Software Netzwerk-Router oder Firewalls herstellt, muss seinen Produkten nicht nur die GPL beilegen und auf ihnen einen entsprechenden Hinweis anbringen, sondern zudem auch entweder den vollständigen Sourcecode der Firmware beilegen oder diesen zumindest über die Homepage zum Download anbieten.
Bei der Nutzung freier Software wird häufig gegen die Bestimmungen der zugrunde liegenden Lizenzen verstoßen. Oft sind sich die Nutzer dabei aber nicht über die möglichen Konsequenzen eines Verstoßes gegen die GPL im Klaren. Entschließt sich ein Programmierer, seine Software unter die GPL zu stellen, so verzichtet er nicht auf seine Urheberrechte. Er hat noch immer das Recht, dafür zu sorgen, dass seine der Allgemeinheit zur Verfügung gestellte Software auch wirklich frei bleibt, sich also niemand auf seine Kosten bereichert. Dafür sorgt die GPL.
Hohe Haftungsrisiken
Verstößt ein Benutzer von Opensource-Software gegen die Bestimmungen der Lizenz, erlischt sofort automatisch sein Recht, die Software weiter zu nutzen. Jede weitere Nutzung bedeutet also eine Urheberrechtsverletzung. Der Programmierer der Software kann nun nicht nur nach deutschem Urheberrecht auf Unterlassung der Nutzung klagen, sondern zusätzlich auch noch Auskunfts- und Schadenersatzansprüche geltend machen.
Dieses Risiko ist spätestens seit dem letzten Jahr sehr real. Am 19.5.2004 billigte das Landgericht München I dem Programmentwickler der Opensource-Firewallsoftware »netfilter-iptables« einen Unterlassungsanspruch gegen einen Hersteller von Routern zu, deren Firmware unter anderem den Sourcecode von »netfilter-iptables« enthält. Der Hersteller hatte weder darauf hingewiesen, dass die entsprechende Firmware Opensource-Programme enthält, noch hatte er den Lizenztext der GPL oder den Sourcecode der Firmware beigelegt. In der schriftlichen Begründung zu seinem Urteil (Az. 21 O 6123/03) erklärte das Landgericht die GPL in Deutschland grundsätzlich für rechtswirksam. Damit wurde die GPL erstmals weltweit von einem Gericht bestätigt. Obwohl diese Entscheidung aus rechtlicher Sicht durchaus angreifbar ist, gilt: Nutzer von Opensource-Software müssen zukünftig mit gerichtlichen Konsequenzen rechnen, wenn sie Bestimmungen von Opensource-Lizenzen missachten.
_____________________________________________
CRN-Serie zu Opensource
Die in Heft 33 begonnene vierteilige Beitragsreihe setzt sich anhand der GNU General Public License mit den Rechten und Pflichten bei der Nutzung von Opensource-Software auseinander. Im ersten Teil ging es um GLPG, BSD, Mozilla, Darwin. Er ist unter der URL https://www.connect-channel.de/ cms/10562.0. html auffindbar.
Der Autor, Dr. Jyn Schultze-Melling, ist Rechtsanwalt und Spezialist für IT-Recht bei der Anwaltskanzlei Nörr Stiefenhofer Lutz.