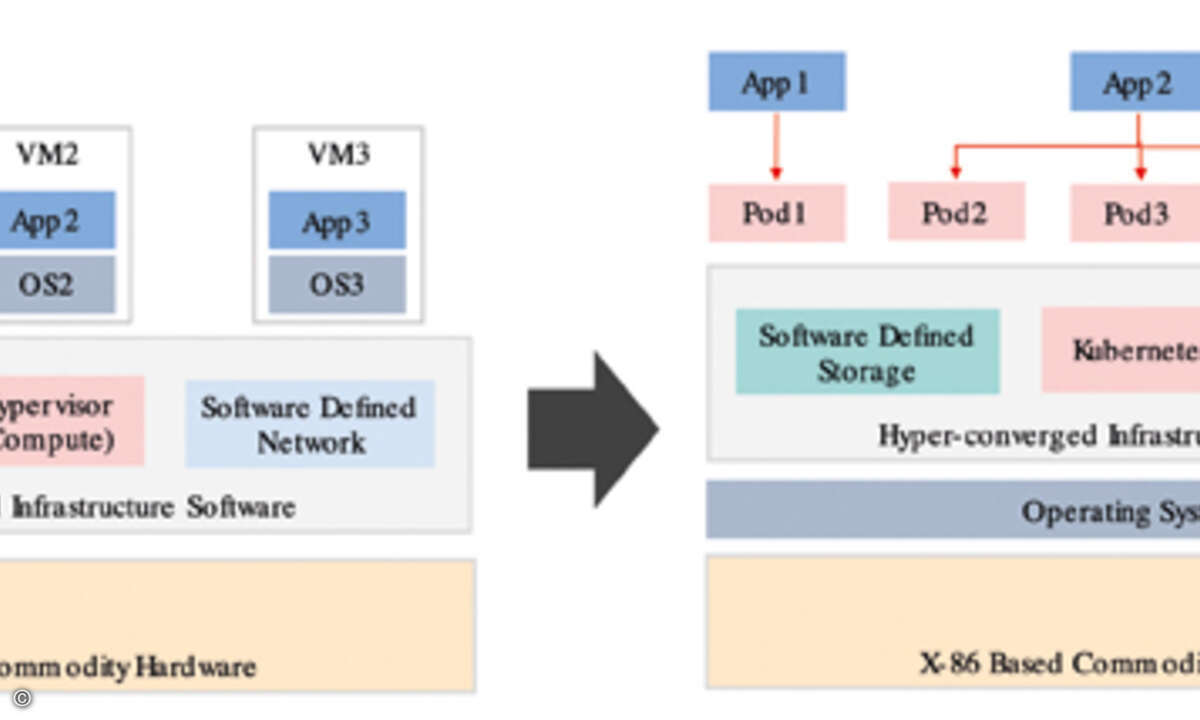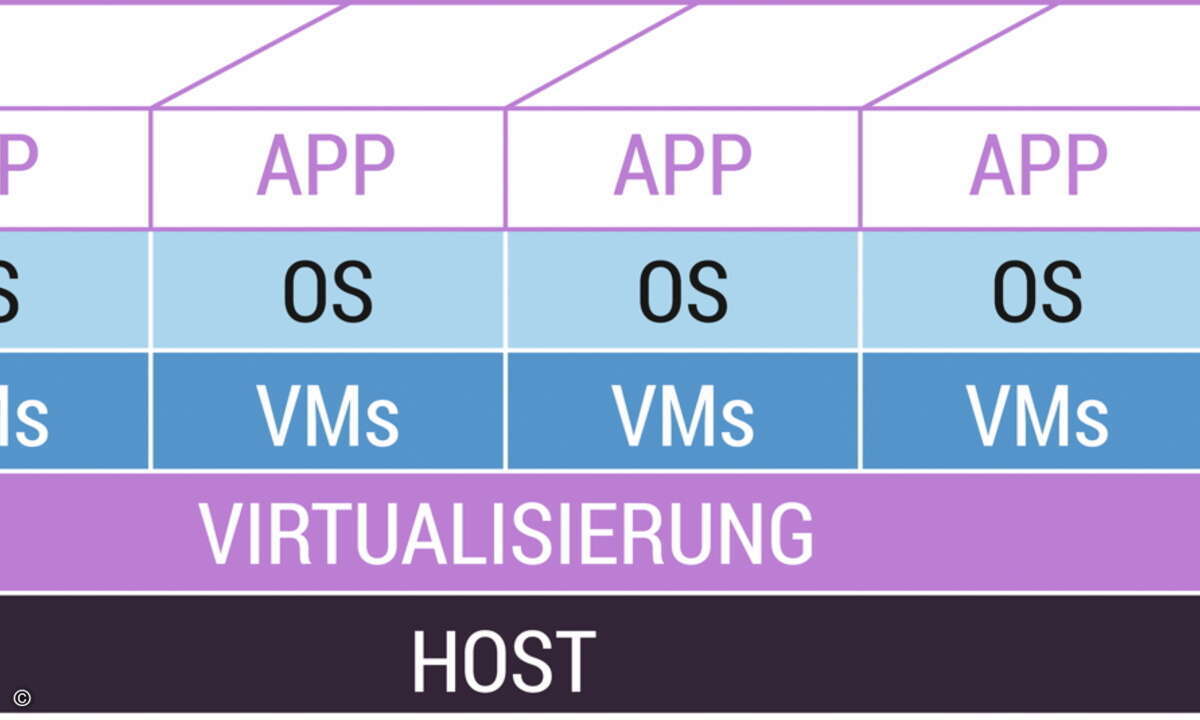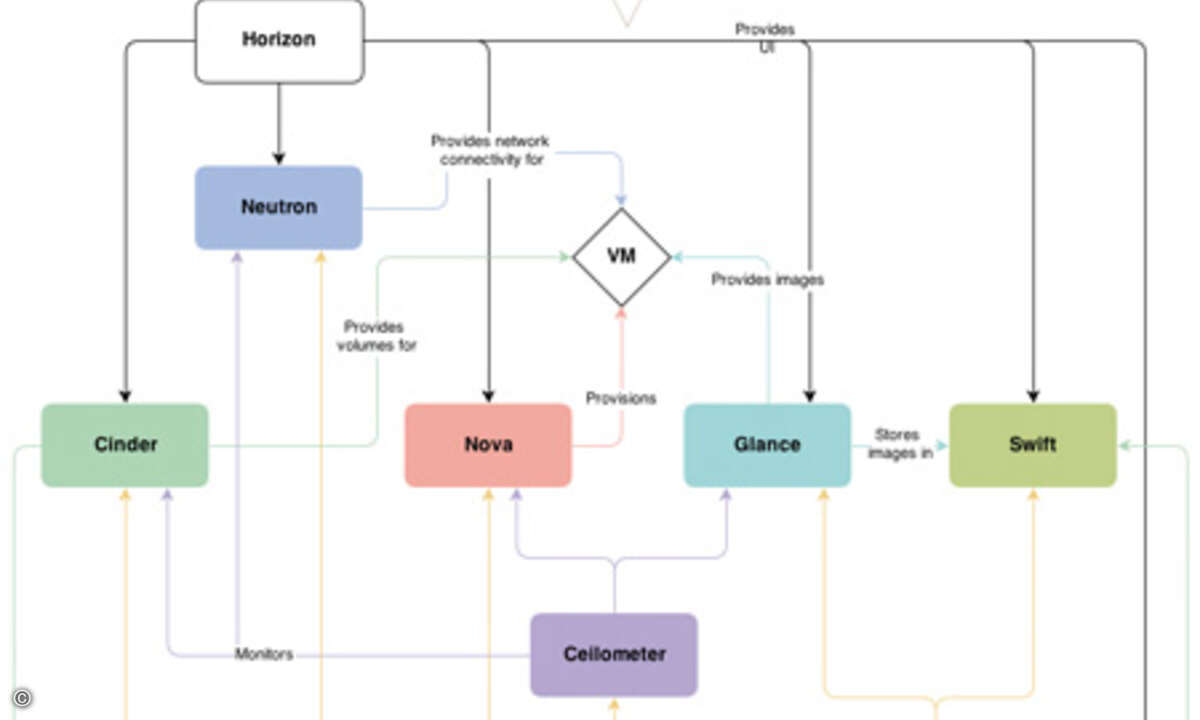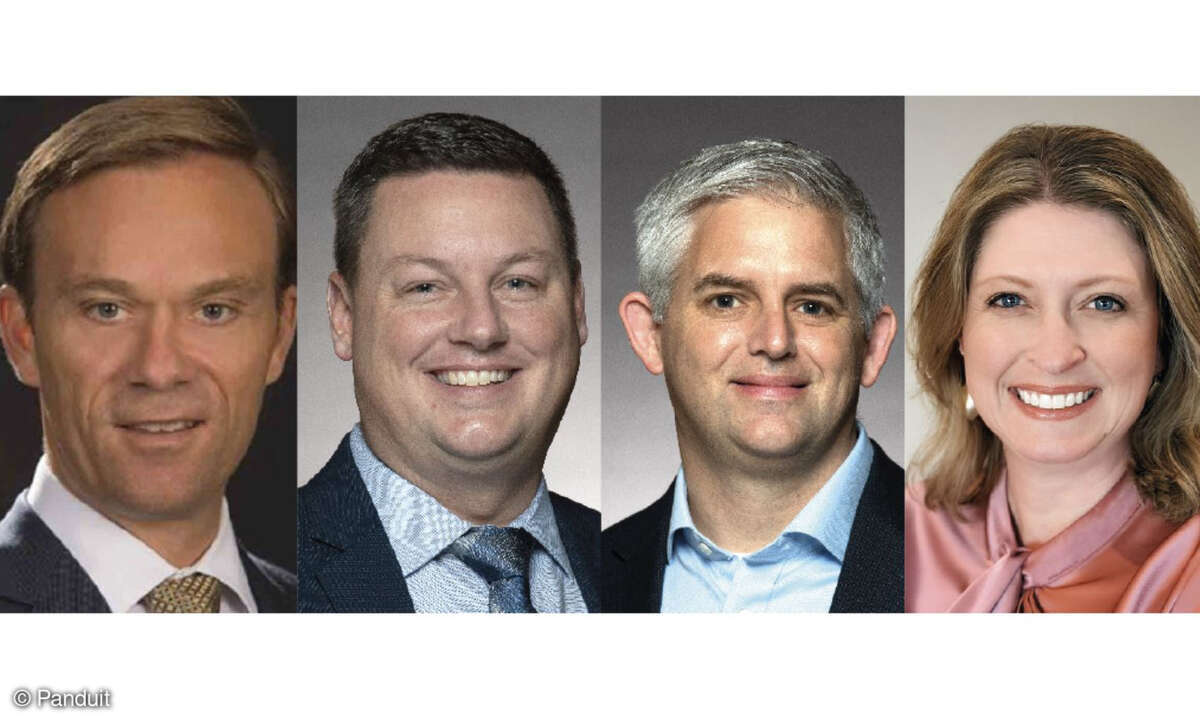Nach dem GAU schnell wieder einsatzbereit
Mit einer virtualisierten Infrastruktur können Unternehmen ihre IT-Umgebungen einfach und flexibel konsolidieren. Ergänzt um die Replikationssoftware von Storage-Systemen, ermöglicht die Virtualisierung zudem eine automatische und zuverlässige Lösung für das Disaster Recovery. Der Beitrag zeigt am Beispiel von Dell und VMware, wie Hardware, Software und die Vernetzung zusammenwirken. iSCSI soll dann vor allem im Mittelstand seine Vorteile ausspielen.
Der GAU ist jederzeit möglich: Ein Schwelbrand reicht schon aus, um die Infrastruktur im
Rechenzentrum lahm zu legen. Nicht weniger dramatisch sind die Folgen von Hochwasser, wenn
Server-Räume überschwemmt werden. Wer glaubt, dies könne so schnell nicht passieren, sollte sich an
das Alpen-Hochwasser im August 2005 erinnern. In der Schweiz mussten Kraftwerke stillgelegt und
Stromleitungen aus Sicherheitsgründen abgeschaltet werden. Weil sie schlecht vorbereitet waren,
entstanden bei einer ganzen Reihe von Unternehmen massive Schäden. Ähnlich leidvolle Erfahrungen
machten auch die Einwohner von Dresden beim Elbe-Hochwasser im August 2002.
Vor allem mittelständische Unternehmen sind kaum auf solche Situationen vorbereitet. Die
Stichworte lauten hier Disaster Recovery und Business Continuity. Aufgabe von Disaster Recovery ist
die Wiederherstellung und der Ersatz zerstörter IT-Infrastruktur sowie der unternehmenskritischen
Daten. Business Continuity ist umfassender und befasst sich nicht nur mit den technischen Fragen
der IT-Rekonstruktion. Aufgabe von Business Continuity ist es, dass wichtige Geschäftsprozesse
selbst im Katastrophenfall nicht oder nur kurzfristig unterbrochen werden und die wirtschaftliche
Existenz des Unternehmens gesichert bleibt.
Das oberste Ziel von Business Continuity: So wenig Ausfallzeit wie möglich. Dies gilt nicht nur
für den Fall von Katastrophen, sondern auch für geplante Zeiten des Stillstands. Viele der
Verfahren und Prozesse, die dabei zum Einsatz kommen, lassen sich leicht modifiziert und erweitert
auf die Aufgaben von Disaster Recovery übertragen. So nutzen bei geplanten Zeiten des Stillstands
in virtualisierten Infrastrukturen Administratoren die systematische Abschaltung einzelner Server
und Storage-Systeme etwa für Updates von Betriebssystemen, Applikationen oder Hardware. In
Server-Farmen mit Dell-Hardware kommt dazu beispielsweise vielfach VMware, VMotion und DRS
(Distributed Resource Scheduler) zum Einsatz. DRS überwacht den Nutzungsgrad von Ressourcen-Pools
und weist verfügbare Ressourcen zwischen virtuellen Maschinen zu. Sind die Ressourcen einer
virtuellen Maschine zu stark beansprucht, macht das System zusätzliche Kapazität verfügbar, indem
im laufenden Betrieb virtuelle Maschinen mit VMotion auf einen anderen physischen Server migrieren.
VMotion sorgt damit für eine ausgeklügelte Verwaltung der Auslastung, indem es dynamische
Veränderungen zulässt, die den Arbeitsablauf nicht stören. Der wichtigste Aspekt dabei heißt "
unterbrechungsfrei". Mit VMware soll es möglich sein, eine virtuelle Maschine zu portieren, ohne
den laufenden Betrieb zu unterbrechen. Bei anderen Lösungen geht es oft nicht ganz
unterbrechungsfrei. Zu den Techniken, die bei ungeplanten Ausfallzeiten zum Zuge kommen, zählen
Clustering und SAN-Replikation sowie gespiegelte Server und Storage-Systeme in räumlich getrennten
Rechenzentren – und die braucht man für Disaster Recovery auf jeden Fall.
Planung für den Notfall
Für Mittelständler stellt sich die Frage: Wie soll man das Problem Disaster Recovery angehen?
Welche Technik passt? Auch wenn die IT-Infrastruktur im Vergleich zu großen Unternehmen
überschaubar ist, besteht zunächst einmal die Herausforderung, einen Notfallplan zu entwickeln und
in regelmäßigen Abständen zu testen. Ein typischer Disaster-Recovery-Plan enthält Hunderte von
Einzelschritten, angefangen von den Veränderungen bei der Verkabelung bis zu einer detaillierten
Beschreibung, in welcher Reihenfolge die Server hochgefahren werden.
Mit einem Plan allein ist es jedoch nicht getan, er muss in regelmäßigen Tests seine
Tauglichkeit unter Beweis stellen. Individuell entwickelte Maßnahmen und Handlungsanweisungen
erfordern in der Regel viele komplexe, manuelle Schritte zur Bereitstellung von Ressourcen, der
Wiederherstellung von Betriebssystemen und Daten sowie der Überprüfung der Betriebsbereitschaft von
Servern, Netzwerkkomponenten und Storage-Systemen. Statt selbstgestrickter Lösungen bietet sich
auch hier die Nutzung einer virtuellen Infrastruktur an, kombiniert mit spezieller Backup- und
Recovery-Software.
Gemeinsam genutzter Speicher gehört zu den zentralen Komponenten einer virtuellen Infrastruktur.
Das Ziel: sowohl sichere, robuste und redundant gespeicherte lokale Daten als auch erreichbare,
doppelt vorhandene, an einem zweiten Ort untergebrachte Speicherkapazitäten. Ein großes
Funktionsspektrum erlaubt es dann, effiziente Remote-Datenreplikationen, Disaster-Recovery-Prozesse
und sekundäre Speicherorte zu managen.
Mittelständler, die ein iSCSI-Storage-SAN im Einsatz haben, profitieren von
Remote-Datenreplikationen. Denn derartige SANs benötigen kein aufwändiges und oft teueres
Fibre-Channel-Equipment, wie es in großen Rechenzentren zum Einsatz kommt. Bei iSCSI genügt die
meist bereits vorhandene Ethernet- und IP-Netzinfrastruktur. Die Integration des iSCSI-Initiators
in den ESX-Server-Kernel sorgt dabei für einen nativen Zugriff auf das iSCSI-Storage-SAN. Durch die
Kombination von Virtualisierung und iSCSI erweitern sich zugleich die potenziellen Einsatzgebiete
beispielsweise in kleinen und mittleren Unternehmen.
Ein schnelles, zuverlässiges und möglichst einfach administrierbares Disater Recovery wird durch
eine Verzahnung von Speicherreplikationssoftware, wie sie beispielsweise die
Equallogic-iSCSI-Arrays bieten, und dem Site Recovery Manager von VMware Infrastructure möglich.
Unternehmen können so die Ausfallrisiken reduzieren und den Schutz auf alle wichtigen Systeme und
Applikationen ausdehnen. Eine derartige Lösung erfordert jedoch, dass sowohl am primären als auch
am Recovery-Standort iSCSI-Arrays und die Virtualisierungssoftware installiert sind.
IT-Administratoren erhalten mit einer solchen Paketlösung eine Anleitung, die in einfachen
Schritten erläutert, wie eine Verbindung vom eigenen Rechenzentrum zu einem entfernten Standort –
an dem sich die gesicherten Applikationen und Daten befinden – und der verwendeten
Replikationssoftware hergestellt wird. Auch die Zuordnung von Produktionsressourcen –
einschließlich Server- und Netzwerkressourcen – zu den entsprechenden Ressourcen am
Recovery-Standort ist dort beschrieben.
Ist die Disaster-Recovery-Infrastruktur einmal eingerichtet, besteht einer der nächsten Schritte
darin, Recovery-Pläne für verschiedene Szenarien und unterschiedliche Teile der Infrastruktur zu
erstellen, bei Bedarf zu aktualisieren und zu dokumentieren. Die Disaster-Recovery-Pläne werden
damit zu einem festen Bestandteil der Administration einer virtualisierten IT-Infrastruktur.
Administratoren können beispielsweise festlegen, dass virtuelle Maschinen ihren Betrieb
unterbrechen oder heruntergefahren werden, um Ressourcen für das Disaster Recovery freizumachen.
Definieren lässt sich auch die Reihenfolge, in der virtuelle Maschinen eingeschaltet werden,
außerdem die automatische Ausführung benutzerdefinierter Skripts und der Punkt, an dem der
Recovery-Prozess unterbrochen wird, wenn etwas schief läuft.
Snapshot-Funktionen
Recht hilfreich ist in diesem Zusammenhang die Erstellung einer isolierten Testumgebung. Dort
kommen dann die Snapshot-Funktionen der iSCSI-Speicher-Arrays zum Einsatz, und die virtuellen
Maschinen werden mit einem vorhandenen isolierten Testnetzwerk verbunden. Damit lässt sich
gleichzeitig die Ausführung des Disaster-Recovery-Plans bei einem tatsächlichen Failover
automatisieren. Nach Ablauf können die Administratoren die Testergebnisse analysieren. Die
Auto-Snapshot Manager/VMware Edition ist fester Bestandteil der Equallogic-Speicherlösungen und
ermöglicht eine automatische Absicherung.
Veranlasst ein Administrator den Vollzug des Disaster-Recovery-Plans, automatisiert der Site
Recovery Manager die Ausführung der einzelnen Schritte, um eine planmäßige Wiederherstellung von
Betriebssystemen, Applikationen und Daten sicherzustellen. Auch dort gilt, dass die Administratoren
die Ausführung des Disaster-Recovery-Plans über das Virtual Center verfolgen und jederzeit anhalten
oder rückgängig machen können.