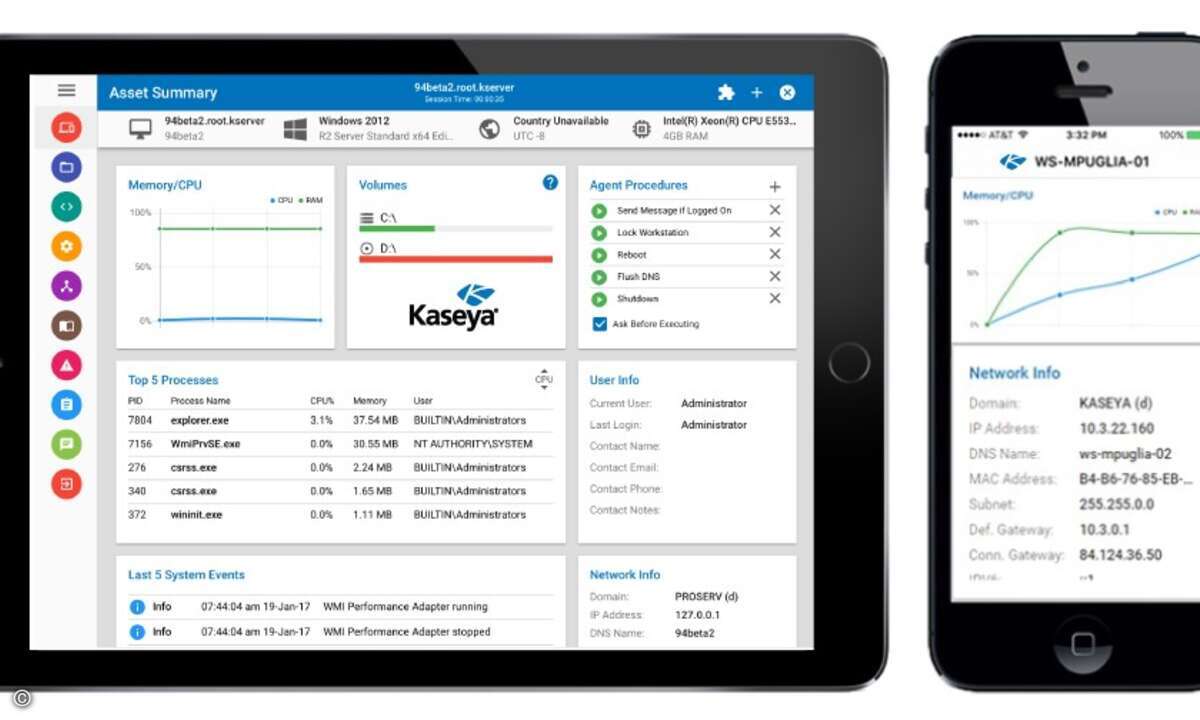Große Koalition zwischen Windows und Linux
Große Koalition zwischen Windows und Linux. Der Deutsche Bundestag ist bei den Servern auf Linux migriert, die Clients der Abgeordneten hingegen werden mit Windows XP betrieben. Das Zusammenwirken erleichtert quelloffene Software.

- Große Koalition zwischen Windows und Linux
- Große Koalition zwischen Windows und Linux (Fortsetzung)
Große Koalition zwischen Windows und Linux
Als im Jahr 2002 der Ältestenrat des Deutschen Bundestages über die künftige IT-Infrastruktur des Parlaments entscheiden sollte, fochten die Vertreter der Lager Windows und Linux regelrechte Grabenkämpfe aus. Heute sieht Dr. Arnulf Lunze, Ministerialdirigent und Leiter der Unterabteilung Zentrale Informationstechnik und damit Verantwortlicher der IT-Infrastruktur des Bundestages, die Debatten von damals sehr entspannt: Seit dem 10. September 2005 arbeiten die Abgeordnetenbüros und die Parlamentsverwaltung in einer gemischten Infrastruktur reibungslos. Der Anmeldedienst sowie die Datei- und Druck-Server laufen in einer Open-Source-Umgebung, die Clients sind mit Microsofts Windows XP ausgestattet. Der Weg dorthin war allerdings nicht einfach. An vielen Punkten betrat das Team um Dr. Lunze und Projektleiter Dr. Frank Blum Neuland. Dennoch sind die Verantwortlichen in der Hauptstadt mit dem Ergebnis zufrieden. Das Plus an Transparenz und Flexibilität wiegt den Aufwand der vorangegangenen 30 Monate mehr als auf.
Politische Empfehlungen
Die Entscheidung, auf den Servern Linux einzusetzen, entspricht der Empfehlung des Bundestages zur Förderung von Open-Source-Software. Das Parlament hatte schon in den 90er Jahren begonnen, bei der Entwicklung von Applikationen bevorzugt Open Source zu verwenden. So wurde beispielsweise die E-Mail-Infrastruktur mit dem quelloffenen Betriebssystem Linux aufgebaut. Doch das Gros der Client- und Server-Infrastruktur basierte noch auf Windows NT, als Microsoft 2001 die Unterstützung für diese Betriebssystemgeneration aufkündigte. Eine Migration der Betriebssysteme für Clients und Server war damit unausweichlich. Die Kommission für den Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechniken (IuK-Kommission) des Ältestenrates beauftragte eine Studie, die fünf Möglichkeiten von einer reinen Linux-Infrastruktur über mehrere Mischlösungen bis hin zu einer vollständigen Microsoft-Variante evaluieren sollte. Bewertet wurden Kriterien wie Client-Funktionen, IT-Sicherheit, vorhandene Infrastrukturdienste wie die Benutzerverwaltung sowie die Breite der verfügbaren Anwendungen und die Kompatibilität zur bestehenden Hardware. Im März 2002 beschloss der Ältestenrat, die Clients mit Windows XP auszustatten, da diese Plattform die beste Nutzerergonomie bot und die geringsten Kompatibilitätsprobleme in der Kommunikation nach außen zu erwarten waren. Als Server-Betriebssystem entschied sich das Gremium vorrangig für Linux. Dabei stand vor allem die Unabhängigkeit und Flexibilität im Einsatz von Open Source im Vordergrund. Darüber hinaus wurde die Einführung eines zentralen Verzeichnis- und Anmeldedienstes beschlossen. Auch hier entschieden sich die Verantwortlichen für eine Open-Source-Lösung basierend auf dem Verzeichnisdienst OpenLDAP und der Software Samba, da diese Variante mehr Transparenz und Unabhängigkeit in der IT-Infrastruktur versprach. Das quelloffene Server-Programm Samba ermöglicht es, von einem Windows-Client aus auf Datei- und Druckdienste auf einem Nicht-Windows-Server zuzugreifen, wie wenn sie auf einem Windows-Server laufen würden.
Im April 2003 beauftragte der Bundestag nach einer europaweiten Ausschreibung den IT-Dienstleister Computacenter als Generalunternehmer mit der Planung und Durchführung des gesamten Projekts. Diese Firma entwickelte etwa 20 verschiedene Einzelkonzepte, die im Laufe der Zeit immer wieder angepasst wurden. Lunze beschreibt das Vorgehen als einen iterativen Prozess, in dem in Abstimmung mit der Bundestagsverwaltung im Projektverlauf die Konzepte immer detaillierter verfeinert werden konnten. Schnell stellte sich heraus, dass damit die ursprünglich als Migrationsprojekt gestartete Zusammenarbeit in einen andauernden Entwicklungsprozess mündete.