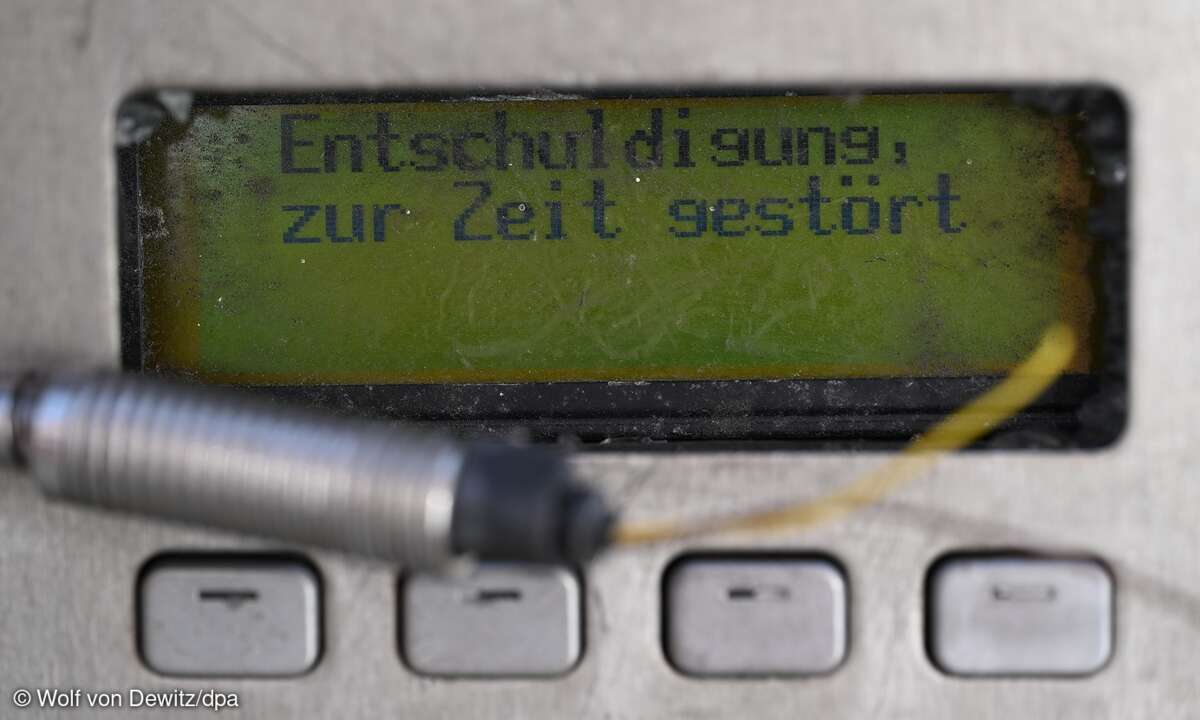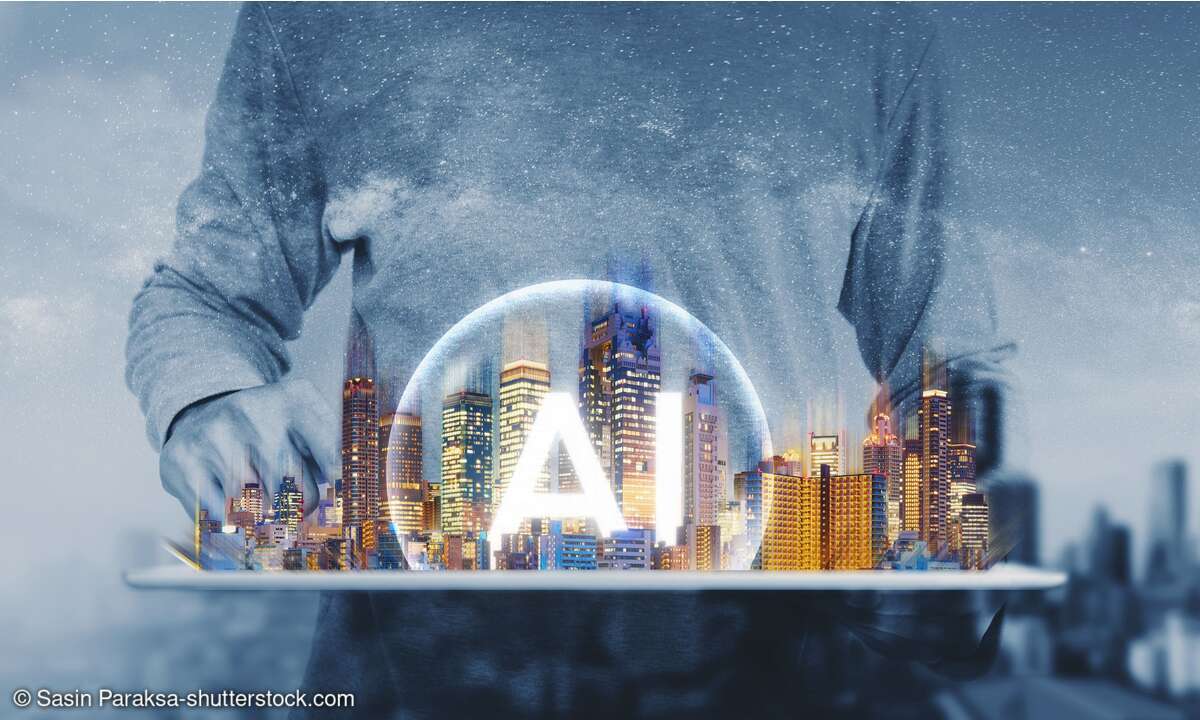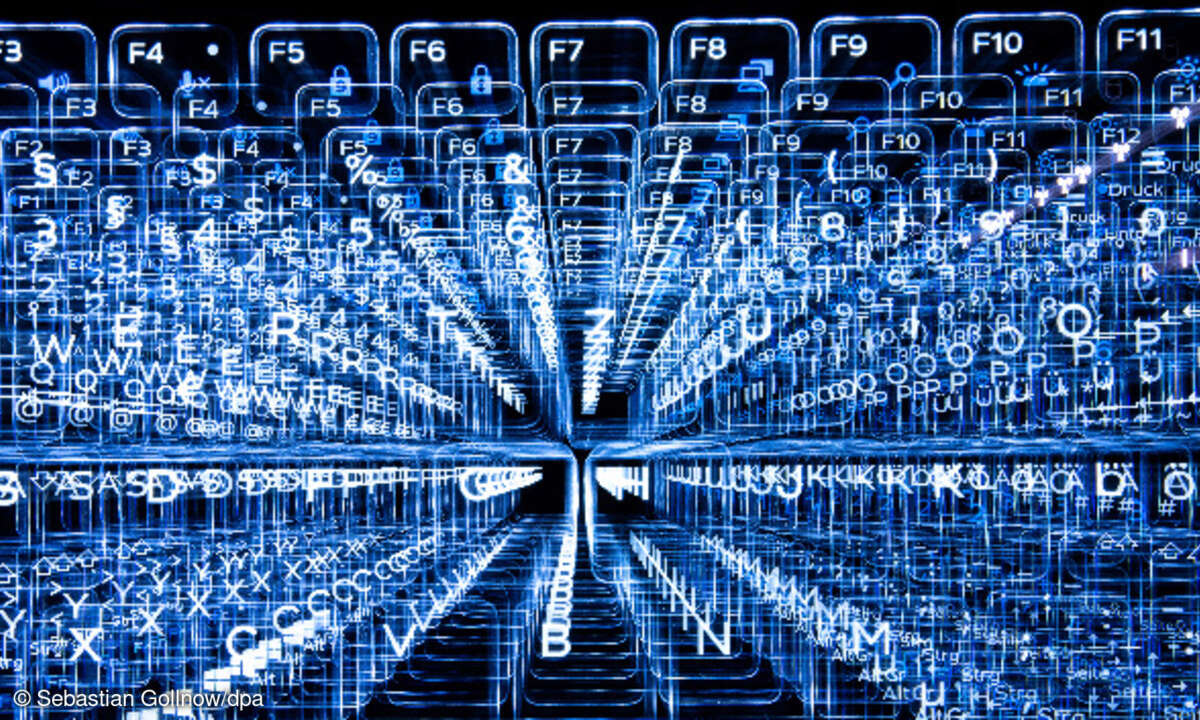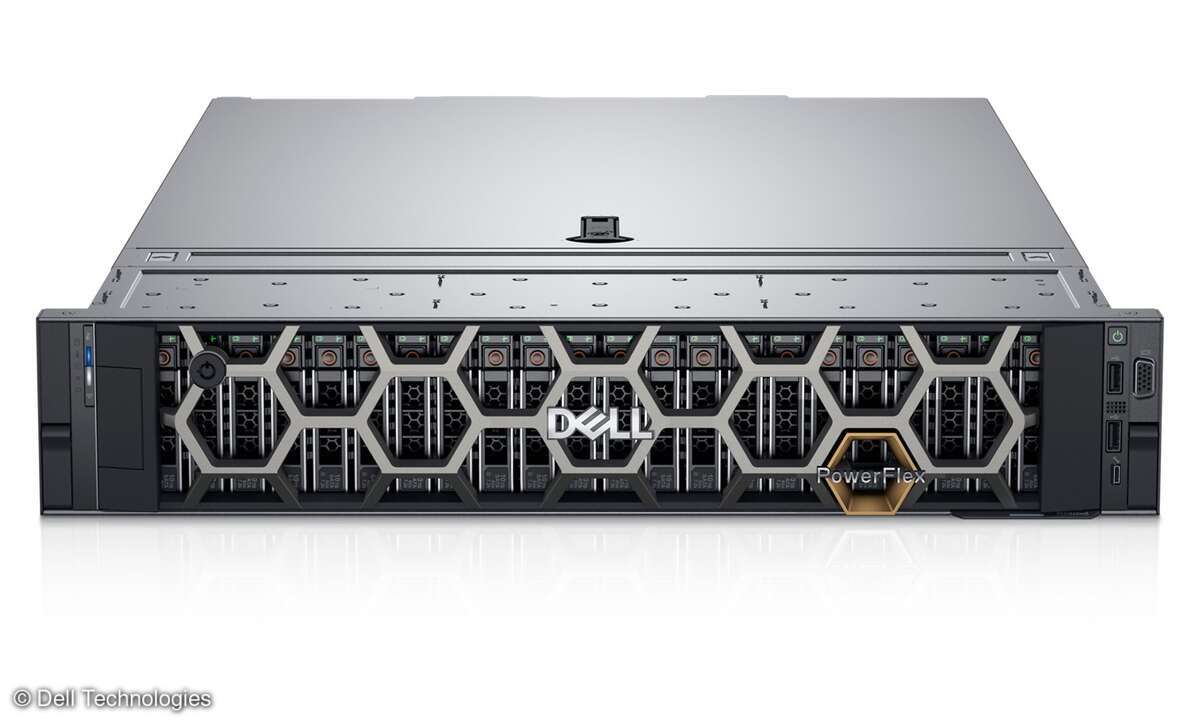KI in Kommunen: Zwischen Potenzial und Restriktionen
Kommunen öffnen sich für Künstliche Intelligenz, doch Ressourcen, Regulierung und föderale Strukturen bremsen. Fraunhofer-Experte Steffen Heß erklärt, wie Technologie-Transfer, zentrale Infrastrukturen und Marktinnovationen den Weg zur Smart City ebnen können.
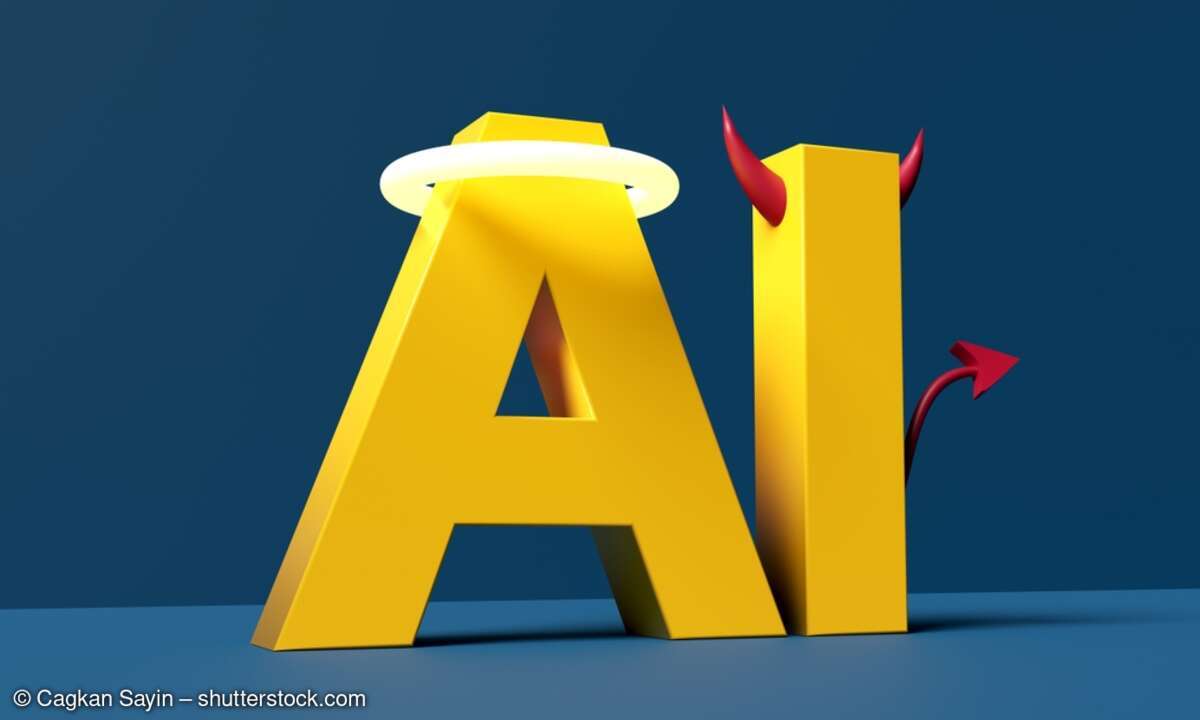
Kaum ein anderes Feld erlebt derzeit so viel Dynamik wie die Digitalisierung der Verwaltung. Auf der Smart Country Convention zeigte Fraunhofer IESE unter dem Motto „How to Smart City“, wie Städte und Regionen innovative Ansätze für Bürgerdienste nutzen können. „Im öffentlichen Sektor ist KI oft mehr ein Aufhänger, um Projekte zu starten“, sagt Heß im Gespräch mit connect professional. „Die eigentliche Innovation liegt meist im Transfer bewährter Technologien in neue Anwendungsfelder.“
Ein Beispiel ist das Projekt „Digitale Dörfer“: Daraus entstand die Kommunikationsplattform „DorfFunk“, heute „StadtLand.Funk“. Sie richtet sich an die Bedürfnisse des Ehrenamts im ländlichen Raum. „Technisch wurde da gar nichts Neues geschaffen, aber es entstand eine soziale Innovation, die Kommunikation im Ehrenamt nachhaltig verändert hat“, so Heß. Das zeigt: Die Anpassung vorhandener Technologien an spezifische Kontexte ist eine Form von Innovation, die für den öffentlichen Sektor besonders wirksam ist.

Chancen und Dilemmata beim KI-Einsatz
Ob Chatbots im Bürgerbüro, Plattformen für Datenmanagement oder Prozessautomatisierung: KI-Lösungen ziehen in Verwaltungen ein. Der Nutzen ist klar: Routinetätigkeiten werden effizienter, Mitarbeitende gewinnen Zeit für komplexe Fälle, Bürger profitieren von besserem Service. „Wenn ich Routineprozesse KI-unterstützt abbilden kann, ermögliche ich den Mitarbeitenden, sich mehr den Fällen zu widmen, die wirklich ihre Aufmerksamkeit erfordern“, erklärt Heß.
Die Haltung der Kommunen hat sich deutlich gewandelt. Viele Beschäftigte nutzen privat Sprachmodelle wie ChatGPT. Skepsis wird durch Neugier ersetzt. Förderprogramme helfen, erste Pilotprojekte zu starten. Doch die Realität ist komplexer: Häufig dürfen nur neu geschaffene Stellen gefördert werden, die erst Monate später besetzt werden können. „Wenn jede Kommune jetzt einen eigenen Data Scientist einstellen müsste, würde man schnell die Grenzen merken. Es braucht Bündelung von Wissen und Kompetenzen“, warnt Heß.
Gerade Sprachmodelle verdeutlichen das Dilemma: Technisch führende Lösungen kommen meist aus den USA, sichere Alternativen aus dem Open-Source-Umfeld sind zwar nutzbar, aber „gefühlt die zweitbeste Lösung“. Die zentrale Frage lautet: Wie lassen sich digitale Souveränität, Rechtssicherheit und technologische Exzellenz verbinden?
Erfolgsfaktoren und indirekte Mehrwerte
Heß sieht klare Bedingungen für erfolgreiche Projekte:
- Zieldefinition: Kommunen müssen messbare Ziele formulieren
- Partizipation: Bürger und Mitarbeitende früh einbinden
- Interdisziplinarität: Teams über Fachbereiche hinweg aufstellen
- Kooperationen: Forschungsinstitute, Start-ups und IT-Dienstleister einbinden
Wichtig sei zudem, „experimentelle Räume vorzuhalten, damit Kommunen selbst Erfahrungen sammeln können.“ Viele Projekte liefern dabei einen doppelten Nutzen: Neben sichtbaren Verbesserungen im Bürgerservice entstehen im Hintergrund Datenplattformen, die Datensilos aufbrechen. „Wenn ich ein Sprachmodell mit Daten aus verschiedenen Fachbereichen füttern will, entsteht implizit eine bessere Datenlage. Kommunen begreifen, dass Digitalisierung nicht mehr fachbereichsspezifisch gedacht werden darf.“
Kommunen agieren zunehmend selbst als Innovationstreiber. Ein Beispiel ist „URBAN.KI“ aus Gelsenkirchen, wo mit BMWSB-Mitteln eine zentrale Anlaufstelle für KI in Kommunen geschaffen wurde. Das zeigt: Städte sind nicht nur Adressaten von Forschung, sondern können diese auch aktiv einfordern.
Flickenteppich oder Bundeslösung?
Ein Dauerbrenner bleibt die föderale Zersplitterung. „Warum muss jede Kommune ihr eigenes Sprachmodell hosten? Warum machen wir das nicht einmal für ganz Deutschland zentral?“ fragt Heß. Konzepte wie ein „BundesGPT“ oder bundeseinheitliche Datenplattformen könnten enorme Synergien schaffen. Dabei gehe es nicht darum, Monopole aufzubauen – Wettbewerb bleibe wichtig. Doch eine gewisse Standardisierung sei unverzichtbar. Beispiele wie das ZenDiS mit seiner openDesk-Plattform zeigen, dass Open-Source-Alternativen funktionieren können. „openDesk ist toll, aber wir dürfen da nicht stehenbleiben. Die neuen Anwendungsfälle rund um KI, urbane digitale Zwillinge und Datenräume müssen jetzt entschlossen angegangen werden.“
Heß: „Warum muss jede Kommune ihr eigenes Sprachmodell hosten?“
Der Transfer von Konzepten aus der Industrie 4.0 liefert dafür Vorbilder: Digitale Zwillinge von Produktionsanlagen lassen sich auf urbane Kontexte übertragen, um etwa Brücken oder Verkehrsinfrastruktur in Echtzeit zu simulieren. Hier zeigt sich, wie eng Industrie- und Public-Sector-Forschung verflochten sein können.
Marktshake-up und politische Dimension
Neben Verwaltungen selbst verändert sich der Markt. Neue Anbieter drängen in den Public Sector, Start-ups kooperieren mit Landes-IT-Dienstleistern, etablierte Player müssen ihre Geschäftsmodelle anpassen. „Es ist nicht mehr so, dass nur klassische Public-Sector-Akteure unterwegs sind. Der Markt öffnet sich gerade deutlich“, beobachtet Heß. Für deutsche Technologieunternehmen ist das eine Chance: „Der öffentliche Sektor wirkt zwar oft unattraktiv, ist aber ein Markt, der enorm profitieren würde, wenn Hidden Champions und Technologieführer ihn stärker adressieren würden.“ Gleichzeitig brauchen Kommunen Orientierung und Standards, um aus der wachsenden Angebotsvielfalt die passende Lösung auszuwählen.
Heß: „Der öffentliche Sektor ist attraktiver, als viele Technologiehersteller glauben.“
Hinzu kommt die politische Dimension: Projekte hängen oft von der Unterstützung vor Ort ab. Heß verweist auf Gelsenkirchen, wo eine Stichwahl des Oberbürgermeisters über die Zukunft von Innovationsvorhaben mitentscheiden kann. Digitalisierung in Kommunen ist damit nicht nur eine technische, sondern auch eine politische Frage.
Regulierung als USP oder Hemmschuh?
Europa setzt mit DSGVO und AI Act klare Standards. Für Heß ist das zweischneidig: „Was in Europa ein USP sein kann, ist, dass wir Transparenz und Rahmenbedingungen haben. Aber das verlangsamt auch Innovationsprozesse.“ Entscheidend sei, dass Verwaltungen die Regeln nicht nur erfüllen, sondern den Mehrwert der Digitalisierung klar erkennen. Unterschiede zwischen den Bundesländern zeigen, dass es auch anders geht: Hamburg etwa profitiert seit Jahren von einem eigenen Datentransparenzgesetz, andere Länder hinken hinterher.
Vom Pilot zur Skalierung
Die Smart Country Convention macht deutlich: Die Zeit der Skepsis ist vorbei. Kommunen experimentieren mit KI, schaffen Datenplattformen und brechen alte Strukturen auf. Doch der Weg in die Breite bleibt steinig: Förderlogik, Ressourcenknappheit, politische Abhängigkeiten und föderale Fragmentierung hemmen die Skalierung.
Heß sieht den Schlüssel in einem Dreiklang: Technologie-Transfer, zentrale Infrastrukturen und stärkere Marktdurchdringung durch deutsche Anbieter. Erst wenn diese Ebenen zusammenspielen – und die Politik den Mut hat, den Rahmen dafür zu schaffen – kann die Verwaltung den Sprung von Pilotprojekten zu echter digitaler Transformation schaffen.
Sie interessieren sich für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung? Bleiben Sie mit unserem monatlichen Public-Sector-Newsletter auf dem Laufenden. Immer am ersten Donnerstag im Monat liefern wir Ihnen spannende Hintergründe, aktuelle Entwicklungen und exklusive Insights direkt in Ihr Postfach. Hier anmelden und nichts mehr verpassen!