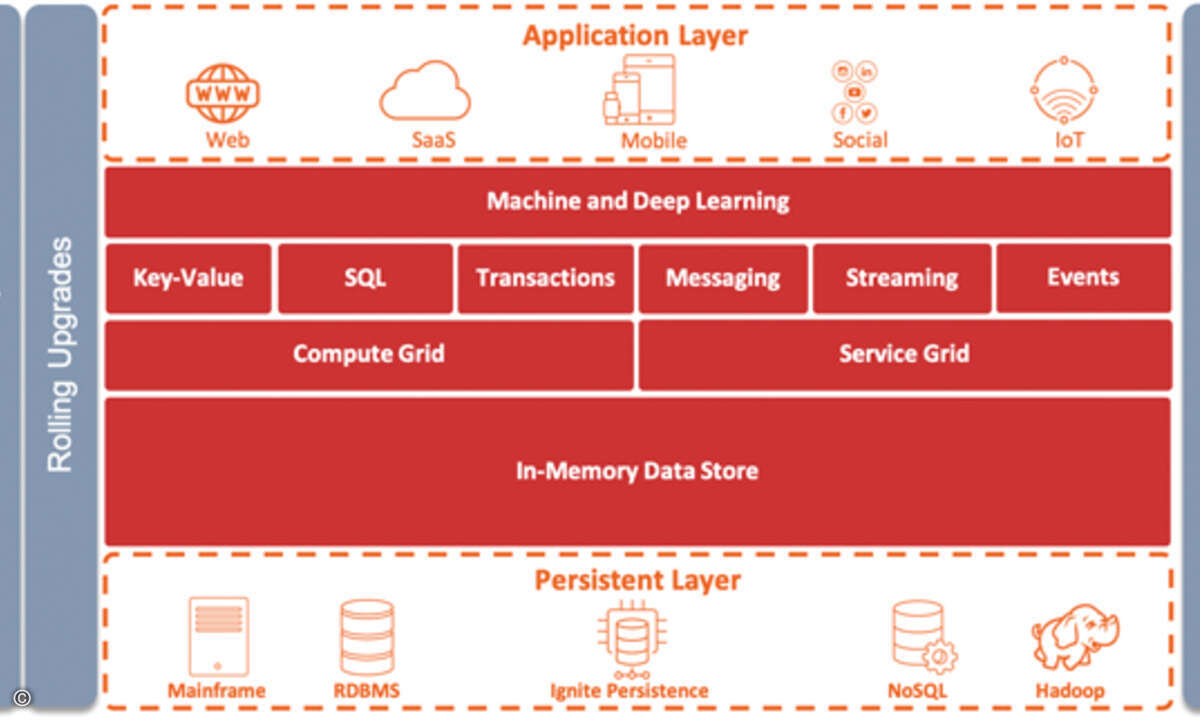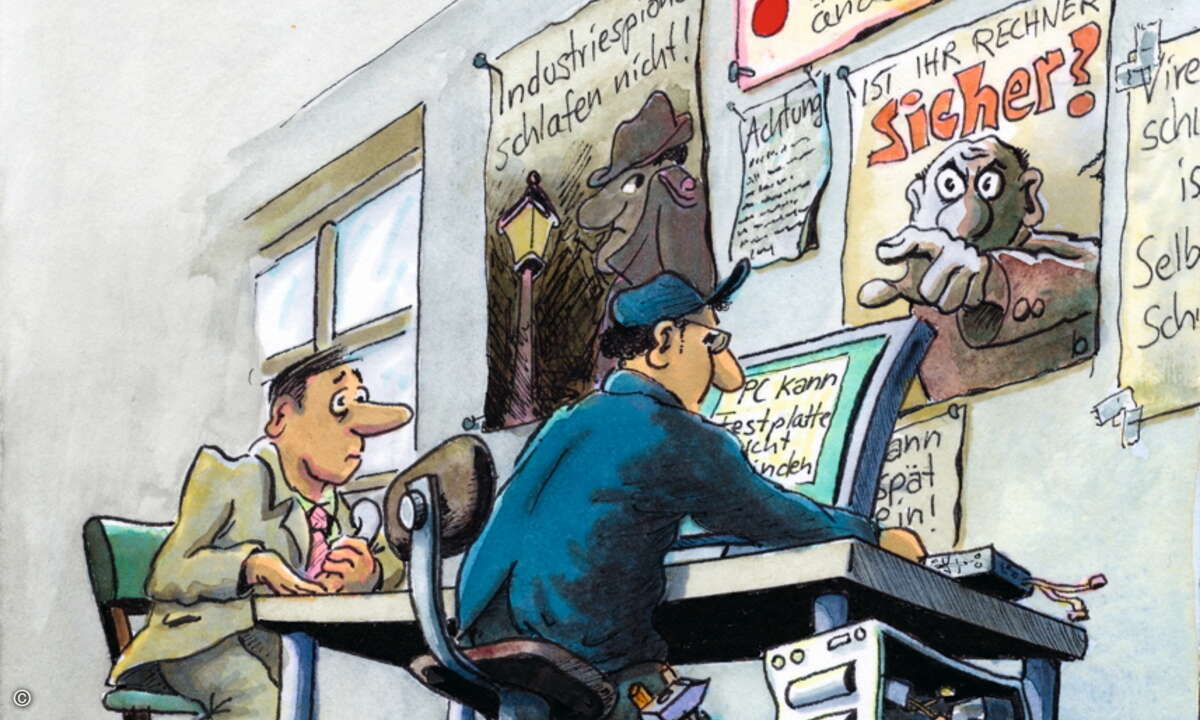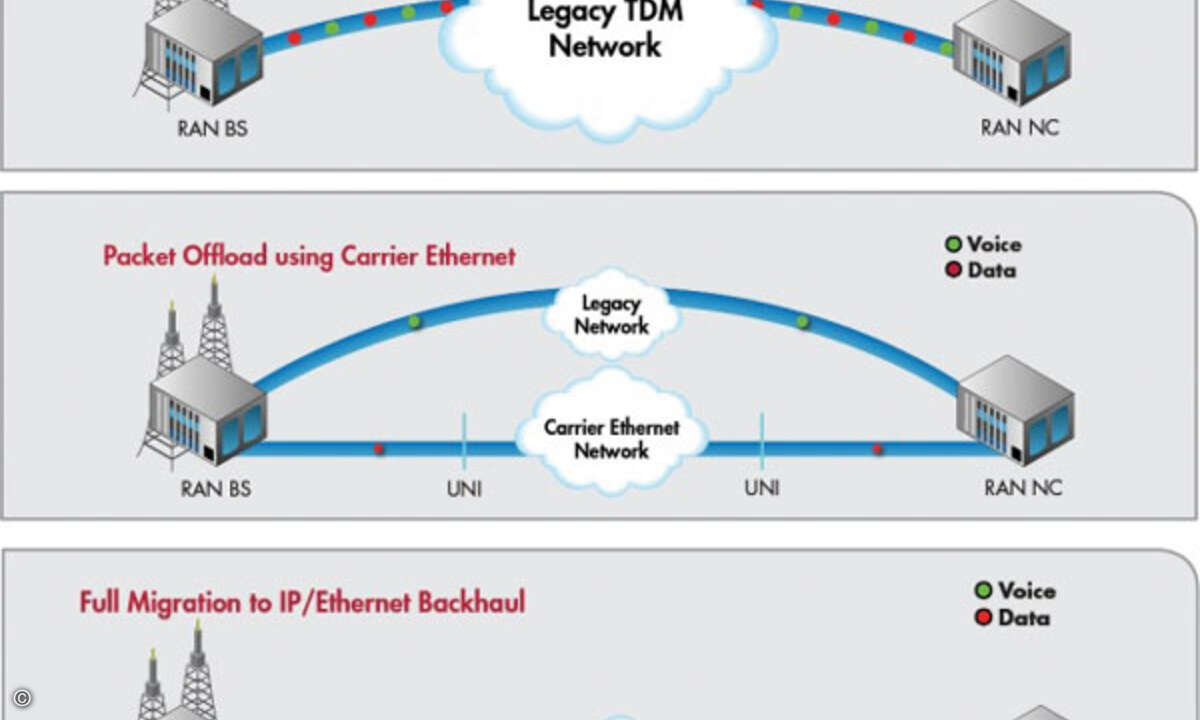Rechnen statt hoffen
Rechnen statt hoffen. Softwareentwicklungsprojekte geraten oft in eine Schieflage, weil über den erreichten Stand Unklarheiten bestehen. Eine kontinuierliche Qualitätskontrolle, die Werte prozessbezogen misst und in einem Leitstand darstellt, kann für Abhilfe sorgen.
- Rechnen statt hoffen
- Rechnen statt hoffen (Fortsetzung)
- Rechnen statt hoffen (Fortsetzung)
Rechnen statt hoffen
Der Anteil gescheiterter Softwareprojekte steigt weiter an. Den Analysten der Standish Group zufolge verliefen zuletzt nur noch 29 Prozent der Projekte nach Plan, während mehr als die Hälfte Budgets oder Zeitpläne sprengte. 18 Prozent der Vorhaben blieben sogar ganz ohne Ergebnis. Für viele Führungsetagen kommt dieser Befund überraschend, hatten die Unternehmen in den vergangenen Jahren doch verstärkt in das Controlling der IT investiert. Allerdings beschränkt sich dieses Monitoring meist auf Finanz- und Zeitaspekte. Bei der Qualität der Software haben die Verantwortlichen auch weiterhin nur selten Transparenz und müssen sich auf das Bauchgefühl der Projektmanager und Softwarearchitekten verlassen.
Leitstand für die IT
Deshalb entdecken Führungskräfte derzeit das auf den ersten Blick spröde Thema der Qualitätskennzahlen für sich. Sie können inzwischen auf Metriken zurückgreifen, die Qualitätssicherer vom Testen her kommend entwickelt haben. Entsprechende Systeme kann das Management nach dem Prinzip eines Leitstands bedienen, der die für das Projekt relevanten Messwerte in verdichteter Form vorlegt. So können sich die Verantwortlichen jederzeit auf Basis automatisch ermittelter Daten über den aktuellen Projektstatus informieren. Etwaige Fehlentwicklungen zeigt das System frühzeitig an. Insbesondere für CIOs können sich solche Dashboards zu einem wertvollen Instrument entwickeln ? sehen sie sich doch einem zunehmenden Rechtfertigungszwang dem Business gegenüber ausgesetzt. Im Zeichen des heutigen Effizienzdrucks sind sie auf Transparenz angewiesen, weil diese eine Grundvoraussetzung jeglichen Optimierens ausmacht.
Unternehmen kommen nicht weit, wenn sie ihre IT-Prozesse ohne solche Qualitätsleitstände optimieren wollen. Sie werden, unabhängig vom verwendeten Prozessmodell (siehe Textkasten auf Seite 31), höhere Reifegrade nicht erreichen. Das Modell CMMI zum Beispiel versteht unter seinem obersten Reifegrad vor allem einen Regelkreislauf, der abgleicht, ob die Unternehmensziele mit dem quantifizierbaren Status quo übereinstimmen. Messungen sind hier ein integraler Bestandteil, alle maßgeblichen Modelle des Qualitätsmanagements fordern sie.