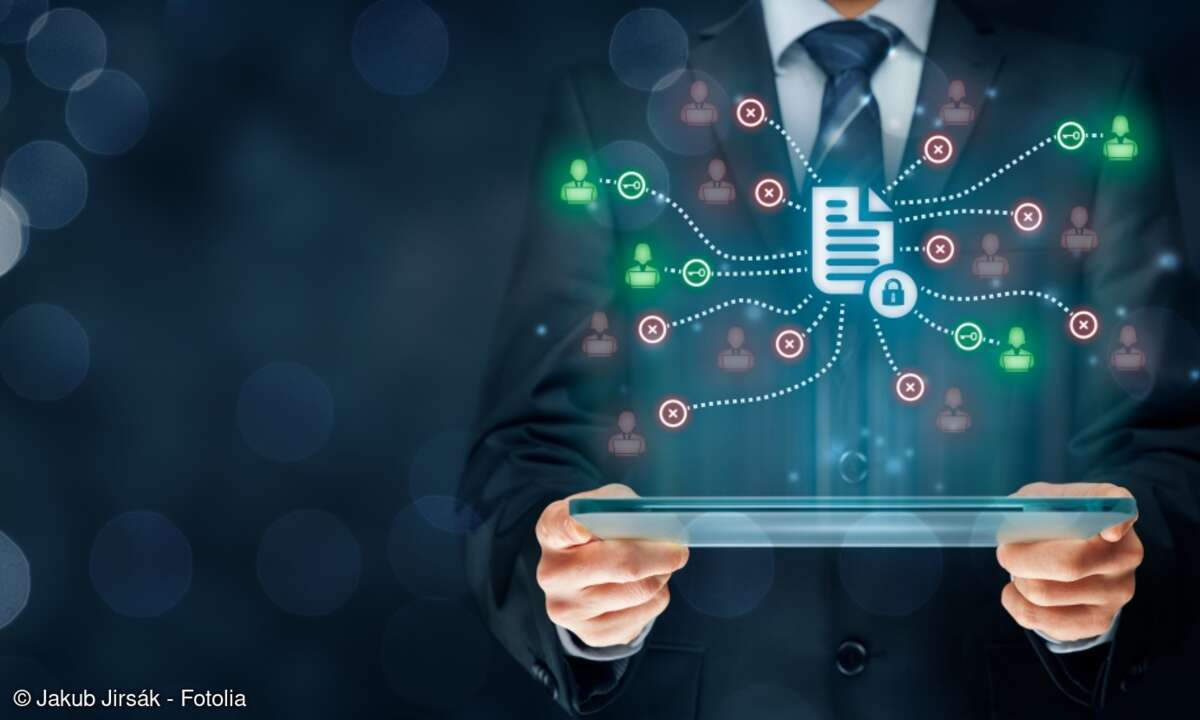Vorratsdatenspeicherung wird eingeschränkt
Das Bundesverfassungsgericht hat in einer Eilentscheidung die Verwendung von Informationen, die im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung erhobenen wurden, auf die Verfolgung von schweren Straftaten beschränkt. Ein Beschluss über die Rechtmäßigkeit der Datenspeicherung an sich steht allerdings noch aus.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit einer Eilentscheidung auf einen Antrag von mehr als 30.000 Bürgern zum Stopp der Vorratsspeicherung von Telefondaten reagiert. Dabei wurde die Erfassung der Verbindungsdaten zwar nicht untersagt, dafür aber die Verwendungsmöglichkeiten der erhobenen Informationen auf die Verfolgung schwerer Straftaten beschränkt.
Nicht das Speichern selbst, sondern erst der Abruf der Daten sei ein Eingriff in die Freiheit der Bürger, erklärten die Verfassungsrichter in ihrer Entscheidung. Die Anordnung des Gerichts tritt zunächst für ein halbes Jahr in Kraft und kann danach verlängert werden.
Für die Initiatoren des Antrags stellt die Entscheidung einen Teilerfolg dar. So ist die Verwendung von Erkenntnissen der Vorratsspeicherung bei minderschweren Delikten wie dem illegalen Herunterladen von Filmen und Musik aus dem Internet vorerst nicht möglich.
Endgültige Entscheidung steht noch aus
Und auch bei gravierenden Straftaten müssen die Strafverfolgungsbehörden ihren Verdacht zunächst fundiert begründen und den Nachweis liefern, dass die Aufklärung des Sachverhalts auf andere Weise nur schwer bzw. gar nicht möglich ist.
Über die grundsätzliche Rechtmäßigkeit der Vorratsdatenspeicherung hat das höchste deutsche Gericht allerdings noch keine Aussage getroffen. Die Verfassungsrichter forderten jedoch die Bundesregierung auf, bis zum 1. September 2008 einen Bericht über die praktischen Folgen der Vorratsdatenspeicherung vorzulegen. Beobachter gehen daher davon aus, dass die Hauptverhandlung zum Jahresende eröffnet wird.
Auch Online-Durchsuchung nur mit Einschränkungen
Mit der vorliegenden Entscheidung hat das BVerfG zu dritten Mal innerhalb weniger Wochen gegen Regelungen Stellung bezogen, die das flächendeckende Sammeln elektronischer Daten durch staatliche Organe erlauben sollten.
Auch die Online-Durchsuchung von Internet-Rechnern wurde nur in begründeten Ausnahmefällen für zulässig erklärt, etwa bei Gefahr für Leib und Leben oder für ein anderes »überragendes Rechtsgut« (siehe Bericht).
Außerdem muss ein Richter diese Maßnahme anordnen. Damit schob das Bundesverfassungsgericht einer »Online-Rasterfahndung« einen Riegel vor.
In der vergangenen Woche hat das BVerfG zudem der Erfassung von Video-Erfassung von Autokennzeichen Grenzen gesetzt. Ein solcher Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung des Bürgers dürfe nur auf Basis klar ausformulierter Gesetze erfolgen, so das Gericht.
So müsse eine entsprechende Regelung Anlass und Ermittlungszweck nennen. Ein pauschales Erfassen und Speichern von Daten ohne konkreten Anlass sei unzulässig. Mit dieser Begründung erklärten die Richter entsprechende Vorschriften in Hessen und Schleswig-Holstein für verfassungswidrig.
Beobachter gehen daher davon aus, dass die Hauptverhandlung zum Jahresende eröffnet wird.