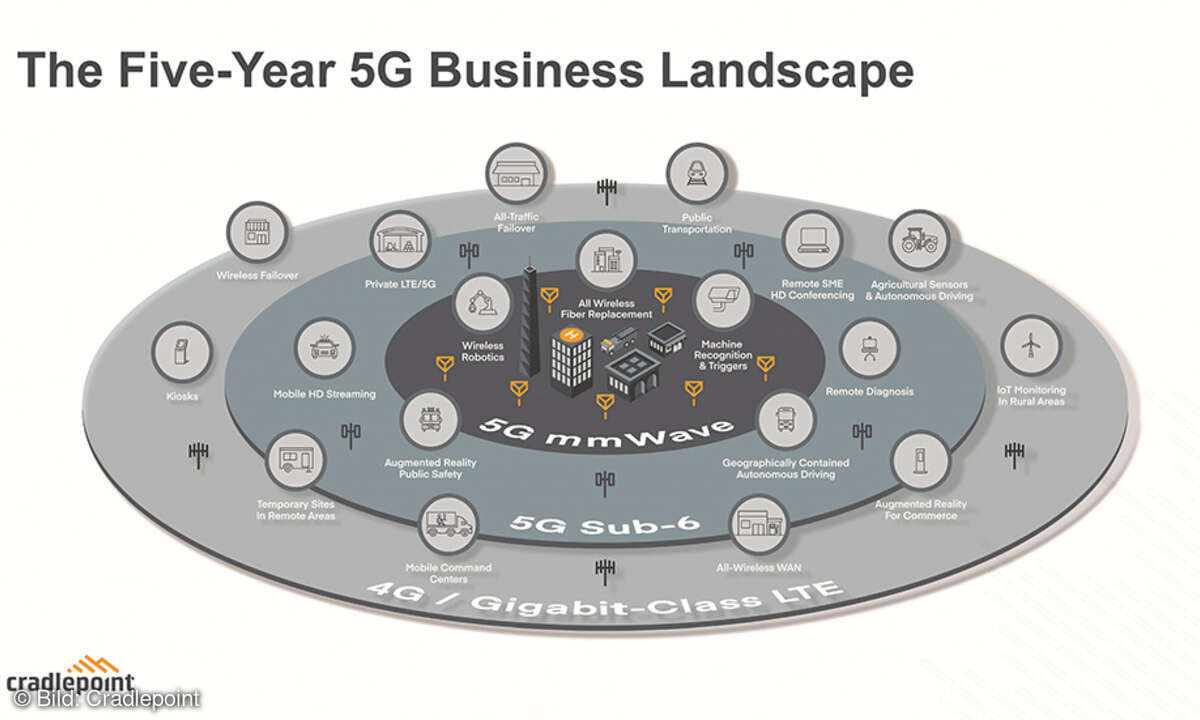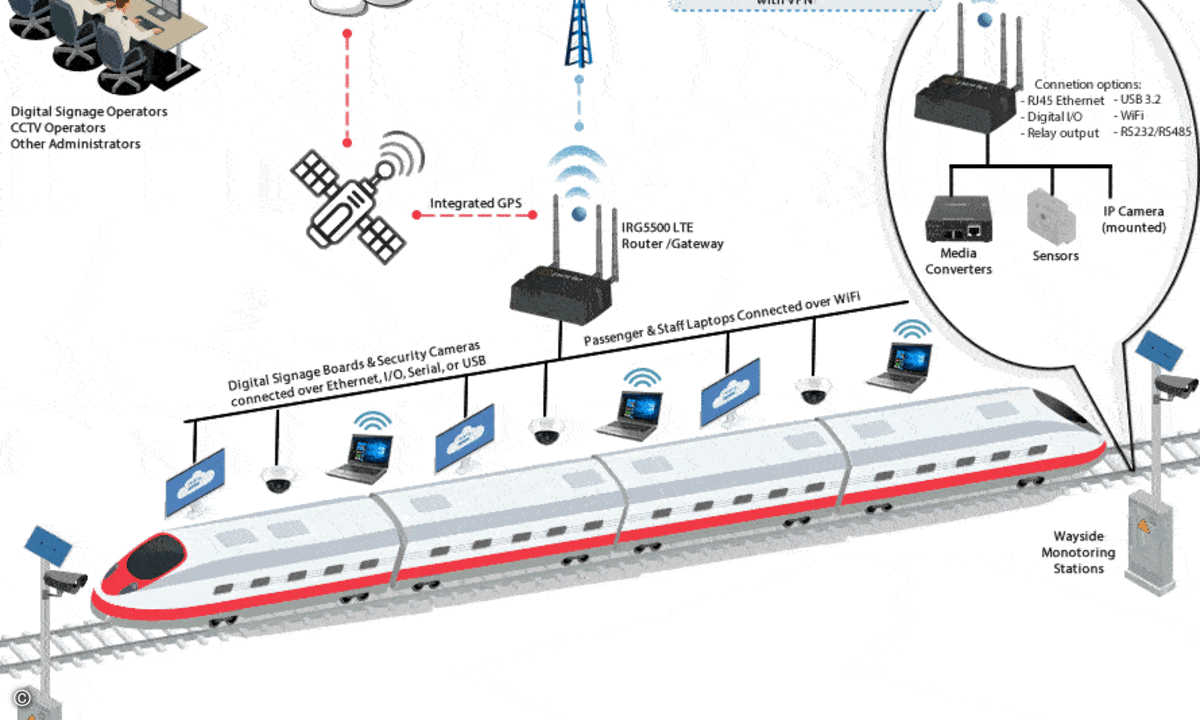LTE und die Voice-Herausforderung
Angesichts des gestiegenen Datenverkehrs ist der neue Mobilfunkstandard LTE eine gute Nachricht: Mit einer höheren Leistungsfähigkeit als alle seine Vorgänger sowie geringeren Latenzzeiten bietet er ein deutlich besseres Nutzererlebnis. Der Wermutstropfen: Hier handelt es sich um eine rein IP-basierte Kommunikation. Netzbetreiber müssen nach alternativen Lösungen suchen, um Sprachtelefonie weiterhin unter den bekannten Kosten- und Qualitätskriterien anbieten zu können.
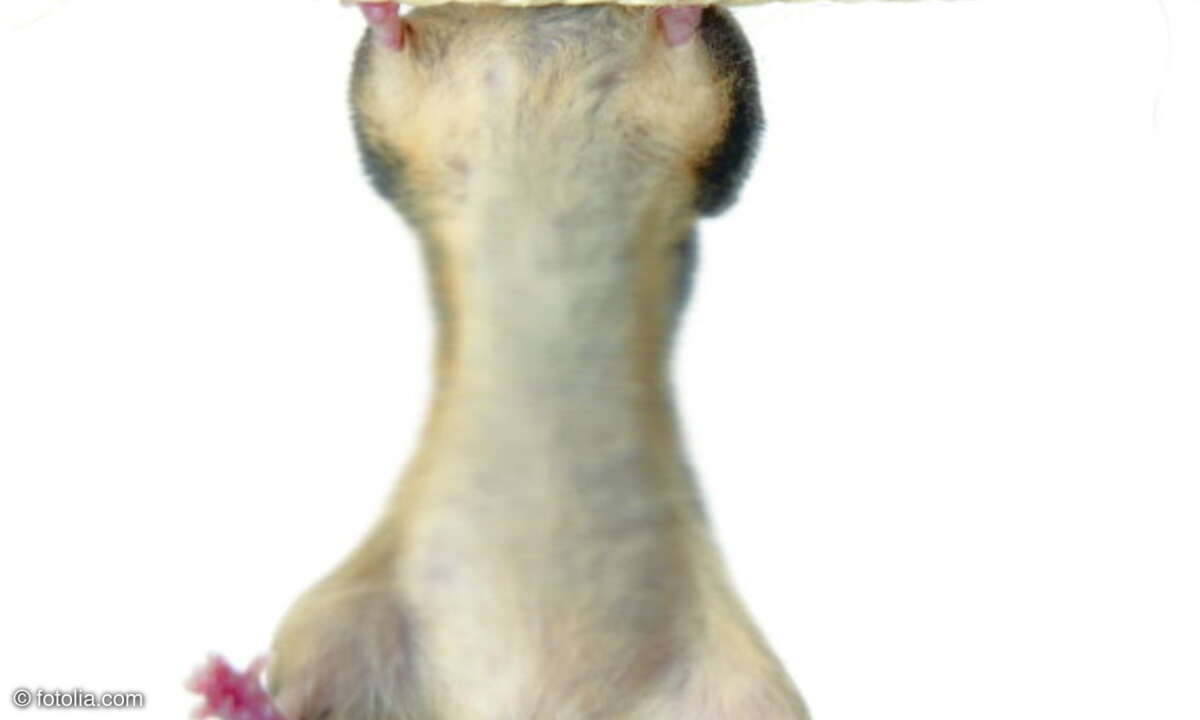
Die Betreiber von Mobilfunknetzen stehen bereits seit einiger Zeit in einem harten Wettbewerb um ihre Endkunden. Getrieben von der stetig steigenden Nachfrage der Datendienste, dramatisch wachsenden Datenmengen und dem hohen Kostendruck aufgrund erodierender Datentarife, mussten die Mobilfunknetzbetreiber Lösungen finden, die den profitablen Betrieb ihrer Netze auch weiterhin gewährleisten.
Ein Ansatz, diesen Anforderungen zu genügen, ist die Einführung des neuen Mobilfunkstandards LTE. Der Ausbau der LTE-Netze ist in den ländlichen Gebieten abgeschlossen und erfüllt damit die Auflagen der Bundesnetzagentur für die Digitale-Dividende. Im nächsten Schritt bauen die Mobilfunknetzbetreiber diese Technologie zügig auch in den Ballungsgebieten auf.
Der neue Mobilfunkstandard bietet im Vergleich zu seinen Vorgängern eine deutlich höhere Leitungsfähigkeit und Effizienz, reduzierte Latenzzeiten und damit letztendlich auch ein besseres Nutzungserlebnis. Auf der anderen Seite gibt es aber auch deutliche Nachteile, denn im Gegensatz zu GSM und UMTS ist LTE die erste Mobilfunktechnologie, in der es keine leitungsorientierte Transport- und Vermittlungstechnik gibt (Circuit-Switched-Network).
Das neue Netz ist reine IP-basierte Kommunikation, das heißt eine leitungsgebundene Sprachübertragung in der bekannten Form ist nicht möglich. Hier gibt es nur die Möglichkeit, Sprachtelefonie als reinen Datendienst zu realisieren, was aber alles andere als trivial ist. Dies führt dazu, dass die Signalisierung (Rufaufbau und -terminierung) sowie der Transport der Sprachdaten über das Internet-Protocol (IP) erfolgen müssen.
Um Dienste über IP realisieren zu können, wurde vom 3GPP das IP-Multimedia-Subsystem (IMS) als „Service-Network“ bereits für UMTS spezialisiert. Damit wurde die Bereitstellung von Multimedia-Diensten über IP ermöglicht. Es gibt jedoch zwei wesentliche Faktoren, die ein „Problem“ für die Realisierung von Diensten über LTE darstellen: So wird es zumindest in den ersten Jahren keine flächendeckende LTE-Versorgung geben – und außerdem existieren viele weitere Telekommunikationsdienste neben der Sprachtelefonie, die betreiberspezifisch und/oder eng an das Konzept der leitungsvermittelten Telefonie gekoppelt sind, wie beispielsweise Fax.
Mobilfunkkunden erwarten sowohl die flächendeckende Verfügbarkeit, als auch die mobile Nutzbarkeit ihres Sprachdienstes und der Zusatzdienste, wie SMS oder Mailbox. Das macht die Interaktion des LTE-Sprachdienstes mit GSM- beziehungsweise UMTS-Netzen notwendig. Daher stellt sich vielmehr die Frage, wie lange alle Technologien koexistieren müssen und inwieweit sie sich ergänzen können, um weiterhin umsatzstarke Dienste wie mobile Sprachtelefonie und SMS unter Qualitäts- und Kostenkriterien anbieten zu können. Netzbetreiber müssen daher alternative Lösungen evaluieren, um die Sprachtelefonie auch mit LTE realisieren zu können. Daher ist die richtige Bewertung der existierenden Optionen für die Netzbetreiber von essentieller Bedeutung.