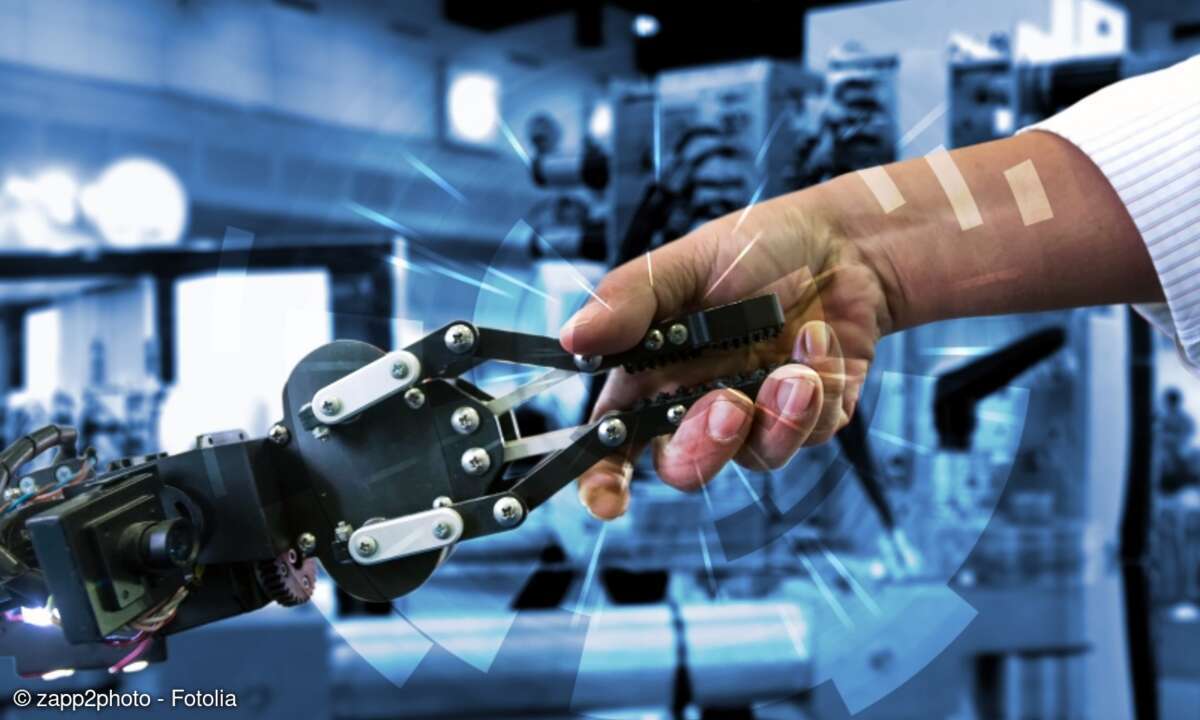Big Brother fürs Rechenzentrum
Schranküberwachungslösungen sind keine statischen Systeme. Während es bei den ersten Schranküberwachungen noch genügte, festgelegte Eingänge und Funktionen anzubieten, müssen sie heute neuen Ansprüchen genügen. Sie sollen Unternehmen zum Beispiel dabei unterstützen, Energiekosten einzusparen oder die Umweltbelastung zu minimieren. Hierzu sind flexible Lösungen und moderne Konzepte notwendig. Doch nicht alle Funktionen, die möglich wären, sind auch tatsächlich notwendig und sinnvoll.
Bei den ersten Lösungen Ende des letzten Jahrhunderts stand die Zugangskontrolle zu den Schränken im Vordergrund. Denn die ersten Anwender waren Co-Location-Anbieter, bei denen unterschiedliche Kunden und Systemadministratoren im Rechenzentrum arbeiteten, aber nicht an allen Schränken Veränderungen vornehmen sollten. Folgerichtig boten die Schrankhersteller deshalb zuerst Überwachungssysteme für den Zugang an.
Temperatursensoren, Brandmelder oder Phasenprüfung waren eher untergeordnete Applikationen. Daraus sind zunächst modulare Systeme entstanden: ein Modul für Türkontakte, ein weiteres für Griffsteuerungen, analoge Module für Temperaturmessungen und digitale Module für weitere Überwachungsaufgaben. Dieser Funktionsumfang wäre heute nicht mehr Stand der Technik.
Neue Anforderungen
Die Zugangskontrolle und Zugangsberechtigung regeln nun meist vorgelagerte Sicherheitssysteme, oder Fremdfirmen dürfen nur im Beisein von autorisiertem Personal im Rechenzentrum (RZ) arbeiten.
Die Kontrollaufgabe besteht mehr und mehr darin, die Mitarbeiter dort zu unterstützen, wo der Mensch allein ein entstehendes Problem nicht objektiv erfassen kann, bevor es zu ernsthaften Schäden am System führt.
Temperaturen
Derzeit ist der mit Abstand wichtigste Aspekt das Messen und Übermitteln von Temperaturdaten. Die Leistungsdichte eines Servers, die Anzahl der Server in einem Rack und die Anzahl der Racks in einem RZ haben zugenommen, das Risiko eines temperaturbedingten Ausfalls ist deutlich gestiegen. Deshalb werden bis hin zur Luft/Wasserkühlung auch permanent leistungsfähigere Kühlsysteme eingesetzt. Ein gutes Überwachungssystem muss daher zumindest Temperaturdaten in kurzen Abständen übermitteln und bei Überschreiten von Schwellenwerten zunächst Warnungen und dann Alarme absetzen können.
Noch besser ist es, wenn das System auch schon vor dem Auftreten erhöhter Temperaturen das Entstehen potenzieller Gefährdungen dadurch erfasst, dass es die Kühltechnik steuert und die Lüfterdrehzahlen oder andere Parameter eines Wärmetauschers an den Administrator kommuniziert. Es gibt Lösungen mit einer direkten Schnittstelle zwischen der Überwachung und den Kühleinheiten im Schrank, die alle Daten, die sich aus dem Kühlmodul auslesen lassen, verarbeiten und kommunizieren können.
Strommessung
Eine ähnliche Entwicklung hat auch bei der Strommessung stattgefunden. War es in den Anfangsjahren noch ausreichend, zu prüfen, ob auf den Phasen ein Strom anliegt, so wird heute für jede einzelne Anschlussdose der Stromverbrauch gemessen und protokolliert.
Dies ermöglicht dem Administrator präzise Entscheidungen darüber, ob es noch möglich ist, weitere Server in einem Schrank zu platzieren. Außerdem ist damit eine Verbrauchsabrechnung bis zur Rack- oder Applikationsebene möglich. Der Anwender hat seinen Verbrauch und die damit verbundenen Kosten jederzeit unter Kontrolle. Dies ist in einer Zeit, in der die Energiekosten einen erheblichen Anteil an den Betriebskosten eines RZs ausmachen, nicht nur unter Umweltaspekten, sondern auch unter ökonomischen Gesichtspunkten unverzichtbar.
Eine solche Messung und Datenübermittlung kann natürlich auch über "Intelligente" Steckdosenleisten (PDUs) erfolgen, die dann allerdings pro Leiste eine IP-Adresse und zur Vereinfachung der Konfiguration eine ausgereifte Bedieneroberfläche benötigen. Ein Schrankkontrollsystem hat demgegenüber den entscheidenden Vorteil, dass der Administrator vorab Ereignisse miteinander verknüpfen kann. Das System reagiert dann bei entsprechender Konfiguration autark auf Alarme.
Autarke Aktionen
Legt der Administrator zum Beispiel bei der Konfiguration des Systems fest, dass bei einer Temperatur von 40 °C (eingehende Information) eine Warnmeldung (Aktion des Systems) abgesetzt werden soll, geht diese Warnmeldung über SNMP an das Managementsystem oder über SMS auf sein Mobiltelefon, und für weitere Maßnahmen muss er aktiv werden. Er kann aber auch automatische Aktionen des Systems festlegen, um Gefährdungen des Systems zu minimieren, die dadurch entstehen, dass nicht rechtzeitig eingegriffen werden kann. Das System kann zum Beispiel bei 40 °C automatisch weitere Lüfter zuschalten (Aktion des Systems), bei einer Temperatur von 50 °C die ersten Server mit weniger wichtigen Applikationen im Rack über schaltbare Steckdosenleisten vom Netz trennen und bei 60 °C das gesamte Rack stromlos schalten.
Um zum Beispiel einen Ausfall der Gebäudeklimatisierung auszuschließen, sollte es auch möglich sein, dass das System die Temperaturverläufe in benachbarten Schränken miteinander vergleicht und bei allgemein steigenden Temperaturen eine entsprechende Warnmeldung zum Beispiel an den Administrator und die Pforte ausgibt. Diese Verknüpfung von Messung, Auswertung und Reaktion kann nur über ein Schrankkontrollsystem realisiert werden. Wichtig ist, dass die Abläufe mit Konzept erstellt sind und möglichst viele Risiken abdecken.
Auswahlkriterien
Worauf sollte man nun bei der Auswahl eines solchen Systems achten? Eine hochwertige Temperaturüberwachung ist unabdingbar, ebenso ein schlüssiges System zur Messung von Strom und Netzspannung. Wenn das System zusätzlich Feuchtigkeitssensoren, Rauchmelder, Bewegungsmelder und Erschütterungs- sowie Leckagesensoren enthält und im Bedarfsfall auch eine Zugangskontrolle anbieten kann, dann sind damit die wichtigen Funktionen abgedeckt. Die Verknüpfung von Messwerten und Aktionen muss auf einer zuverlässigen Software benutzerfreundlich und zeitsparend möglich sein und viele Freiheiten zulassen. Standardisierte Programme, die beispielsweise Alarme nur bei bestimmten Schwellenwerten auslösen, sind unzureichend. Zum Thema Software ist noch zu ergänzen, dass Standardoberflächen, die ein Benutzer schon von anderen Programmen kennt, und eine Standardbedienung über Webbrowser zu bevorzugen sind. Der Anwender findet sich leichter zurecht.
Alarmmeldungen an ein Managementsystem sind unverzichtbar, doch SMS oder E-Mail sind eine nette Spielerei und werden auch selten verlangt. Besser sind optische und akustische Alarmmelder zur direkten Information des Personals vor Ort.
Bei der Montage der Messwertaufnehmer ist es hinderlich, wenn der Techniker analoge und digitale Aufnehmer über unterschiedliche Module anschließen muss oder für jede Überwachungsaufgabe ein separates Gateway benötigt.
Ebenfalls störend wirkt es sich aus, wenn die maximale Übertragungsstrecke zwischen Sensor und Überwachungsgerät zu gering bemessen ist. Beide Faktoren schränken die Flexibilität bei der Konfiguration der Überwachungsanlage unnötig ein, führen zu erheblichen Mehrkosten und lassen später nur bedingt Änderungen zu, wenn plötzlich weitere Module oder Geräte notwendig werden. Moderne Systeme sind modular aufgebaut und überwachen Temperatur, Luftfeuchtigkeit sowie die Signalausgänge von USVs. Sie verwalten zum Beispiel elektronische Schließsysteme oder können mit Rauchmeldern, Erschütterungssensoren, Bewegungsmeldern oder Leckagesensoren ausgestattet werden. Viele Systeme können auch Kontakte des Gebäudemanagements und von Schaltanlagen einbinden. Neben der Messung von Netzstrom und Netzspannung sollte das System zudem die Stromstärke einzelner Schaltkreise schon im Schaltschrank erfassen können und Stromzähler enthalten, die fernauslesbar sind.
Baukastensysteme
Der Anwender stellt sich sein Überwachungssystem nach dem Baukastenprinzip zusammen und kann es bei Bedarf erweitern oder verändern. Neu angebrachte Peripheriemodule melden sich bei bedienerfreundlichen Systemen selbst an, werden einmal konfiguriert und sind danach beliebig oft in unterschiedlichen Überwachungsansichten auf der grafischen Oberfläche platzierbar. Das System sollte Alarme, Parameter und Ereignisse lückenlos erfassen, sammeln und abspeichern. Auch ein Daten-Logging ausgewählter Sensoren in definierbaren Intervallen ist bei manchen Systemen intern und extern möglich. Wichtig ist zudem, dass ein Akku dafür sorgt, dass die Alarmierung auch bei Netzspannungsausfall gewährleistet ist.
Die Verkabelung der Peripheriemodule und der Schränke untereinander sollte mit handelsüblichen Datenkabeln realisierbar sein. Es gibt Systeme, die nur mit einer Überwachungseinheit und direkt daran angeschlossenen Sensoren/Aktoren arbeiten, und Systeme, die für komplexere Anwendungen einen Peripheriebusverteiler und Eingabemodule einbinden können. Ein wichtiges Auswahlkriterium ist bei größeren Rechenzentren auch die maximal anschließbare Anzahl von Sensoren/Aktoren und die generelle Skalierbarkeit des Systems. Darüber hinaus ist es wichtig, dass die Lösung eine übersichtliche Bedienoberfläche aufweist, die dem Anwender einen Überblick über die wichtigsten Ereignisse liefert und nicht überfrachtet ist. Außerdem sollte der Hersteller das System kontinuierlich weiterenwickeln.