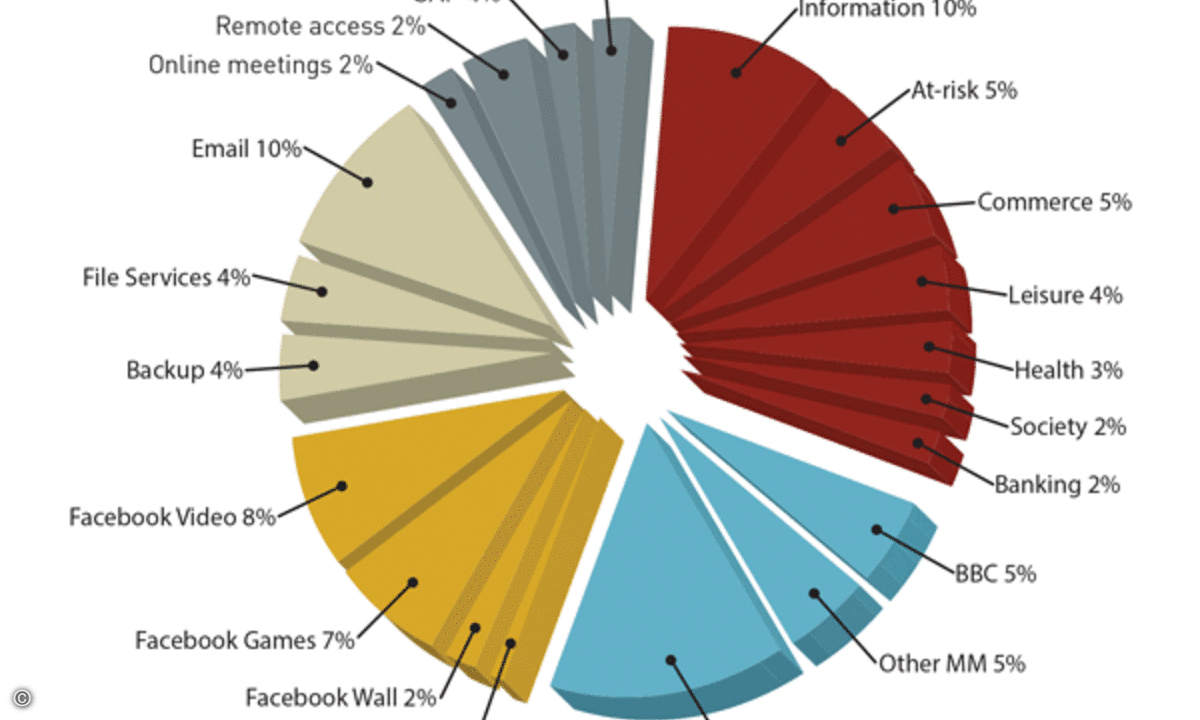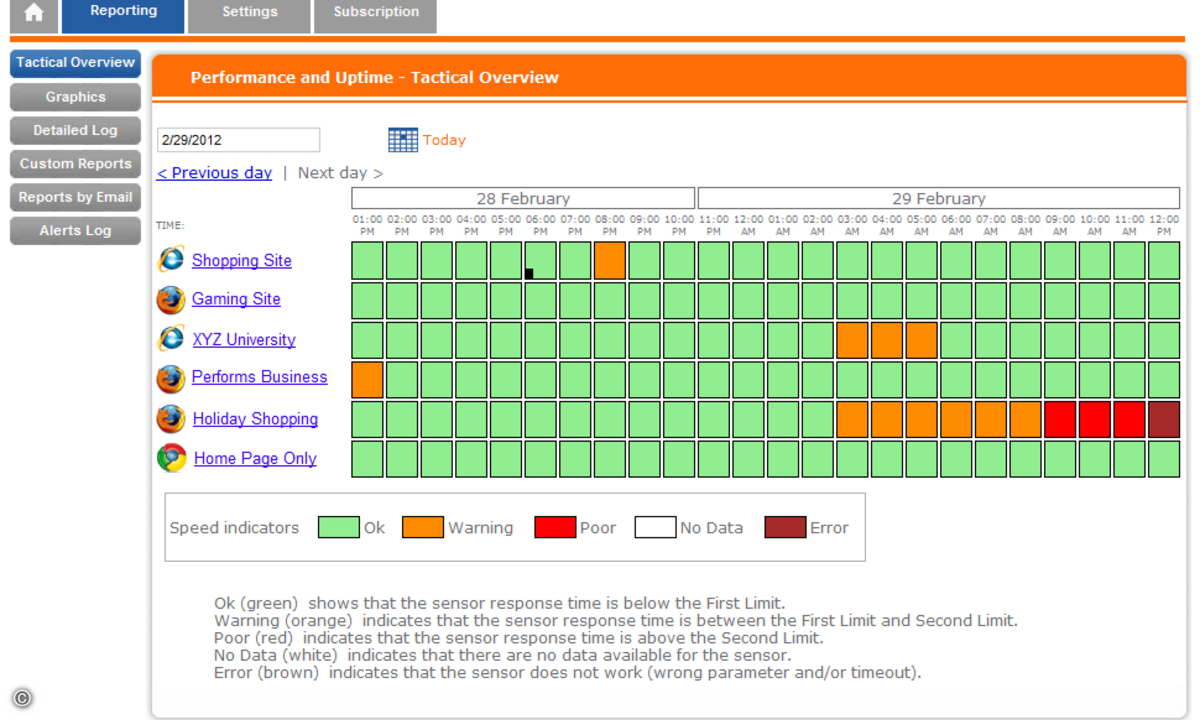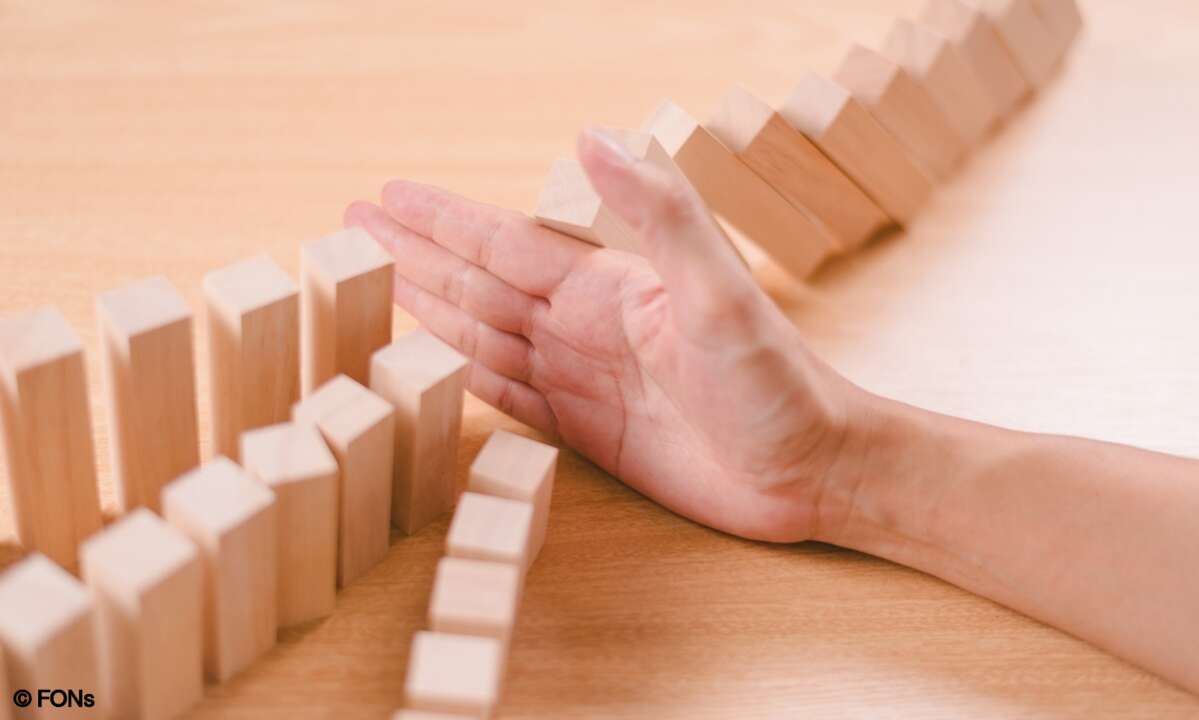Firewall sichert Web?Anwendungen
Web-Anwendungen bedürfen eines speziellen Schutzes, den herkömmliche Firewalls nicht bieten können. Hier sind Web Application Firewalls gefragt, die in der Lage sind, HTTP-Anfragen und -Antworten zu prüfen und auch weitere Schutzmechanismen bieten.Web-Anwendungen, unabhängig davon, ob es sich um die Internet-Filiale einer Bank, einen Online-Shop, ein Kunden?, Partner- oder Mitarbeiterportal handelt, werden nicht zuletzt aufgrund der rasant steigenden Beliebtheit des Internets für Angreifer immer attraktiver. Die OWASP-Community (Open Web Application Security) hat eine Top-Ten-Liste für 2010 zu den größten Risiken dieser Anwendungen veröffentlicht. Dies sind in erster Linie SQL- oder LDAP-Injection über Formularfelder, Cross Site Scripting, Session Hijacking legitimer Benutzer oder Phishing-Seiten, die einzelne Bestandteile einer Web-Applikation wie etwa Grafiken und Formulare integrieren oder auf die Web-Applikation zurück verlinken. Die Angriffe zielen dabei auf Schwachstellen in den Web-Anwendungen selbst - und nicht auf solche auf der Netzwerkebene. Auch ist es ein Irrtum zu glauben, dass eine unsichere Web-Applikation zu keinem Schaden führen kann, wenn diese Applikation selbst keine sensiblen Daten verarbeitet und keine sicherheitsrelevanten Funktionen ausführt: Ein einziges unsicheres Web-Programm kann die Sicherheit des gesamten IT-Systems gefährden, warnen die Experten der OWASP, denn genau diese Web-Applikation kann als Zugang für den Angriff dienen, um etwa Adressen, Bankverbindungen oder Kreditkartendaten eines Kunden zu stehlen oder um Industriespionage zu betreiben. Das prinzipielle Problem des Schutzes für Web-Anwendungen besteht darin, dass das Protokoll HTTP nicht für die heute üblichen komplexen Anwendungen konzipiert wurde. Viele Schwachstellen haben darin ihren Ursprung, denn beispielsweise ist HTTP zustandslos, das heißt Sessions oder Zustände der Applikation müssen separat definiert und sicher implementiert sein. Deshalb lassen sie sich auch du