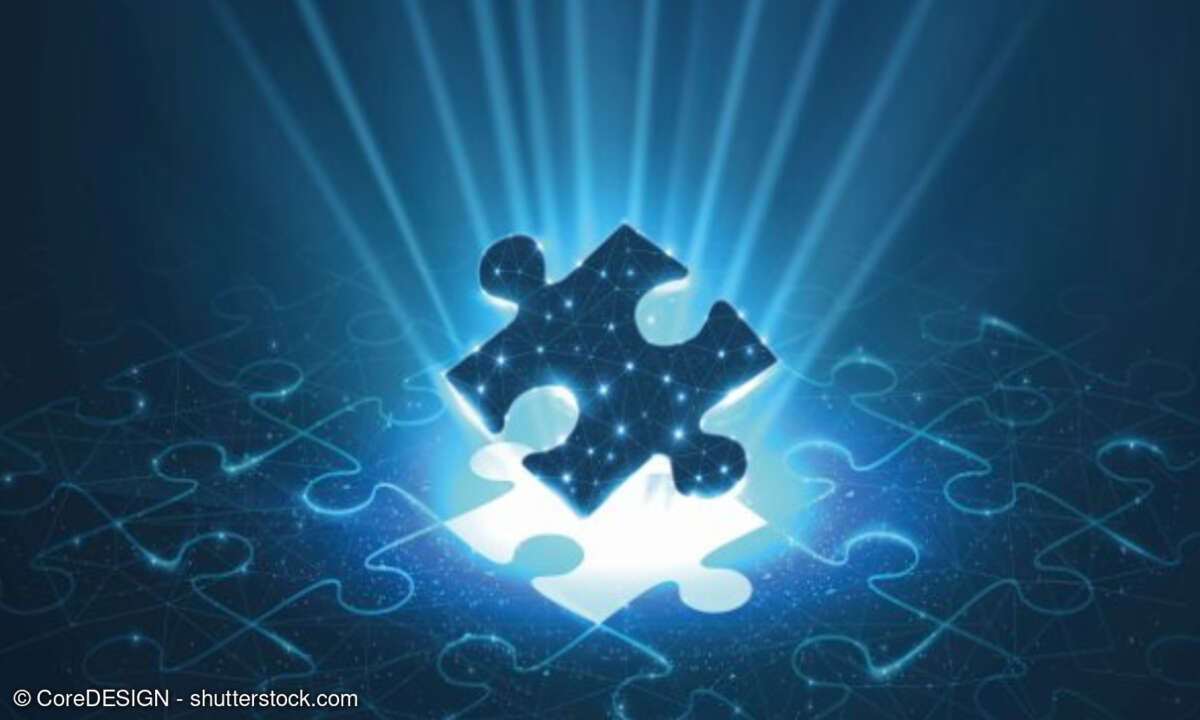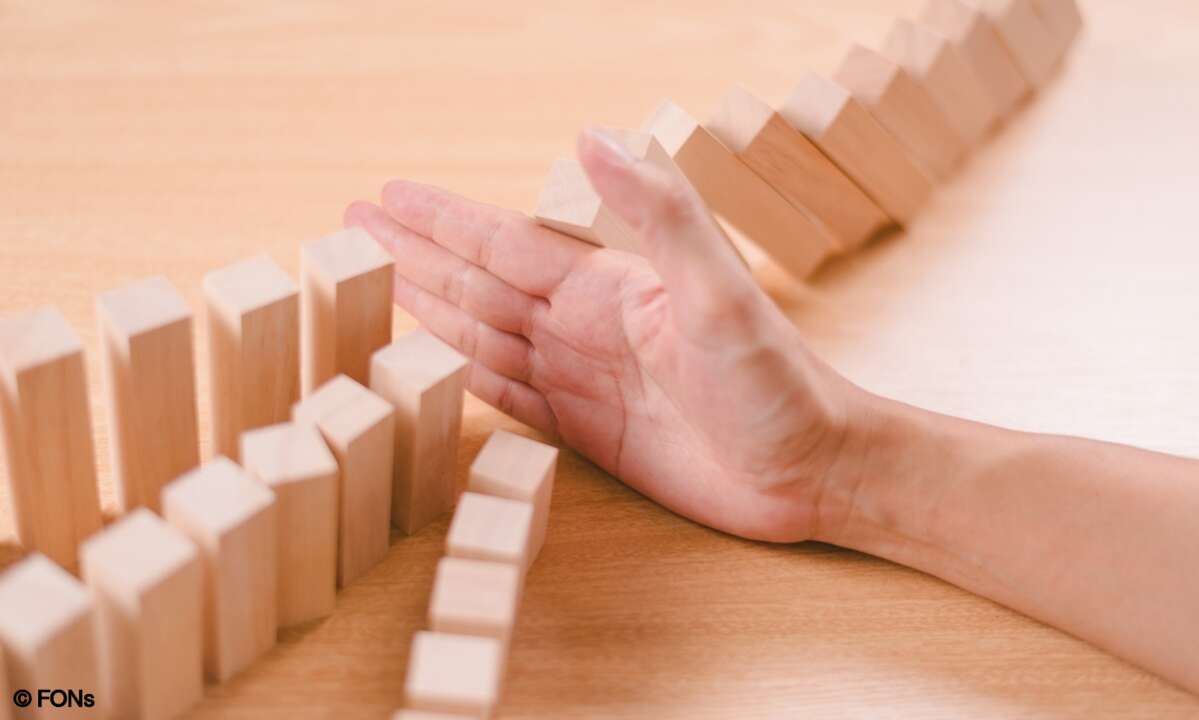Mobile Lösungen im Gesundheitswesen
Das Gesundheitswesen implementiert bereits drahtlose Lösungen, während viele andere Wirtschaftszweige hinterherhinken. Von den Funklösungen profitieren alle Bereiche des Medizinbetriebs: vom beratenden Arzt, der auf der Station von Bett zu Bett geht, bis zur ersten Hilfe am Unfallort. Drahtlose Netze tragen maßgeblich zur Entwicklung erstklassiger klinischer Leistungen bei.
Drahtlose Netze in Kliniken bewirken, dass Daten in wenigen Schritten verarbeitet werden. Die
Mitarbeiter im Gesundheitswesen haben sicheren Zugriff auf mobile klinische Anwendungen. So sinkt
das Risiko von Transkriptionsfehlern – welche Dosis hat der Arzt hier notiert? – und die
Pflegequalität steigt.
Voice-over-WLAN-Systeme (VoWLAN) verbessern die Reaktionszeiten auf dem Gelände. Darüber hinaus
optimieren Echtzeit-Lokalisierungsdienste (Real Time Location Services, RTLS), kombiniert mit
Barcode-Scannern, unter anderem die Medikamentenabgabe an Patienten. Medikamente können
einschließlich ihrer Lagerbedingungen zwischen Aufbewahrungslager und Einsatzort genau verfolgt
werden. Hier ist es sinnvoll, wenn ein Barcode-System die Medikation eines Patienten erfasst und
dann in die Verwaltungssysteme einspeist. So nämlich lässt sich auf umfassende Informationen über
die Modalitäten jeder einzelnen Verabreichung zurückgreifen. Dieses Verfahren verhindert die
Verabreichung von Medikamenten, die nicht zum Patienten oder seinen übrigen Medikamenten gehören,
denn die entsprechenden Daten werden auch in die Medikamentendokumentation der elektronischen
Patientenakte eingespeist.
In einer Klinik sollte bekannt sein, wo sich teure und kritische Geräte befinden. Die Firmware
medizinischer Systeme etwa muss regelmäßig aktualisiert werden. Kann der zuständige biomedizinische
Ingenieur das betreffende Gerät nicht finden, wird es vielleicht wieder eingesetzt, obwohl es wegen
veralteter Software fehlerhaft arbeitet. Außerdem sinkt der Gerätebedarf insgesamt, wenn die
vorhandenen Systeme jederzeit tatsächlich greifbar sind.
Lokalisierungsdienste
Auch sollte bekannt sein, wo sich besonders verletzliche Patienten aufhalten. Dabei helfen
batteriebetriebene Sender für Patienten oder Geräte. Sie lassen sich innerhalb von Minuten oder
sogar in Sekunden lokalisieren. Überschreitet ein solcher Sender vordefinierte räumliche
Begrenzungen, löst dies automatisch Alarm aus.
Batteriebetriebene Sender (Tags) gibt es in unterschiedlichen Größen. Viele besitzen
Leuchtdioden und akustische Signale, denn die Lokalisierung ist in der Regel nur auf wenige Meter
genau. Wer Geräte sucht, erkennt an visuellen oder akustischen Signalen, um welches von mehreren
Systemen in der näheren Umgebung es sich handelt. Üblich sind auch Basis-Zweiwegekommunikation,
Temperatursensoren (besonders beim Einsatz in Medikamentenlagern) und die telemetrische Erfassung
weiterer Daten (Druck, Flüssigkeitsstand und so weiter).
Je nach Anwendung unterscheidet sich die Genauigkeit der Lokalisierung. Sie kann zwischen drei
und fünf Metern (entspricht einem Raum oder einem Teil der Station) oder nur einem Meter betragen
(an Aus- oder Durchgängen). Die Lokalisierung an Aus- oder Durchgängen ist relativ einfach. Tags
für solche Anwendungen haben eine Standard-Wi-Fi-Schnittstelle. Ein Impulsgeber ("Exciter")
triggert sie. Er erzeugt ein Niederfrequenzsignal (125 MHz) unmittelbar an der Tür oder dem
Durchlass.
Für allgemeine Lokalisierungsanwendungen sehen die Systeme anders aus. Sie werten meist die
Stärke der empfangenen Signale aus. Am einfachsten ist es dabei, die Signalstärke des zu
verfolgenden Geräts an einem Access Point (AP) zu messen. Wenn man die Stärke des Empfangssignals
(Received Signal Strength Indication, RSSI) misst, kann man die Entfernung, nicht aber die Richtung
schätzen. Deshalb müssen für eine Lokalisierung jeweils mindestens drei APs im Netzwerk die
Signalstärke des Clients messen. Die Genauigkeit der Lokalisierung hängt dabei von zwei Faktoren
ab:
Von der Genauigkeit jeder einzelnen Messung. Der RSSI-Wert mag exakt sein,
doch können bei mobilen Clients verschiedene Faktoren das Signal modifizieren: die
Antennenausrichtung, organisches Material (Menschen) im Datenweg, Hindernisse wie feste Wände oder
Abgrenzungen und Metallgegenstände.
Von der Entfernung selbst. Je größer sie ist, desto ungenauer ist auch die
Messung. Die Genauigkeit einer RSSI-basierenden Distanzschätzung ist ungefähr proportional zur
tatsächlichen Entfernung zwischen AP und Client.
Viele Kliniken implementieren Lokalisierungsdienste gemeinsam mit VoIP-Telefonlösungen (Voice
over IP), etwa Schwesternrufsystemen. Je mehr APs für beides benötigt werden (üblich ist eine
Abdeckung von 150 Prozent), desto besser, denn sie ergänzen sich. Je mehr APs insgesamt
implementiert sind, desto genauer arbeitet die Lokalisierungslösung.
Einige Hersteller bieten Systeme an, die RSSI-Rohdaten weiterverarbeiten. Dafür verwenden sie
statistische Methoden und die Ergebnisse von Überblicksmessungen. Dies kann unter entsprechenden
Bedingungen zu sehr guten Resultaten führen. Allerdings steigt der Aufwand: Die Funkbedingungen im
gesamten Klinikgebäude müssen genau ausgemessen werden. Dafür braucht man spezielle Geräte und
meist eine separate Rechnerplattform im Netz.
Zwar verbessern Techniken wie die Analyse von Baumaterialien und Vor-Ort-Kalibrierung die
Genauigkeit von RSSI-Messungen – allerdings steigern sie die Kosten und die Komplexität im Netz.
Gleichzeitig verringert sich das erreichte Plus an Genauigkeit im Laufe der Zeit durch Änderungen
der Infrastruktur.
Allerdings gibt es auch Lösungen, die ihre Sendestärke automatisch kalibrieren. Mit solchen
Lösungen sind händische Vor-Ort-Messungen der Funkumgebung nicht mehr nötig. Sinnvoll ist es, eine
selbstkalibrierende Lösung zusammen mit einem engmaschigen Netz (Grid) drahtloser APs zu
implementieren. Dann lassen sich Sender mit einer Genauigkeit von wenigen Metern lokalisieren.
Bietet die WLAN-Lösung gleichzeitig auch noch Air-Monitoring (Überwachung des Funkraums auf
unerlaubte Eindringlinge und Geräte), verbessert dies die Genauigkeit der Lokalisierung weiter.
Funkumgebungen Meter für Meter manuell auszumessen, ist aufwändig. Hierfür müssen
Netzwerkmanager jedes einzelne Funkhindernis und alle Baumaterialien in den Gebäudeplan eintragen.
Das drahtlose Grid dagegen kalibriert sich selbst. Jeder AP schaltet der Reihe nach in den
Air-Monitor-Modus. Dabei erfasst er exakt die RSSI-Werte für alle APs innerhalb der entsprechenden
Reichweite, und bei engmaschigen Funk-Grids sind das recht viele. So entsteht ein Abbild der
gebäudeinternen Funkumgebung. Viele Gebäudebereiche werden anhand von Echtzeitdaten, die direkt aus
der existierenden Infrastruktur stammen, spezifisch kalibriert. Die resultierenden Messergebnisse
werden in eine Datenbank eingetragen und dann verwendet, um die Rohdaten der RSSI-Messungen
entsprechend der Messdaten des kalibrierten Standorts zu nutzen.
Eine hohe AP-Dichte ermöglicht viele Messungen. Dies steigert die Genauigkeit von
Lokalisierungen gleich dreifach:
Deutlich mehr APs sind in Client-Reichweite. So entstehen mehr Messwerte und
somit genauere Lokalisierungen.
Die Entfernung zum nächsten AP ist erheblich kleiner als in einem
traditionellen Netzwerk mit wenigen APs.
Viele APs transportieren aktuell keine Daten. Diese APs sind permanent im
Air-Monitoring-Modus. So werden langfristige Messreihen für jede Stelle innerhalb der Funkumgebung
möglich, aus denen sich über die Zeit gemittelte RSSI-Messwerte berechnen lassen.
Die Ergebnisse dieser Methode sind besser als die der Modellierung der Baumaterialien. Sie sind
genau so gut wie die der Client-Kalibrierung, allerdings ohne ihre Nachteile: Vor-Ort-Messungen
entfallen, und Veränderungen der Sendestärke nimmt die Infrastruktur selbsttätig vor.