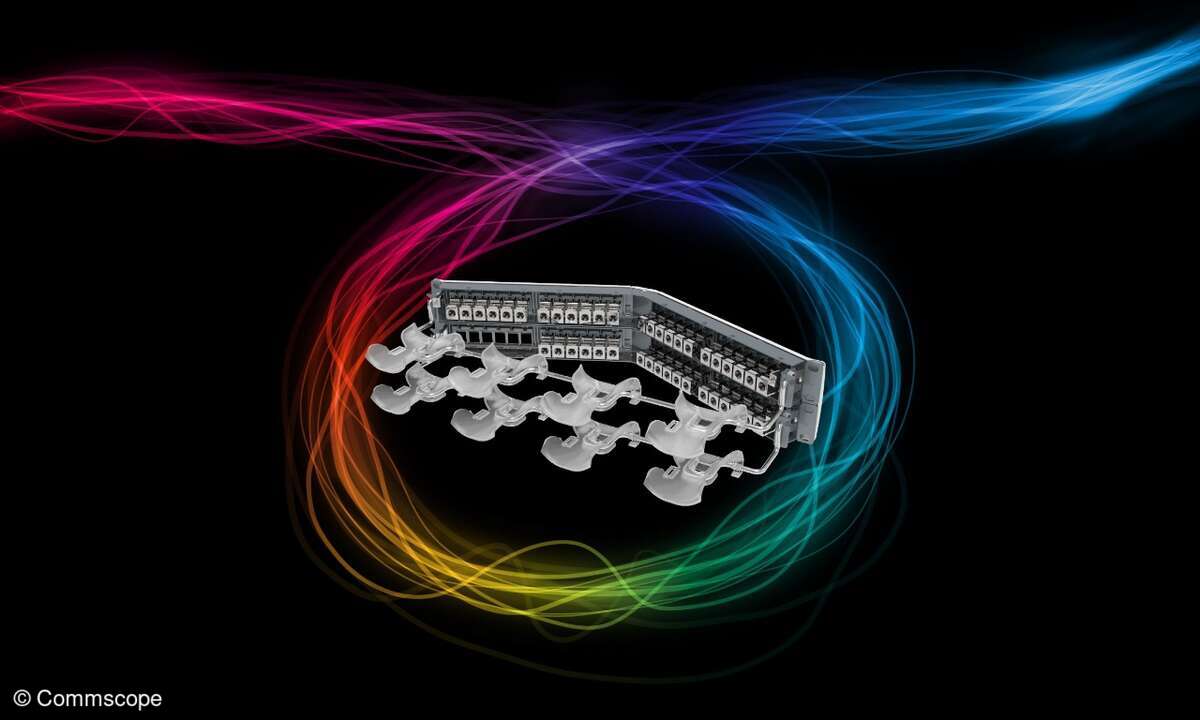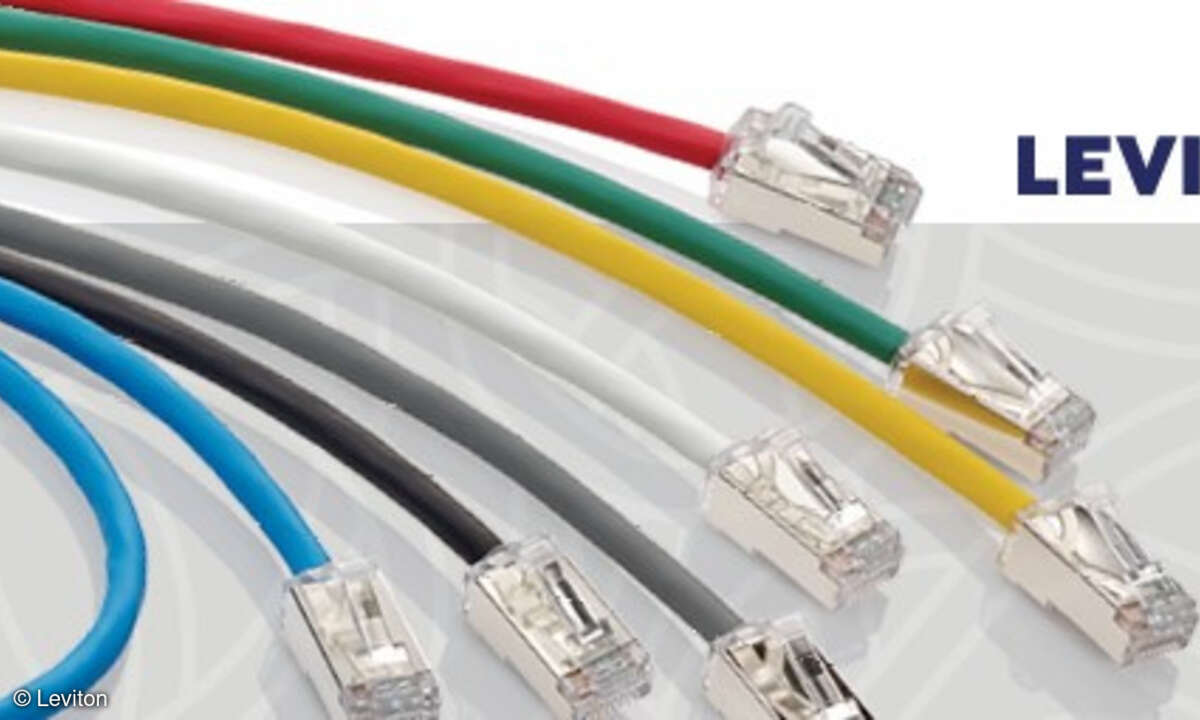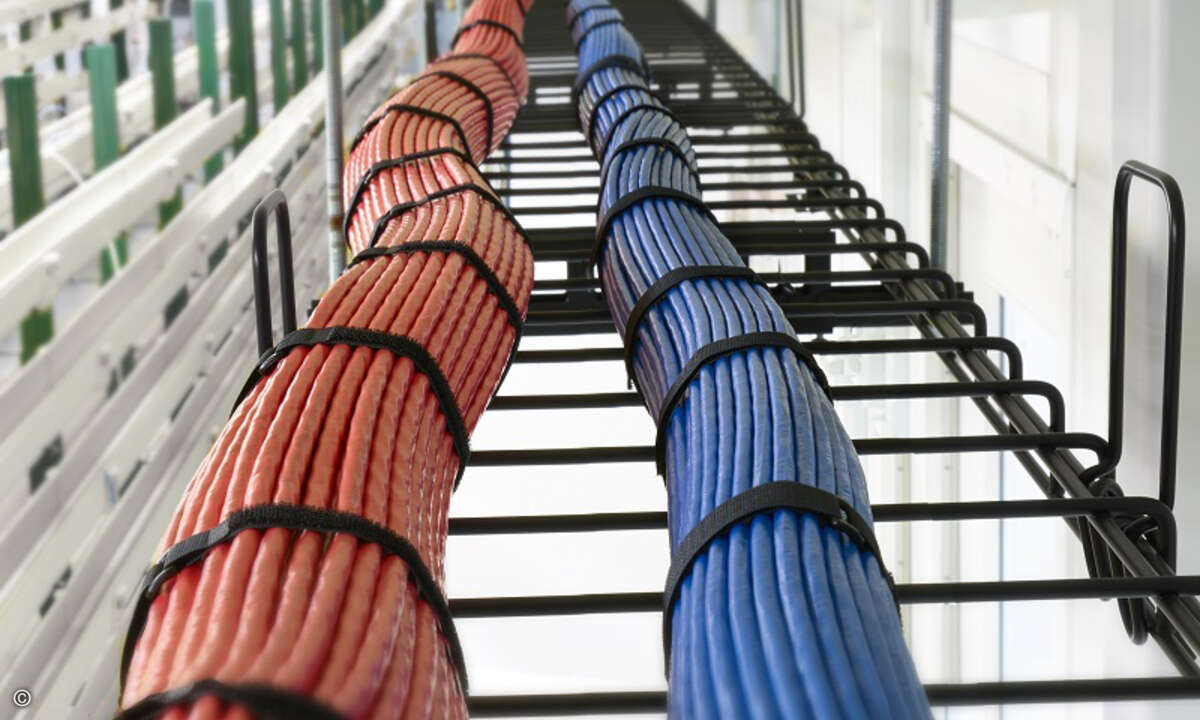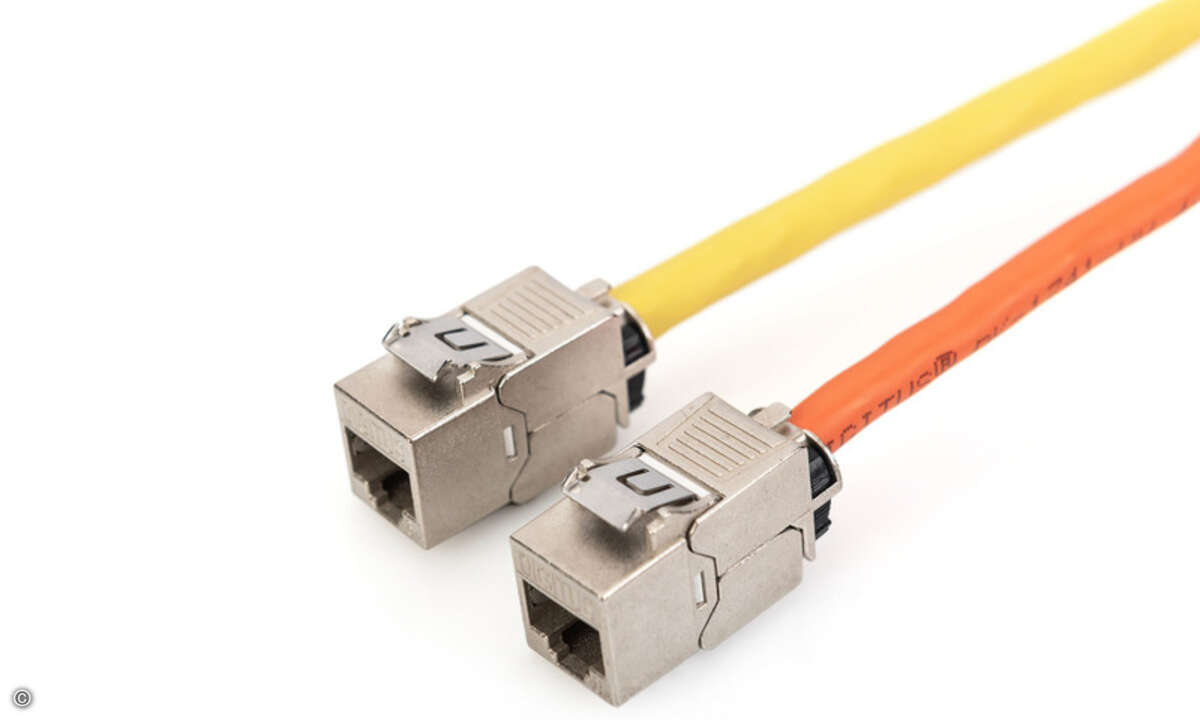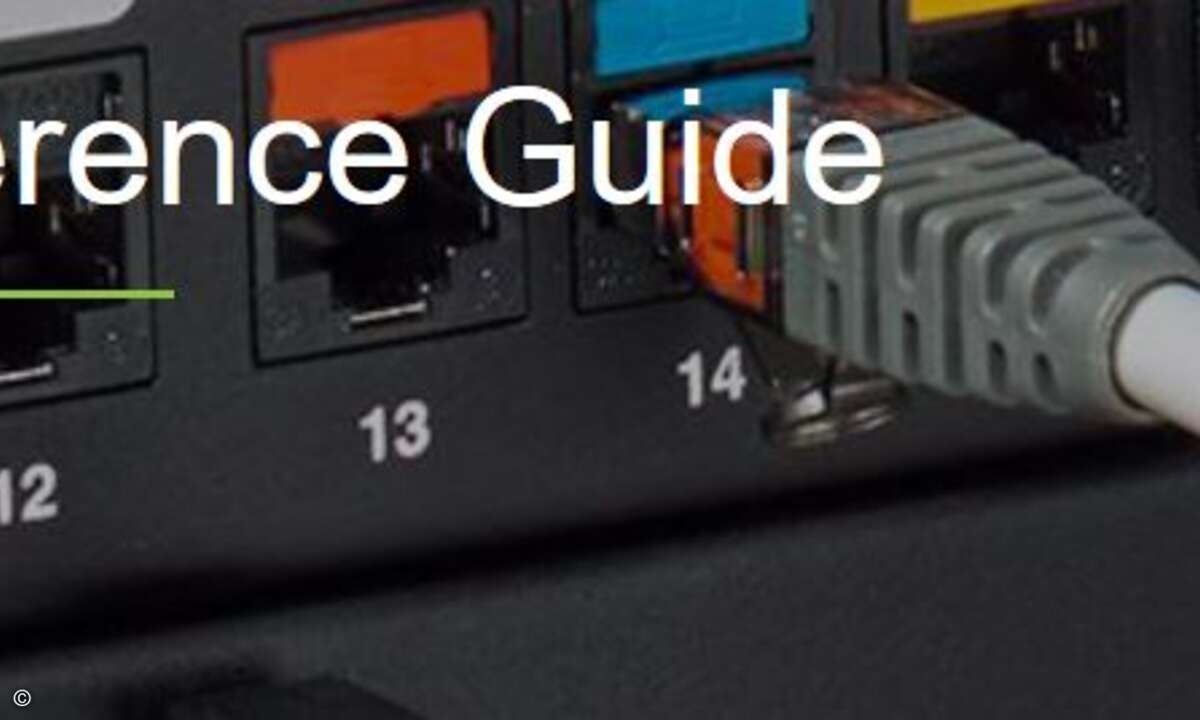Kleiner Unterschied, große Wirkung
Neue Standards für die Kupferverkabelung ebnen den Weg zur Hochleistungs-Datenübertragung in Gebäuden, Industrieanlagen und Rechenzentren. Wer die gewünschte Leistung nachhaltig sicherstellen will, muss jedoch bei Planung und Auswahl der Komponenten die Stolperfallen in der Nomenklatur beachten.
Mit der Einführung von 10 Gigabit Ethernet über Twisted-Pair-Kupferkabel entstanden neue Klassen
von Verkabelungsstandards. Die EIA/TIA veröffentlichte den Standard Cat.6A im Februar 2008 und die
ISO/IEC den Channel-Standard Klasse EA etwa zur gleichen Zeit. Leider definieren diese beiden
Standards nicht dieselbe Leistung, was im Markt zu gewissen Verwirrungen führt. Dies verstärkt sich
noch bei einem Blick auf die Komponenten, insbesondere auf die Anschlussmodule und
Steckverbindungen. EIA/TIA und ISO/IEC spezifizieren unterschiedliche Leistungen für die Module,
verwenden aber sehr ähnliche Bezeichnungen für die Komponenten. Deshalb ist besondere Vorsicht
geboten, sonst erhalten Anwender möglicherweise nicht die Leistung, die sie erwarten.
Neue Verkabelungsstandards
Das IEEE-Protokoll für 10 Gigabit Ethernet über Twisted-Pair-Kupferkabel (802.3an) wurde im Juli
2006 veröffentlicht. Da es den genutzten Frequenzbereich auf 500 MHz erweiterte und die Verkabelung
gemäß Cat.6 nur für 250 MHz definiert war, standen konsequenterweise zur Unterstützung dieses
Protokolls neue Verkabelungsstandards an. Alternativ wäre Cat.7-Verkabelung, die für 600 MHz
ausgelegt ist, von Anfang an eine Option gewesen. Da Cat.7 jedoch weltweit nur einen Marktanteil
von vier Prozent hat, hätte diese Option den Erfolg des neuen Ethernet-Protokolls nicht
sicherstellen können.
Im Standard 802.3an legte die IEEE die minimalen Channel-Anforderungen fest, die von der
Verkabelung erfüllt werden müssen, damit das Protokoll einsetzbar ist. Tatsächlich könnte ein
gutes, geschirmtes Cat.6-System, das bei höheren Frequenzen stabil arbeitet, diese
Mindestanforderungen erfüllen. Beispiele sind die geschirmten Real-10-Systeme von Reichle &
DeMassari.
Allerdings stellt Fremdnebensprechen ein Problem für ungeschirmte Systeme dar. Aufgrund der
Nutzung höherer Frequenzen und des Einsatzes komplexer Codierverfahren ist die geringe Signalstärke
bei 10GbE deutlich anfälliger für Störungen von außen, als dies bei früheren Protokollen der Fall
war. Dies führte zu einer Längenbegrenzung für ungeschirmte Cat.6-Systeme.
Die verschiedenen Normengremien begannen deshalb mit der Arbeit an der Spezifikation neuer
Verkabelungsklassen für 500 MHz, die auf der RJ45-Technik basieren. Die EIA/TIA veröffentlichte
ihren Standard Cat.6A im Februar 2008 und zur gleichen Zeit verabschiedete ISO/IEC die
Channel-Anforderungen für Class EA. Leider ist in diesen Standards nicht dieselbe Performance
spezifiziert. Bild 1 zeigt die Unterschiede für den Channel-Parameter NEXT. Die
Channel-Anforderungen für EIA/TIA Cat.6A zeigen ab 330 MHz einen moderaten Abfall der
Dämpfungskurve um 27 dB, während für den Channel nach ISO/IEC Class EA eine gerade Linie definiert
ist.
Das Konzept nach ISO/IEC ermöglicht also die höchste verfügbare und beste Übertragungsleistung
in der Twisted-Pair-Kupferverkabelung auf Basis der RJ45-Technik. Bei 500 MHz bedeutet dies, dass
für Class EA eine um 1,8 dB bessere NEXT-Performance erforderlich ist als für einen Channel mit
Cat.6A. In der Praxis führt dieser hohe Anspruch zu einer höheren Betriebssicherheit des Netzwerks
und somit zu weniger Übertragungsfehlern. Damit ist auch die Grundlage für eine wesentlich längere
Nutzungs- und Lebensdauer der Verkabelungsinfrastruktur gelegt.
Die Bedeutung der Komponenten
Nachdem die Channel-Standards klar sind, besteht der nächste Schritt darin, die
Komponentenstandards zu definieren. Die EIA/TIA legte die Spezifikationen für Channel, Link und
Komponenten in einem Paket fest. Alles ist in dem bereits verabschiedeten Standard Cat.6A
(568B.2-10) enthalten. ISO/IEC definierte zuerst die Spezifikationen für den Channel in Anhang 1
und arbeitet an den Definitionen für den Permanent Link und für die Komponenten im
Anhang 2.
Anforderungen der Kunden sind der Grund dafür, dass man den einzelnen Standards für Komponenten
so große Aufmerksamkeit widmet. Kunden fordern offene Systeme und Interoperabilität und die
Möglichkeit, Komponenten von verschiedenen Anbietern gemischt einzusetzen und dennoch die Garantie
zu haben, dass die entsprechende Channel-Performance erreicht wird. Beispielsweise sollten ein
Cat.6-Modul von Anbieter X, ein Cat.6-Installationskabel von Anbieter Y und ein Cat.6-Patch-Kabel
von Anbieter Z kombinierbar sein, um die Leistung der Class E zu erreichen.
Zwölf Referenzstecker
Um die geforderte Interoperabilität sicherzustellen, entstand im Jahr 2003 der De-embedded-Test.
Dabei kommt eine definierte "bekannte" Referenzbuchse zum Einsatz, um Stecker in einer
Steckverbindung zu testen. Die Werte der Referenzbuchse werden von den Werten der Steckverbindung
abgezogen oder getrennt (de-embedded), um die NEXT-Merkmale des Steckers zu ermitteln. Auf diese
Weise entstehen zwölf qualifizierte Referenzstecker im niedrigen, mittleren und hohen Bereich, die
dann zum Testen der Steckverbindungen bereit stehen.
Für 10 Gigabit Ethernet waren zunächst Systeme im Angebot, die die Channel-Anforderungen des
Protokolls erfüllen sollten. Die neuen Einzelkomponenten und die Spezifikationen für diese
Komponenten sollten wie in der Vergangenheit Interoperabilität und den Einsatz gemischter Systeme
ermöglichen. Für Cat.6A- (EIA/TIA) und Kategorie-6A-Komponenten (ISO/IEC) entstanden in diesem
Zusammenhang Re-embedded-Tests. Die Grundidee ist mit der für De-embedded-Tests vergleichbar. Hier
wird jedoch zuerst der Referenzstecker durch eine neue, präzisere Messmethode qualifiziert –
Direktmessung (direct probing) genannt. Dann wird die Differenz zwischen diesem Referenzstecker und
den zwölf De-embedded-Referenzstreckern ermittelt. Im dritten Schritt testet man das zu prüfende
Produkt am ersten Referenzstecker. Schließlich werden die Ergebnisse rechnerisch ermittelt, die man
mit den zwölf De-embedded-Referenzsteckern erhalten hätte – anstatt sie einzeln durchzutesten.
In der Essenz wurde das gesamte Testverfahren mit zwölf De-embedded-Referenzsteckern durch eine
einzige, aber sehr genaue Messung und anschließende Berechnung der Schwankungsbreite im
Steckersortiment ersetzt. Dies führt zu schnelleren, aber auch konsistenteren Testergebnissen. Wie
beim Channel ist mit einem Katgorie-6A-Stecker gemäß ISO-Spezifikation eine höhere Leistung
erreichbar als mit einem Cat.6A-Stecker gemäß EIA/TIA-Spezifikation.
Nach dem aktuellen Entwurf ist ein 40dB-Dämpfungsabfall ab 250 MHz für Cat.6A und ein
30dB-Abfall für Kategorie 6A vorgesehen. Bei 500 MHz bedeutet dies, dass ein Kategorie-6A-Modul
mindestens eine um 3 dB bessere NEXT-Performance als ein Modul der Cat.6A erreichen muss
(Bild 2).
Auf Produktbezeichnung achten
Mit der Standardisierung der Komponenten für Steckverbindungen und Verkabelung hat eine
allgemeine Verwirrung eingesetzt. Die Spezifikation der Komponenten, die für die Cat.6A-Performance
eines Channels gemäß EIA/TIA benötigt werden, unterscheiden sich deutlich und sind weniger streng
als die Spezifikationen, die ISO/IEC für die Performance eines Channels der Class EA ansetzt.
Deshalb müssen Anwender, die einen sicheren Class EA Channel haben wollen, Komponenten einsetzen,
die den Kategorie-6A-Spezifikationen gemäß ISO/IEC entsprechen. Ein Channel, der aus
Cat.6A-Komponenten gemäß EIA/TIA besteht, garantiert keine Performance gemäß Class EA. Der
Unterschied in Bezug auf das A – ob es tief gestellt ist oder nicht – ist daher sehr wichtig:
Cat.6A ist nicht gleich Cat. 6A (in der LANline-Schreibweise: Kategorie 6A). Die Tabelle 1 bietet
Netzwerkplanern eine Übersicht der Leistungsbereiche und Nomenklatur nach den hier diskutierten
Standards.
Komplexe physikalische Herausforderung
Skeptiker können vielleicht fragen, warum die ISO/IEC mehr Zeit zur Spezifikation der
Komponenten benötigt als die EIA/TIA. Ein Grund dafür ist die unterschiedliche
Organisationsstruktur. Bei ISO/IEC sind verschiedene Gremien für die Spezifikationen der
Verkabelung, der Kabel und der Hardware für Steckverbindungen zuständig. Die Koordination zwischen
den verschiedenen Gruppen benötigt natürlich mehr Zeit als bei EIA/TIA, wo alle beteiligten
Parteien in einer einzigen Gruppe versammelt sind.
Ein anderer Grund ist jedoch die technische Komplexität und die Tatsache, dass man unbekanntes
Terrain betritt. Bis heute kennen die Experten zwar das Verhalten der Komponenten in den
niedrigeren Frequenzbereichen. Sie wissen, wie sie im Bereich bis 250 MHz gut zusammenarbeiten.
Jetzt verdoppelt sich jedoch die Frequenz, und die Modellierungsmethode, die für diese höheren
Frequenzen eingesetzt wird, ist nicht stabil. Die Modellierung muss Zweit- und Dritteffekte (zum
Beispiel Crossmodal-Kopplungen) berücksichtigen, was allein die physikalische Komplexität deutlich
erhöht (Bild 3). Die relevanten Erscheinungen treten bei Cat.7-Systemen nicht so häufig auf, weil
hier eine andere Kontaktgeometrie definiert ist, durch die die Adernpaare voneinander getrennt
sind.
Um die Class-EA-Channel-Performance zu erreichen, muss ein Modul der Kategorie 6A, wie bereits
erwähnt, bei 500 MHz einen um 3 dB besseren NEXT-Wert als ein Modul der Cat.6A aufweisen. Dies ist
signifikant. Um die geforderten Werte zu erreichen, sind von Grund auf neue Module nötig, denn
allein durch eine Veränderung des bestehenden Designs – wie es häufig bei aktuell auf dem Markt
erhältlichen Cat.6A-Modulen zu sehen ist – lässt sich die geforderte Dämpfungsreserve nicht
erreichen. Vor allem sind mehr Kompensationselemente nötigt, um die erwähnten zusätzlichen
Kopplungseffekte auszugleichen. Ein größerer Aufwand ist erforderlich, um die Adernpaare am
Endpunkt voneinander zu trennen. Der Prozess des Aufschaltens oder Kontaktierens muss sehr präzise
und garantiert fehlerfrei erfolgen, um eine konsistente Übertragung der Signale
sicherzustellen.
Heute ist ein Class EA Channel die leistungsfähigste Verkabelung, die auf Basis der
vorherrschenden RJ45-Technik verfügbar ist. Der Class EA Channel gewährleistet nicht nur
Unterstützung für die Anwendung von 10 Gigabit Ethernet, sondern ist auch die Grundlage für eine
möglichst lange Nutzungs- und Lebensdauer der Verkabelung sowie für eine höhere Betriebssicherheit.
Aus diesen Gründen empfiehlt sich für neue Installationen zum Betrieb von Hochleistungsdatennetzen
der Einsatz von Class EA Channels.
Wenn Interoperabilität verlangt wird, ist es wichtig, sich für Kategorie-6A-Komponenten zu
entscheiden (gemäß ISO/IEC). Cat.6A-Module gemäß EIA/TIA können die höhere Performance und die
strengen Vorgaben der Class EA nicht garantieren. Auch wenn die Standardisierung der
Kategorie-6A-Komponenten mehr Zeit benötigt, lohnt es sich, auf die zusätzliche Sicherheit und
Performance zu warten, die das ISO/IEC-Konzept verspricht. Es bedeutet letztendlich weniger
Kopfschmerzen für den Anwender.
Parameter für das LAN präzise definieren
Wer ein LAN für Breitbandanwendungen plant und das weit verbreitete, günstige
RJ45-Anschlussformat mit Twisted-Pair-Kupferverkabelung einsetzen will, begegnet neuen Standards.
Die Normengremien von ISO/IEC, EIA/TIA und IEEE haben unterschiedliche Performancekriterien
festgelegt, aber bei der Terminologie ähnliche Bezeichnungen gewählt. Darum muss künftig bei der
Planung präziser definiert werden, welche Parameter man erreichen und welche Komponenten man
einsetzen will. Class EA mit Kategorie 6A bietet die beste Leistung und sicherste Reserve für die
Signalübertragung.