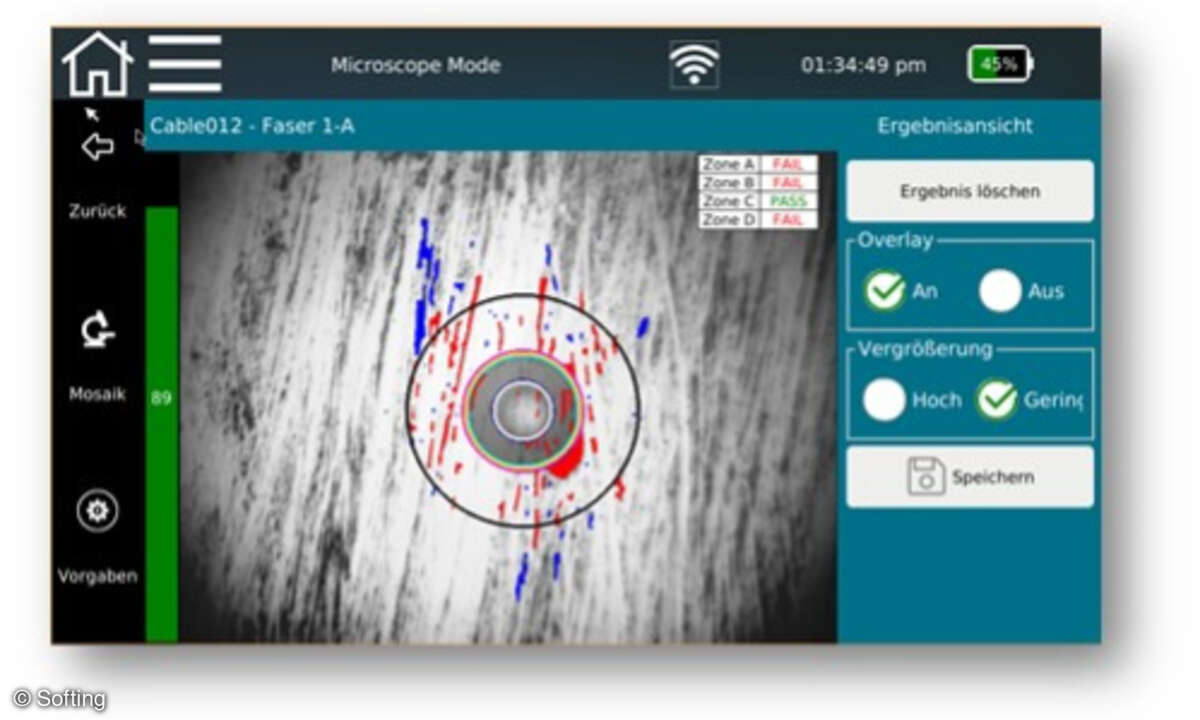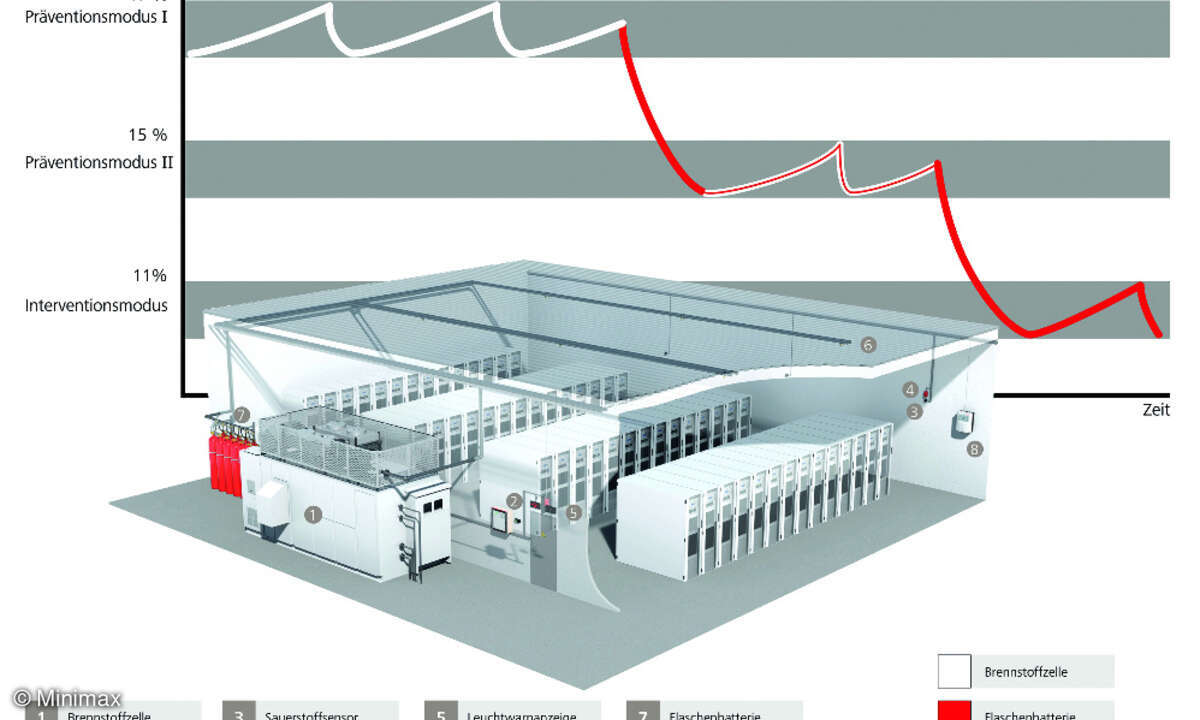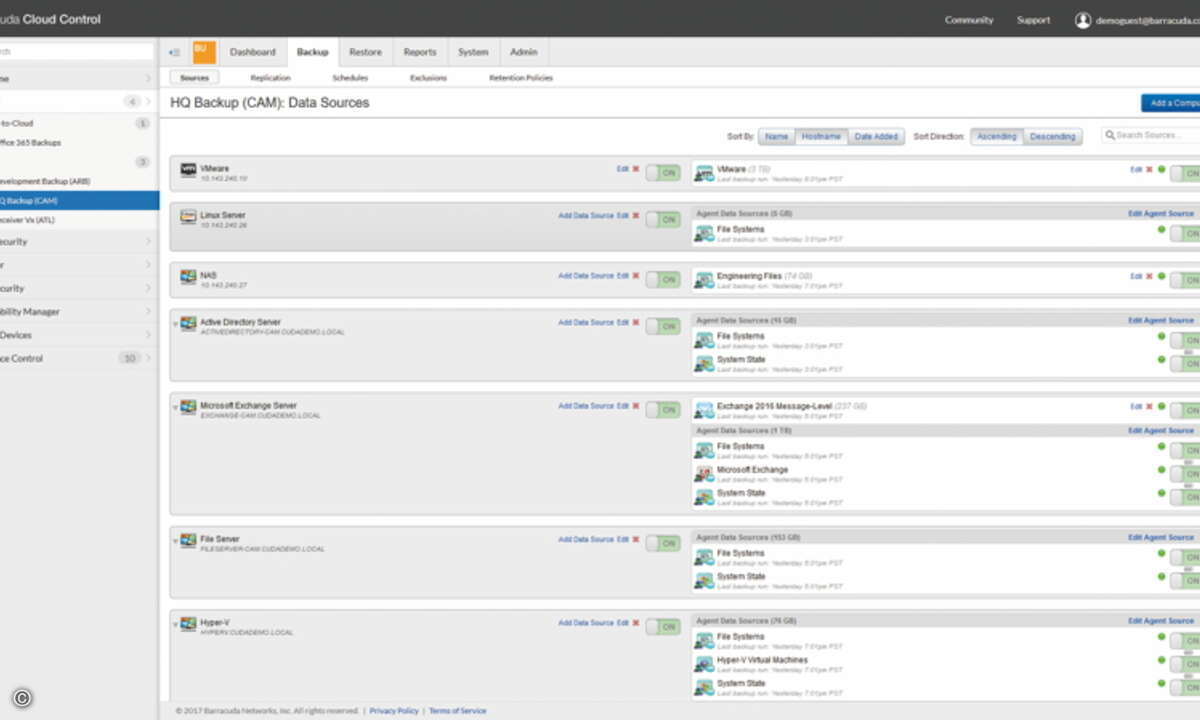Netzkosten im Blickpunkt
Die Unternehmen der Telekommunikationsbranche befinden sich in stürmischer See. Stagnierendes oder gar sinkendes Umsatzwachstum, hohe Betriebskosten und teilweise alarmierende Ver-schuldungsgrade zwingen sie zum Handeln. Dabei haben viele die Optimierungspotenziale in den vergangenen Jahren bereits ausgeschöpft. Doch etwas Spielraum gibt es noch. Ein Beispiel ist die Reduzierung der Netzkosten.
Preisverfall und Umsatzdruck setzen Telekommunikationsanbietern ebenso zu wie verschlankte und
virtuelle Konkurrenzunternehmen, die so genannten virtuellen Mobilnetzbetreiber (MVNO). Viele
Branchen-Player sind gezwungen, vom Jagdmodus auf den Bestandshaltungsmodus umzuschalten. Im
Mittelpunkt steht nicht mehr die Vergrößerung des Kundenstamms um jeden Preis – und damit ein
mitunter ungesundes Umsatzwachstum. Von größerer Bedeutung wird es vielmehr sein, das erreichte
Volumen zu nutzen und dem Profitabilitätsdruck standzuhalten.
Darüber hinaus haben die gegenwärtige Kreditkrise und der daraus resultierende wirtschaftliche
Abschwung das Vertrauen der Investoren erschüttert und damit die finanziellen Ressourcen erheblich
verkleinert. So wird die Finanzierung immer stärker von Fremdkapital auf die Freisetzung interner
Mittel verlagert.
Das Umsatz-Kosten-Traffic-Dilemma
Hinzu kommt, dass die aktuelle Entwicklung von Umsatz und Kosten der gängigen Vorstellung von
Economies of Scale widerspricht: Wenn die Nutzung der Dienste und Volumen eines Betreibers steigt,
geht man üblicherweise von einer Senkung der Kosten aus, indem bestehende Synergien genutzt und
entsprechende Skaleneffekte erzielt werden. Tatsächlich zeigt sich jedoch ein unverhältnismäßiger
Anstieg der Netzkapazität aufgrund der Breitbanddienste bei gleichzeitig stagnierenden oder
unwesentlich steigenden Umsätzen, die wiederum Folge der Flatrates und Preissenkungen sind. Als
Konsequenz ergeben sich abnehmende Skalenerträge, man kann regelrecht von Diseconomies of Scale
sprechen.
Doch wo lassen sich nun die Justierschrauben finden, mit deren Hilfe die Betreiber Investitions-
und Betriebskosten in den Griff bekommen können? Netzkosten machen einen großen Teil der
Kostenstruktur eines Betreibers aus, sie stellen etwa 60 bis 80 Prozent seines Investitionsaufwands
(CAPEX) und etwa 20 bis 30 Prozent seines Betriebsaufwands (OPEX) dar. Die Erfahrung lehrt, dass
der Schwerpunkt auf der Maximierung bestehender Netzkapazitäten liegen sollte, da dieser Ansatz die
gewünschten Leistungseffekte eher auslösen wird als das Aufbohren oder die Erweiterung der
Netzinfrastruktur.
Neue und nachhaltige Netzkostenmodelle
Die Betreiber müssen daher neue Modelle entwickeln, um Netz-Management und Kostenkontrolle zu
verbessern. Dazu stehen innovative Ansätze wie Netzverkehr-Management, Network Sharing und Network
Outsourcing bereit. Das Netzverkehr-Management umfasst dabei mehrere Maßnahmen zur
Kostenoptimierung: Kurzfristige Anforderungen zur Kostensenkung lassen sich etwa durch
Verkehrsverdichtung (Traffic Compression) bewältigen, während Verkehrsauslagerung (Traffic
Offloading) und Verkehrsmigration (Traffic Migration) mittel- bis langfristig wirksam werden.
Verkehrsverdichtung zielt zum einen auf die Kontrolle und Einschränkung des Verkehrs, der als
zentraler Treiber der verkehrsbezogenen Kosten innerhalb des Funkzugangsnetzes gilt, und zum
anderen auf den Backhaul-Bereich bei Mobilfunkbetreibern. Sie muss jedoch so umgesetzt werden, dass
Qualität und Nutzererfahrung nicht beeinträchtigt sind. Die Aktivierung der halben AMR-Rate
(Adaptive Multi-Rate) ist zum Beispiel eine Maßnahme, auf die viele Mobilfunkbetreiber
zurückgreifen, um ihre Netze bei einem Anstieg der Verkehrsnachfrage durch Sprachkompression und
flexible Übertragungsraten nicht erweitern zu müssen. Dazu muss eine differenzierte Analyse der
Regionen und Bereiche erfolgen, in denen diese Maßnahme aktiviert ist, sowie eine
Kundensegmentierung.
Verkehrsauslagerung eignet sich bei Mobilfunkbetreibern als mittelfristige Maßnahme mit der
Zielsetzung, den Verkehr aus dem Makronetz in kleinere, private Femtozellen in Gebäuden auszulagern
und den stationären Breitbandzugang als Backhaul zu nutzen. Dadurch werden Kostensenkungen im
Makronetz durch die Einschränkung von Abdeckung und Kapazitätsinvestitionen sowie der damit
einhergehenden Betriebsausgaben ermöglicht. Zusätzliche Einsparungen lassen sich erzielen, weil ein
Teil des Backhaul-Verkehrs über das IP-basierende Breitbandnetz des Kunden weitergeleitet wird.
Gleichzeitig können Femtozellen auch die Qualitätsprobleme durch Verbesserung der Abdeckung
innerhalb von Gebäuden beim Kunden lösen.
Der Zeithorizont für Verkehrsmigration ist mittel- bis langfristig und zielt darauf ab, den
Verkehr in fortschrittlichere Techniken zu migrieren, beispielsweise von 2G auf 3G. Bislang lief
der Sprachverkehr hauptsächlich über 2G-Netze. Die Einführung von 3G sollte vor diesem Hintergrund
auch als Option betrachtet werden, Sprachdienste für Kunden zu ermöglichen. Entsprechende
Netzoptionen und Mobilgeräte müssen diese Entwicklung unterstützen. Die erheblichen
Vorlaufinvestitionen werden durch schrittweise Effizienzgewinne kompensiert. In vielen Regionen der
Welt existieren ohnehin bereits 3G-Netze oder befinden sich in der Installationsphase. Die
Erfahrung von Detecon zeigt, dass sich durch die verschiedenen Maßnahmen im Netzverkehr-Management
CAPEX/OPEX-Kostenersparnisse von bis zu 25 Prozent realisieren lassen.
Network Sharing als Mittel der Wahl
Aus einer kürzlich von Detecon durchgeführten Erhebung geht hervor, dass über 50 Prozent der
daran teilnehmenden Telekommunikationsbetreiber einen niedrigeren – oder aufgeschobenen –
Investitionsaufwand für ihre gegenwärtigen Netze und die zukünftigen 3G-Rollouts ansetzen. Somit
kommen Betreiber nicht umhin, über das Auslagern von Teilen der Netzinfrastruktur aus ihren
Bilanzen nachzudenken, um ihre finanzielle Lage zu verbessern.
Ein Mittel der Wahl ist die Kooperation zwischen Betreibern, anders ausgedrückt: Network
Sharing. Dabei müssen die Partner sich über Ziele und Dimensionen der Zusammenarbeit verständigen.
Bei der technischen Dimension gilt es, das Ausmaß des Sharing (passiv vs. aktiv) und die
eingebundene Infrastruktur sowie sonstige Ressourcen wie das Funkspektrum zu klären. Die technische
Dimension umfasst die Grundlagen des Sharings (2G vs. 3G, Kupfer vs. Glasfaser), während die
geografische Dimension die Abdeckung betrifft. Sie kann vollständig sein oder ausgewählte Bereiche
(ländlich, städtisch, landesweit) umfassen. Asset- und Prozess-Sharing kommt ebenfalls eine
zentrale Bedeutung zu.
Abhängig von Abdeckung und Umfang des Sharing-Modells differieren Implementierungsaufwand und
erzielte Ersparnis. Während der Implementierungsaufwand im Fall einer Konsolidierung bestehender
Netze am höchsten und bei einem gemeinsamen Rollout auf der grünen Wiese am niedrigsten ist,
verhält es sich bei der Kostenersparnis genau umgekehrt. Nach Schätzungen von Detecon können
Betreiber durch das Network-Sharing CAPEX um bis zu 40 und OPEX um mehr als 25 Prozent
verringern.
Network Outsourcing als favorisierte Alternative
Trotz der beschriebenen Vorzüge ist die Anzahl der realisierten Network-Sharing-Deals noch
vergleichsweise gering. Viele Betreiber betrachten die zum Zeitpunkt der Outsourcing-Entscheidung
herrschende Wettbewerbspositionierung und nicht so sehr die Finanzierungsaspekte als
Haupthindernis. Eine wesentlich verbreitetere Alternative ist das Network Outsourcing. Seine
Bandbreite reicht vom Outtasking bis zu weitestgehenden Auslagerung von Implementierung, Betrieb
und Asset-Übertragung. Während Outtasking üblicherweise auf bestimmte Aufgaben beschränkt ist – zum
Beispiel die Wartung von Außeneinrichtungen oder Managed Operations – umfasst Network Outsourcing
die Auslagerung betrieblicher Prozesse und einen entsprechenden Mitarbeiter- beziehungsweise
Asset-Transfer.
Nach Detecon-Erhebungen lassen sich durch das Outsourcing von Teilen des Netz-Managements und
der betrieblichen Funktionen OPEX-Einsparungen von 20 Prozent erzielen, wodurch es den Betreibern
möglich wird, von den Skaleneffekten und Verbundvorteilen der Outsourcing-Dienstleister zu
profitieren. Zudem ziehen die Betreiber einen Vorteil aus der Variabilisierung der Fixkosten, da
sie auf diese Weise erhebliche Verbesserungen in Cashflow und Profitabilität erzielen können. Unter
dem Strich kann Outsourcing zu erheblichen Margenverbesserungen von fünf Prozent oder mehr
führen.
Riadh Marrakchi ist Regional Director im Detecon Abu Dhabi Office und hauptsächlich für Kunden
in Nordafrika zuständig. Youssef EL Ouariachi ist als Senior Consultant der Detecon International
im Bereich Strategy & Marketing mit den Schwerpunktthemen Controlling, Cost Optimization und
Financial Modeling tätig.