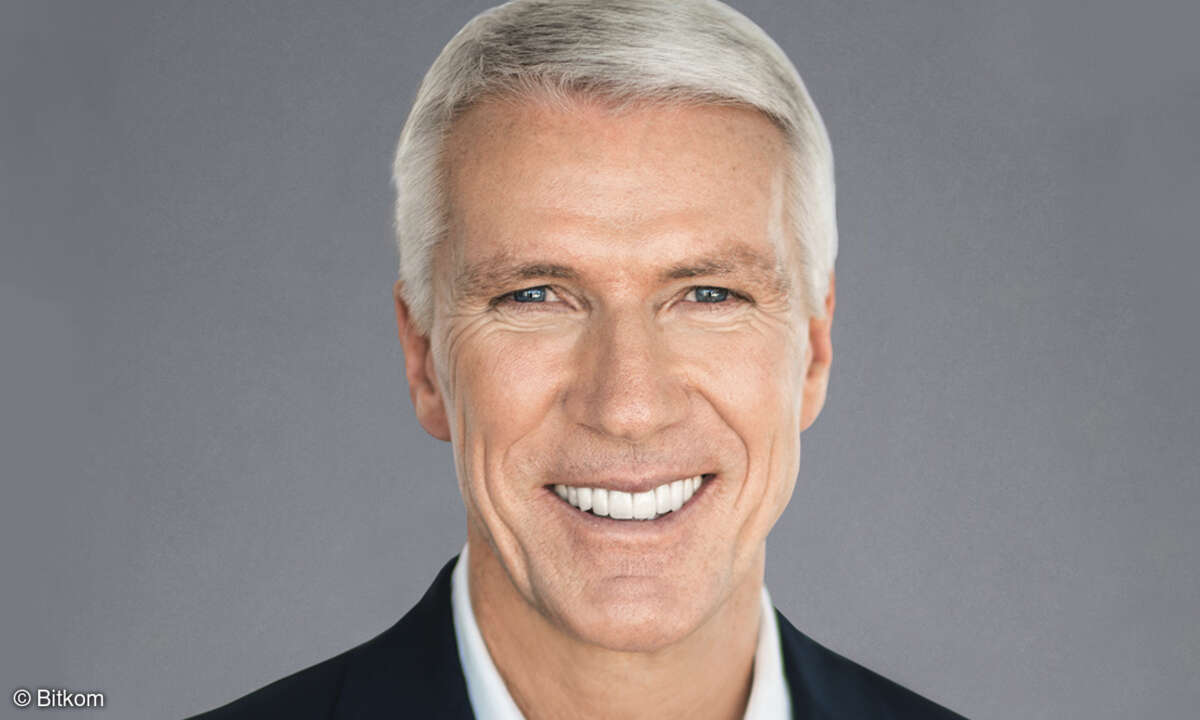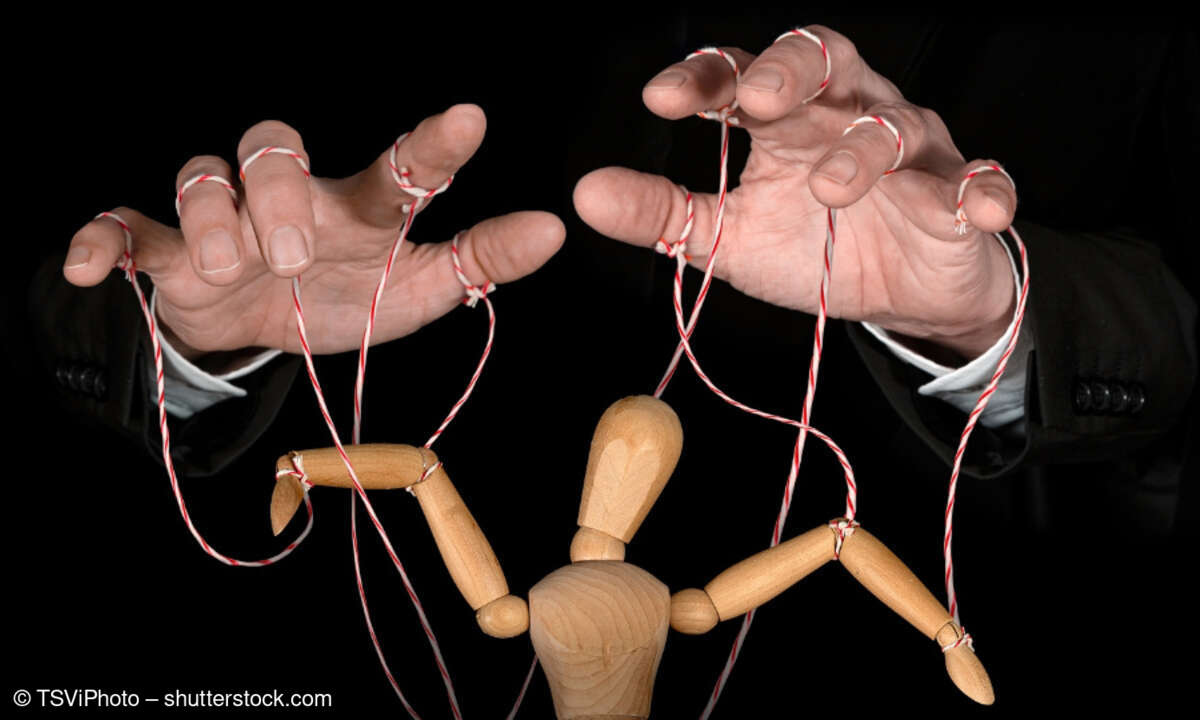Bisheriger Stand der Rechtsprechung
- Gebrauchtsoftware: Spezialfall Öffentliche Hand
- Beschluss der Vergabekammer Düsseldorf
- Bisheriger Stand der Rechtsprechung
- Neue Rechtsprechung des OLG München
Die zur Zeit noch vorherrschende Meinung ist, dass zumindest für auf Datenträgern verkörperte Software Erschöpfung dergestalt eintritt, dass die Software ohne Zustimmung des Urhebers weitergegeben werden kann.
Dieser Grundsatz geht auf eine bahnbrechende Entscheidung des BGH zurück, die sog. OEM-Entscheidung aus dem Jahr 2000 (Az.: I ZR 244/97). Der BGH hatte den Weiterverkauf von »entbündelter« Software an Endverbraucher mit Hinweis auf das Erschöpfungsprinzip für zulässig erklärt. Folglich war es Microsoft seinerseits verwehrt, die nach dem Erstverkauf stattfindenden Weiterverkäufe seiner Software zu verbieten, selbst wenn diese ohne die dazugehörige Hardware vertrieben wurde. Der BGH stellte fest, dass der Berechtigte bereits mit der ersten durch ihn oder mit seiner Zustimmung erfolgten Veräußerung die Herrschaft über das Werkexemplar aufgibt. Es wird damit für jede Weiterverbreitung frei. Der BGH führt weiter aus »… könnte der Rechteinhaber, wenn er das Werkstück verkauft oder seine Zustimmung zur Veräußerung gegeben hat, noch in den weiteren Vertrieb des Werkstückes eingreifen, ihn untersagen oder von Bedingungen abhängig machen, so wäre dadurch der freie Warenverkehr in unerträglicher Weise behindert.«
Selbst wenn also eine Beschränkung eine dingliche Wirkung entfaltet, bedeutet dies nur, dass der Ersterwerber nur ein beschränktes Verbreitungsrecht hat. So muss sich der OEM-Lieferant daran halten, die als OEM-Version bezeichnete Programmkopie an einen Dritten unter vom Rechteinhaber bestimmten Auflagen weiterzugeben. Auf Grund dieser Zustimmung ist dann das Verbreitungsrecht des Rechteinhabers erschöpft. Der weitere Vertrieb kann vom Berechtigten nicht mehr kontrolliert werden.
Wie oben schon dargestellt, ist die urheberrechtliche dingliche Beschränkung des Verbreitungsrechts zu unterscheiden von der vertraglichen Beschränkung. Deren Nichteinhaltung stellt keine urheberrechtliche Verletzung des Verbreitungsrechts, sondern lediglich eine Vertragsverletzung dar. In Individualverträgen mag eine solche Beschränkung wirksam sein. Wird aber das Verbreitungsrecht des Lizenznehmers in Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) ausgeschlossen, ist eine solche Klausel gemäß § 307 Abs. 2, Nr. 1 BGB unwirksam, da sie von wesentlichen gesetzlichen Grundgedanken, nämlich dem Erschöpfungsgrundsatz, abweicht.