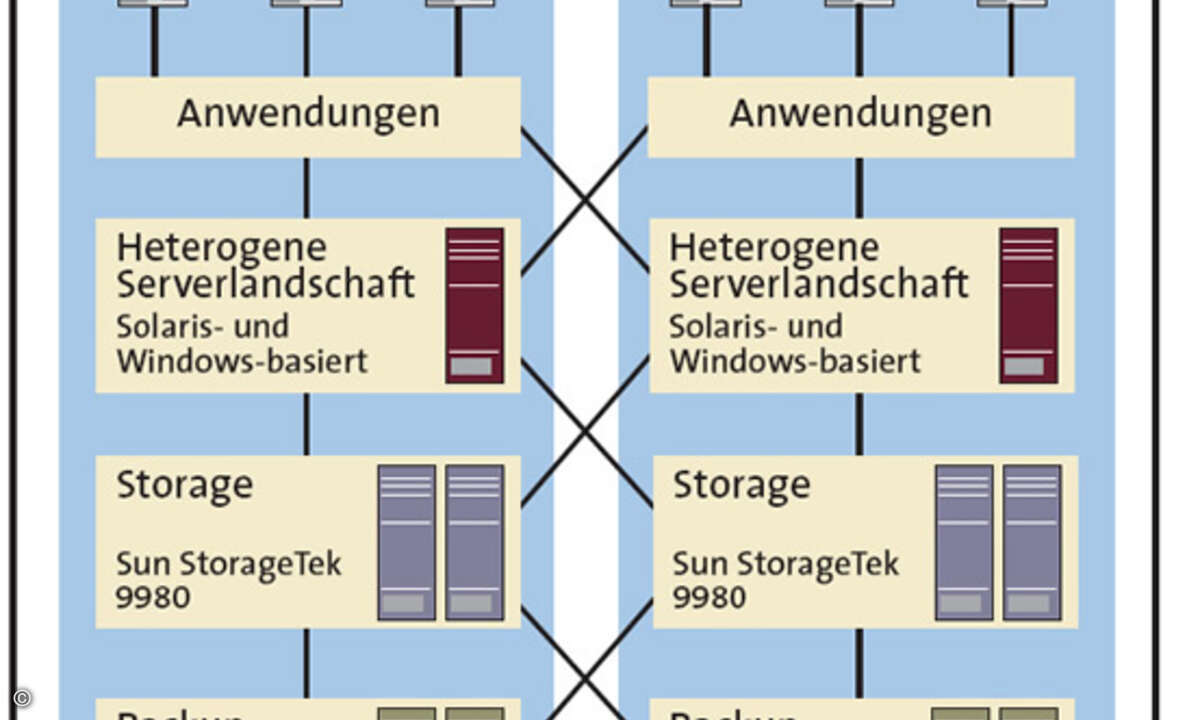ILM ? vom Hype zur Notwendigkeit (Fortsetzung)
- ILM ? vom Hype zur Notwendigkeit
- ILM ? vom Hype zur Notwendigkeit (Fortsetzung)
- ILM ? vom Hype zur Notwendigkeit (Fortsetzung)
Simon Kastenmüller, Principal Consultant, Division Storage, Fujitsu Siemens Computers GmbH, sieht ILM als Storage-Management-Konzept, das die Anforderungen aus den Geschäftprozessen mit den Möglichkeiten der Informationstechnik in Einklang bringt. Man müsse zwischen einer taktischen, strategischen und visionären Ausrichtung unterscheiden. Taktisches ILM setze vor allem auf Segmentlösungen und Tierd Storage, ohne über diesen Bereich weit hinauszugehen. »Auch damit lässt sich schon ein interessanter ROI erzielen«, sagte Kastenmüller. Strategisches ILM richte die gesamte IT auf ILM aus. Visionäre Konzepte, wie etwa das der SNIA, streben unternehmensweite Regelwerke an, die festlegen, wo was gespeichert wird.
Ute Ebers ging auf die Konzeption von ILM-Produkten ein. »Es kommt auf die Durchgängigkeit der Produktportierung durch die Hersteller an, nicht darauf, alles von einem Hersteller zu beziehen«, sagte sie. EMC habe sein Hardware- durch ein umfassendes Softwareangebot ergänzt. Ganz generell zögen Kunden aber mehr Speicherebenen ein, bevor sie Softwaretools einsetzten.
Marcellus Scheefer, Sales Leader Virtualisierung IBM Total Storage Open Software, IBM Deutschland GmbH, wies darauf hin, dass der Bedarf nach ILM immer bestanden habe. »Letztlich geht es doch um die Frage, welche Daten ein Kunde verwalten muss und was sie für ihn wert sind«, sagte Scheefer. Auch Aindrias T. Wall, Geschäftsführer, Atempo Deutschland GmbH, sieht in ILM eher »alten Wein in neuen Schläuchen«. Schließlich sei Tierd Storage auf dem Mainframe bereits selbstverständlich gewesen, schon allein wegen der hohen Speicherpreise. ILM sei allerdings höher angesiedelt als lediglich verschiedene Speicherebenen. Hier gehe es auch um die gesamte Stammdatenverwaltung, in die im nächsten Jahr weltweit rund zehn Milliarden Euro investiert werden sollen. »Die Anwender müssen schließlich die Daten unter Kontrolle bringen«, meint er. Gegenüber den Mainframe Zeiten habe sich, so Kastenmüller (Fujitsu Siemens) die Zahl der Storage-Ebenen von zwei auf inzwischen vier bis fünf vergrößert. »Dies ermöglicht eine optimale Kostenstruktur und die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen.«, betont er.
Christian Prella, Account Manager bei Kroll Ontrack, meinte, dass es zwar Vorschriften, aber noch keine gute Lösung für die Compliance-Probleme gebe. »Für Dienstleister wäre es eine wichtige Aufgabe, wie die Daten revisionssicher auf neue Medien kommen, die lange genug lesbar sind.«
Torsten Poels, Senior Vice President und General Manager Europa, Fast Lane Institut for Knowledge Transfer GmbH, unterscheidet zwischen kleinen und großen Unternehmen: »Großunternehmen müssen sich mit ILM auseinandersetzen, für KMUs ist es eher ein Buzzword«, differenziert er. Sie müssten zunächst ihre Infrastruktur in Ordnung bringen.
Robert Thurnhofer, Field Marketing Program Manager, Computer Associates Deutschland GmbH, betrachtet das Thema anders: »ILM sollte ein standardisierter Oberbegriff für verschiedene IT-Disziplinen sein«, erklärte er, und gehöre als Dach über Storage Management.
Rabeneck (HDS) wies darauf hin, dass es im MVS-Umfeld schon seit 30 Jahren ILM-ähnliche Prozesse gebe, bei denen Migrationslevel definiert werden.
Thurnhofer (CA) betonte dagegen, dass bei ILM die IT an ihre Grenzen stößt. »Hier spielen andere Themen mit hinein«, sagte er. Mit HSM (Hierarchical Storage Management), einem rein technischen Begriff, dürfe man ILM daher nicht verwechseln. Ein Beispiel dafür seien Rechtestrukturen für den Datenzugriff, die mehr mit Managementkompetenzen als mit Technologie zu tun hätten.