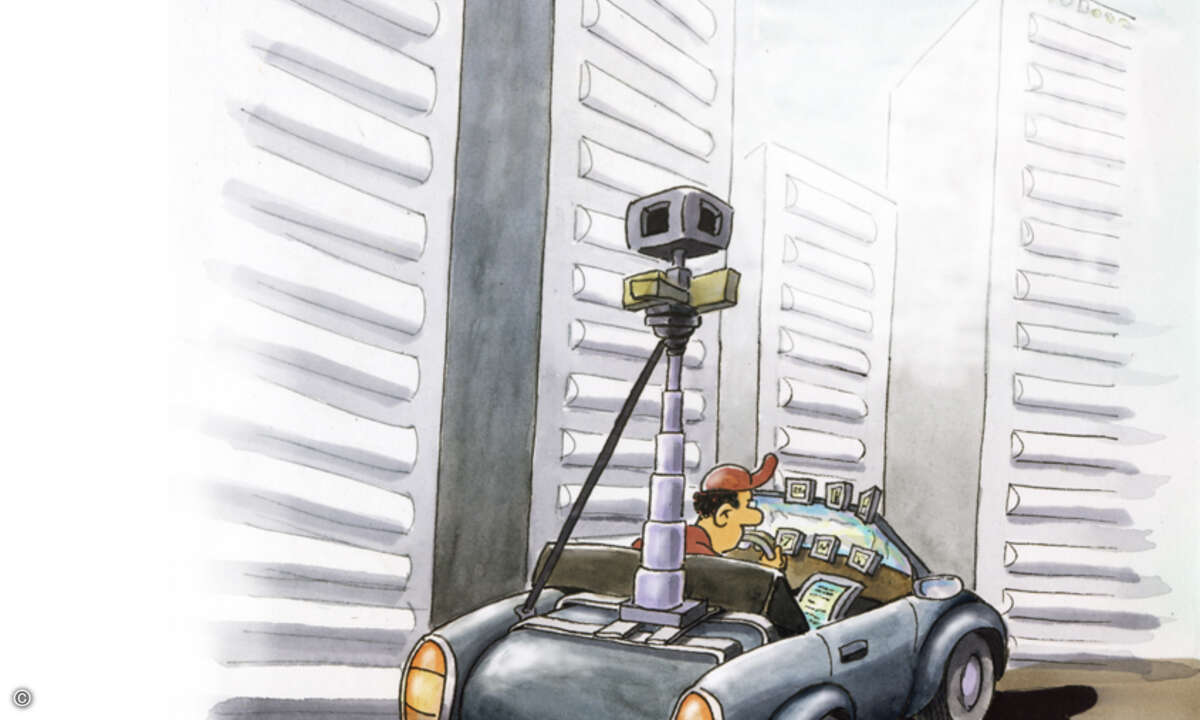Unbekannte Nutzungsarten – Sonderregelung für Open Source Software
- Änderungen im Urheberrecht betreffen IT
- Unbekannte Nutzungsarten – Sonderregelung für Open Source Software
Sogenannte »unbekannte Nutzungsarten« können für Lizenznehmer sehr gefährlich werden, da diese Rechte bisher nicht vertraglich eingeräumt werden konnten (§ 31 Abs. 4 a.F. UrhG). Dies führte dazu, dass insbesondere elektronische Verbreitungswege oftmals an der schwierigen oder unrentablen Klärung der Rechte scheiterten. Nunmehr wird diese Vorschrift aufgehoben. Es ist also zukünftig möglich, Verträge über die Einräumung von Rechten für unbekannte Nutzungsarten zu treffen. Der Urheber hat in diesem Fall Anspruch auf eine angemessene Vergütung. Außerdem wird ihm die Möglichkeit eines Widerrufs eingeräumt, von der er binnen einer Frist von drei Monaten nach Benachrichtigung durch den Lizenznehmer Gebrauch machen muss. Aufgrund einer Übergangsregelung soll es sogar möglich sein, dass sich die Zulässigkeit der Rechtseinräumung für unbekannte Nutzungsarten auch auf Verträge erstreckt, die zwischen 1966 und Inkrafttreten des neuen Gesetzes geschlossen wurden. Die Gesetzesbegründung spricht hier zwar optimistisch von zahlreichen »in den Archiven ruhenden Schätzen« (so die Gesetzesbegründung wörtlich), doch eine Verwertung dieser Schätze ist an zahlreiche Voraussetzungen geknüpft, weswegen viele Juristen den Optimismus des Gesetzgebers nicht teilen. Eine Sonderregelung gilt für Open Source Software: § 31a Abs. 1 S. 2 UrhG n.F. legt fest, dass die Einräumung unbekannter Nutzungsarten nicht schriftlich erfolgen muss, wenn der Urheber »unentgeltlich ein einfaches Nutzungsrecht für jedermann« einräumt. Damit trägt der Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass Open Source-Lizenzen in der Regel nicht schriftlich abgeschlossen werden, sondern als öffentliche Lizenzen mit dem Werk verbunden sind. Das gilt gerade für gemeinsam erstellte Werke (die Gesetzesbegründung führt als Beispiele Wikipedia und Linux an) mit zahlreichen Urhebern. Zusätzlich zu diesen Änderungen hat der Gesetzgeber in einem Entschließungsantrag Weichen für weitere Reformen, also einen »Dritten Korb« gestellt. In ihm ist zum Beispiel ein Verbot sogenannter »intelligenter Aufnahmesoftware« enthalten, die gezielt Musikstücke aus Webradioangeboten aufnehmen können soll. Schließlich soll auch geprüft werden, ob der in letzter Zeit hoch umstrittene Handel mit gebrauchter Software einer gesetzlichen Regelung bedarf.
Dr. Hermann Lindhorst ist Rechtsanwalt bei CMS Hasche Sigle, Hamburg