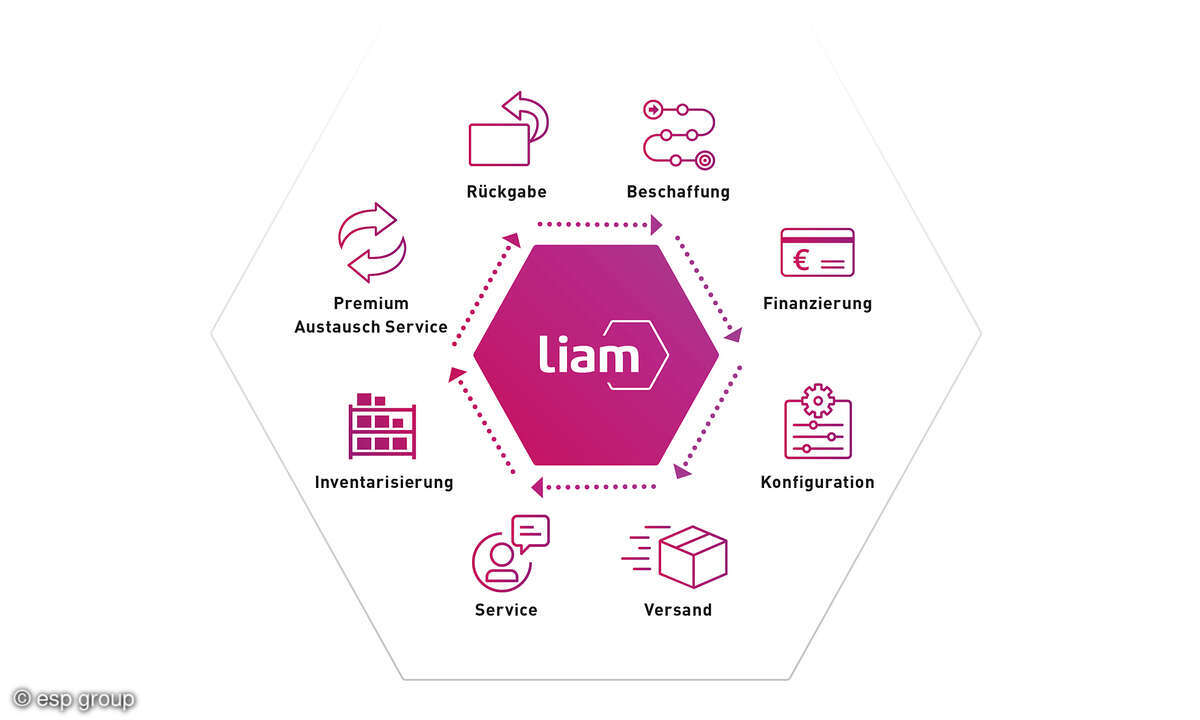Optimale Service-Level-Politik im Callcenter-Outsourcing
Optimale Service-Level-Politik im Callcenter-Outsourcing. Mehr und mehr Unternehmen setzten für den telefonischen Kundenservice Sprachcomputer ein. Durch das Ineinandergreifen von automatischen und menschlichen Telefondiensten ergeben sich einige Vorteile.

Optimale Service-Level-Politik im Callcenter-Outsourcing
Der Mix machts
Unternehmen sollten jedoch bei den meist vielschichtigen Servicebedürfnissen ihrer Kunden auf den richtigen Mix zwischen automatisierten Diensten und hochwertigem Service durch professionell geschulte Callcenter-Agenten setzen. Geeignete Sprachapplikationen für standardisierbare Inhalte und persönliche Gesprächspartner bei komplexen Anfragen können dann logisch ineinander greifen. Ein Kannibalisierungseffekt zwischen Mensch und Maschine konnte beispielsweise bei dem teilautomatisierten Sprachportal der Postbank nicht festgestellt werden. Die gesteigerte Effizienz in der abschließenden Bearbeitung von Kundenanfragen hat sogar ein enormes Wachstum des gesamten Sprachportals ausgelöst. Heute müssen bei der Postbank fast viermal mehr Anfragen beantwortet werden als vor der Einführung der teilautomatisierten Lösung. »Auftraggeber fragen heute zunehmend nach Servicemodellen zur Steigerung der eigenen Performance und Erhöhung der Produktivität«, weiß Manfred Stockmann, Präsident des Call Center Forums.
Der Mensch-Maschine-Mix birgt also neue Marktchancen, indem er die Kundenbindung erhöht und auf diese Weise Marktanteile sichert. Immer wiederkehrende Anfragen, die eine gewisse kritische Häufigkeit überschreiten, können gut standardisiert angeboten werden. Automatisierte Schnittstellen führen schon seit geraumer Zeit erfolgreich Standard-Dialoge rund um sogenannte »unidirektionale« Informationsflüsse (z.B. Information zum Kontostand). Beim Thema Interaktivität, beispielsweise bei mehrstufigen Abfrageabläufen, hat es hingegen einen Paradigmen-Wechsel gegeben: Die Portalbauer haben die Vision aufgegeben, das Sprachverhalten der Maschine dem des Menschen so ähnlich wie möglich zu machen. Die virtuellen Gesprächspartner bleiben heute in ihren Dialogabläufen als Maschinen erkennbar ? der Verbraucher akzeptiert es.
Mehrwert nutzen
Worin aber besteht der Mehrwert eines Mensch-Maschine-Mix für Outsourcing-Dienstleister? Die Kostenstrukturen, die sich in unterschiedlich bepreisten Lösungsmodulen niederschlagen, sind ein Aspekt. Aber Dreh- und Angelpunkt im Outsourcing sind die Service-Levels, die zwischen Dienstleister und Auftraggeber vereinbart werden. Der Einsatz einer sinnvollen Kombination aus technischem und operativen Bereich bemisst sich maßgeblich am Gesprächsvolumen, seiner standardisierbaren Inhalte und seinem Anspruch an qualifiziertem Service. Außerdem entscheidet über die Identifikation geeigneter Dienste natürlich auch der schnelle Return-on-Investment. Anfangsinvestitionen in Personal oder intelligente Netze eines Plattformbetreibers sollen sich entsprechend ihres Servicelevels rechnen. Dafür muss der Outsourcer in aller Regel binnen eines bestimmten Zeitraums 80 oder 90 Prozent aller Anrufversuche beantworten. Für erfolglose Anrufversuche gibt es erstens keine Entlohnung, zweitens muss der Outsourcer für zu viele »sunk calls« im Sinne des Service-Levels mit Abschlägen rechnen. Ob das Gespräch von Menschen oder automatisiert entgegen genommen wird, spielt hier allerdings keine Rolle.
Hohe Qualität
Ein weiterer Effekt in der Portfolio-Politik des Outsourcers: Durch stetig steigende Qualifikationsansprüche wird der Einsatz menschlicher Agenten hochwertiger und daher lukrativer. Er wird im Zuge der Teilautomatisierung mehr und mehr für komplexe Dialogführung eingesetzt, und trägt ebenfalls seinen Teil zum effizienten Arbeitsablauf bei. Ständige Weiterbildung und spezielle Schulung auf branchenspezifische Fragestellungen und schwierige Kundensituationen versetzen ihn in die Lage, schneller ergebnisorientiert zu kommunizieren. Mit entsprechend dynamisch gestalteten Kundenselektionsprozessen innerhalb der technischen Infrastruktur wird es ihm ebenfalls möglich, seinen Job aufzuwerten und von der Automatisierungsstruktur zu profitieren. Durch den vorgelagerten Einsatz der Sprachautomatisierung innerhalb der Kundenkontaktprozesse kann er nach und nach von monotonen Arbeiten entlastet werden und erhöht seinen Stellenwert innerhalb des gesamten Dialogprozesses. »Der Agent erhält durch die Entlastung von Routineaufgaben mehr Spielräume für wirkliche Problemlösungen«, so Stockmann. Seine Rolle wird sich im Einklang mit gesteigerter Qualifikationsanforderung in Richtung Serviceberater mit Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz bewegen. »Der gut ausgebildete Agent spielt eine Rolle für die Qualität der Callcenter-Dienstleistung. Die fachlichen Anforderungen an die Mitarbeiter steigen, zumal viele Anbieter sich auf bestimmte Branchen spezialisieren, um dem Auftraggeber einen reellen Mehrwert zu bieten. Der Agent ist der persönliche Bezugspunkt des Anrufers und Repräsentant für qualifizierten Service des Unternehmens,« erläutert Olaf Geppert Deutschlandchef des Münchner Call-Center-Dienstleisters Telegate. Als Treiber des Themas Cross- und Upselling entwickelt sich die Position des Agenten zu einem entscheidenden Faktor in der Kundenwertschöpfungskette.
Kein vollautomatischer Telefonkanal
Sicherlich wird sich der vollautomatische Telefonkanal für alle Geschäftsvorfälle weder kurz- noch langfristig vollständig durchsetzen. Absehbar ist bereits, dass die strenge Trennung zwischen Automat und Agent in den nächsten 18 Monaten aufgelöst wird und beide zu Gunsten des Unternehmensanspruches verschmelzen. Kunden haben ein wesentliches Interesse, Self-Services (eigenbedienter Inhalte-Abruf durch den Kunden) über verschiedene Kanäle und Medien zu nutzen. Je nach Informationsbedarf und Lebenssituation kann der Verbraucher selbst zwischen direkter persönlicher Betreuung, dem Zugang über das Internet oder auch dem Dialog per Telefon wählen. Wer gerade vor seinem Rechner sitzt, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Web-Schnittstelle eines Unternehmens nutzen; der automatische Telefondialog kommt zur Anwendung, wenn der Kunde einer Bank außerhalb der Öffnungszeit noch einfache Abfragen über sein Girokonto machen möchte, oder wenn er gerade sein Mobiltelefon greifbar hat. Auch das Interesse der Unternehmen zielt in diese Richtung. Kostensenkungspotenziale durch Automatisierung bei leicht standardisierbaren Themen sowie der Druck auf die Unternehmen zu einem aufwandsorientierten Kundenwertmanagement werden dazu führen, dass die Masse der Anrufer zunehmend über automatisierte Kanäle bedient wird und die persönliche Betreuung speziellen Kundengruppen mit hohem Umsatz und Entwicklungspotenzial zugeordnet wird.
Wendelin Meyer-Moelk ist Geschäftsführer bei dtms in Mainz