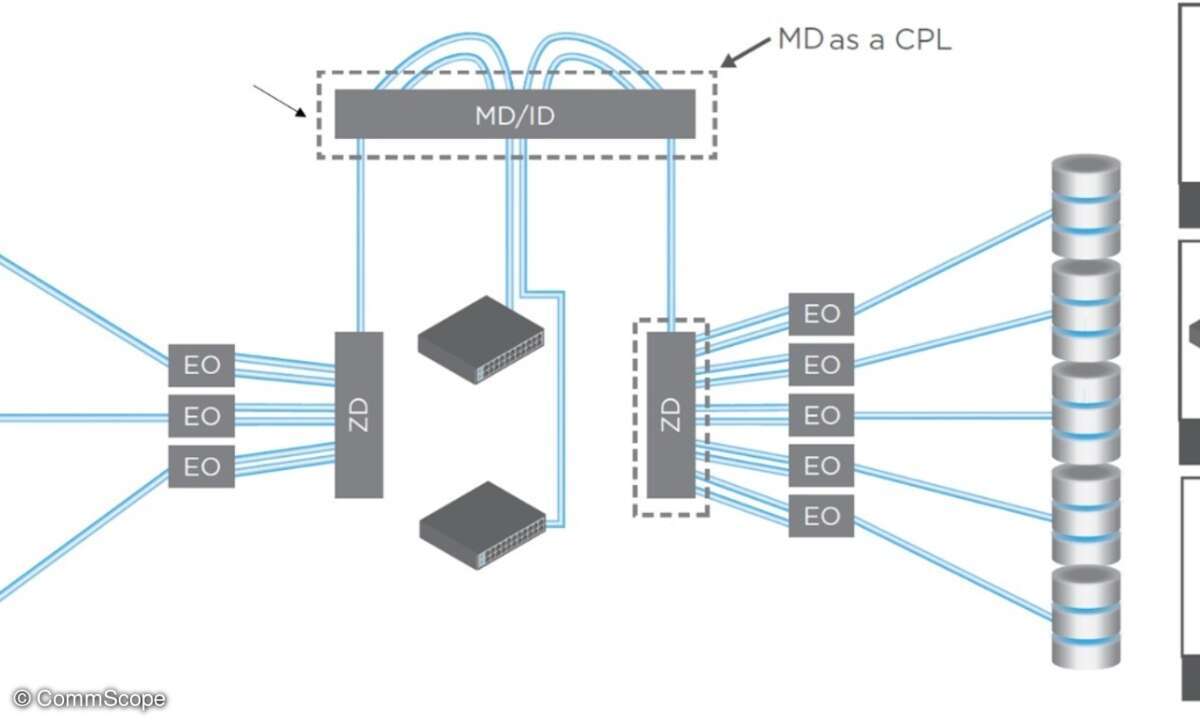Wettbewerb der Kommunikationstalente
Neben immer mehr Bandbreite sollen LAN-Switches im Zeitalter von Unified-Communications auch den Anforderungen der verschiedenen Real-Time-Anwendungen gewachsen sein. Wie talentiert moderne UC-Switches heute sind, sollte ein Vergleichstest klären.

- Wettbewerb der Kommunikationstalente
- Datenverlustverhalten
- Qualitätssicherung im LAN
- Qualitätssicherung auf Ebene 3
- Port-Nummern-Klassifizierung
Moderne Kommunikationsnetze stellen aktive Komponenten vor immer anspruchsvollere Aufgaben. Mit dem Siegeszug der IP-Telefonie hält die erste Echtzeitanforderungen stellende Anwendung flächendeckenden Einzug in die Welt der Ethernet- und IP-basierenden Unternehmensnetze. Und auch die Integration von Video-over-IP beispielsweise für Konferenzsysteme steht in vielen Bereichen schon im Pflichtenheft. Dann sind da noch die klassischen Datenapplikationen, und deren Anforderungen an das Netzwerk werden auch immer anspruchsvoller.
Um diesen Herausforderungen zu begegnen haben die Switch-Hersteller ihre Systeme zügig weiter entwickelt. Mit der Einführung von 10-Gigabit-Ethernet ist das gute alte Ethernet nochmals um den Faktor 10 schneller geworden. Und Mechanismen wie die Datenpriorisierung und das Bandbreitenmanagement sollen für eine intelligente Ausnutzung der zur Verfügung gestellten Ressourcen im gesamten Unternehmensnetz sorgen.
Kommunikationsstörungen im LAN
Die Übertragung von einem Endpunkt im Netzwerk zum anderen erfordert eine gewisse Laufzeit. Dabei gibt es zunächst einen festen Teil, der durch die Auswahl der zu verwendenden Codecs, also der Sprach-Digitalisierungs-Algorithmen, und der Netzwerkkomponenten beeinflussbar und ziemlich gut berechenbar ist. Dieser wird durch die Zeit, die die Kodierungsalgorithmen an beiden Endpunkten benötigen, durch die Hardware-Durchlaufzeit auf den beteiligten End- und Knotenpunkten und durch die rein physikalischen Übertragungsgeschwindigkeiten der verschiedenen Medien über bestimmte Entfernungen festgelegt.
Zusätzlich entstehen Verzögerungen beispielsweise durch volle Warteschlangen bei Überlast oder durch die eventuelle Wahl alternativer Routen zum Zielpunkt. Die beiden letzteren Punkte können auch die Ursache für zwei andere Übertragungsfehler sein. Beim sogenannten Jitter treffen Pakete, die in regelmäßigen Intervallen in das Netz geschickt werden, in unregelmäßigen Abständen beim Empfänger ein. Ist bei isochromem Datenverkehr wie der IP-Sprachübertragung ein Paket zu schnell am Ziel, dann kann es für die Ausgabe noch nicht verwendet werden. Kommt es dagegen später als erwartet, können Lücken in der Sprachwiedergabe entstehen. Diesem Jitter kann man durch den Einsatz eines Jitter-Buffers entgegenwirken, der Pakete aus dem Netz entgegen nimmt und verzögert aber gleichmäßig an die Dekodiereinheit weiter gibt. Natürlich erhöht sich dadurch auch der Delay.
Treffen die Pakete beim Empfänger in einer anderen Reihenfolge ein, als vom Sender beabsichtigt, spricht man von einem Sequence-Error. Häufigste Ursache hierfür ist, dass einige zu einer Übertragung gehörende Pakete auf Grund einer Überlast regeroutet werden und so ihr Ziel auf einem anderen, möglicherweise langsameren Weg erreichen. Wie gut solche Fehler in der Paket-Reihenfolge ausgeglichen beziehungsweise überspielt werden können, hängt in erster Linie von der Länge des Jitter-Buffers ab.