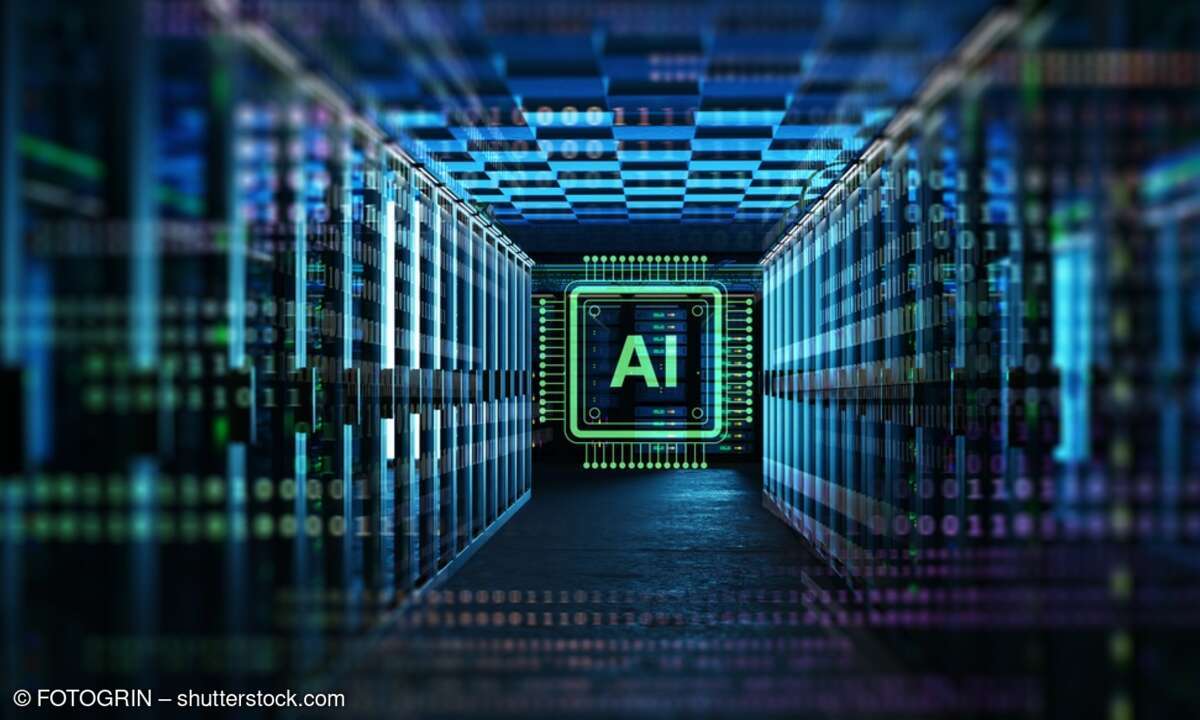Empfehlungen für den Einsatz in Unternehmen
Bereits seit längerer Zeit ist eine neue Wireless-LAN-Technik, die eine höhere Bandbreite gegenüber den bisherigen Standards bietet, dringend erforderlich, und ein neuer Standard ist überfällig. Die bisherigen Nettodatenraten sind insbesondere für die Nutzung typischer Bürosoftwareprogramme über das WLAN nicht ausreichend. Die neue Technik 802.11n soll hier Abhilfe schaffen. Sie erfordert allerdings ein Umdenken beim WLAN-Design.
Zu den Hauptargumenten für 802.11n zählen zumeist die hohen Bruttodatenraten von geplanten 600
MBit/s sowie die größeren Reichweiten im Vergleich zu den bisherigen Standards. Der für viele
Anwender bedeutendste Nutzeffekt von 802.11n liegt dabei in der besseren Abdeckung weiträumiger
Gebiete. Mit der Weiterentwicklung der WLAN-Technik steigt jedoch auch deren Komplexität sowohl bei
der Verarbeitung in den IT-Hardwarekomponenten als auch im Bereich der Konzeption und des Designs
von Netzwerken.
Status quo bei IEEE 802.11n
Mittlerweile liegt der Standard 802.11n im Draft 5.0 vor, der im Juli 2008 verabschiedet wurde.
Der endgültige Beschluss ist seitens der IEEE 802.11n Working Group für November 2009 vorgesehen.
Jedoch besteht für Anwender bereits seit der Verabschiedung von Draft 2.0 im Frühjahr 2007 eine
hohe Sicherheit bei der Nutzung von 11n-Produkten. So wollen zahlreiche Hersteller mittels
Firmware-Upgrades die Konformität ihrer 802.11n-Komponenten mit dem endgültigen, ratifizierten
Standard gewährleisten. Auf diese Weise erhalten Anwender die notwendige Sicherheit, um bereits
jetzt auf die neue Technik zu setzen. Doch selbst wenn ein Firmware-Upgrade für die Konformität mit
dem finalen Standard ausreichend sein wird: Zwischen einem 11n-Netzwerk auf der jetzigen
Draft-Basis und dem endgültigen Standard werden absehbar etliche Unterschiede bestehen, auf die im
Folgenden noch näher eingegangen wird.
Technische Besonderheiten
Die bekannteste technische Neuerung von 802.11 ist der Einsatz von MIMO-Mehrantennensystemen
(Multiple Input Multiple Output). Diese verwenden mindestens zwei Sende- und zwei Empfangsantennen.
11n-Produkte werden stets mit der Eigenschaft von NxM Antennen beschrieben, wobei N die Anzahl der
Sendeantennen und M die Anzahl der Empfangsantennen bedeutet. Das Prinzip der Antennen-Diversity
ist zwar bereits von einigen 802.11g-Geräten bekannt, jedoch trifft es bei 802.11n mit einer
weiteren neuen Eigenschaft zusammen – dem Spatial Multiplexing. Hierbei wird nicht nur entschieden,
an welcher Antenne das qualitativ bessere Signal auf der Empfangsseite anliegt, sondern der Sender
schickt den Bitstrom verteilt auf seine Sendeantennen. Das heißt, bei 4×4-MIMO kann sich der
Bitstrom in vier separate Übertragungen aufteilen, die parallel ablaufen (Bild 1). Auf der
Empfängerseite erhält jede der vier Antennen ein Summensignal der Sendeantennen, das anschließend
zu decodieren ist. Rein theoretisch können diese Geräte damit in derselben Zeit die vierfache
Datenmenge übertragen, ohne zusätzliche Frequenzbandbreite zu benötigen. Voraussetzung dafür ist
jedoch die mögliche Decodierung der Empfangssignale an den einzelnen Empfangsantennen. Dies ist der
Fall, wenn genügend Reflexionen durch eine Mehrwegeausbreitung der Sendesignale auftreten.
Anhand praktischer Messungen und Vergleichstests zeigt sich deutlich, dass 802.11n-Produkte bei
reflektierten Signalen im Vergleich zum Einsatz in einer reflexionsfreien oder reflexionsarmen
Umgebung höhere Datenraten sowie eine gesteigerte Reichweite zwischen Sender und Empfänger
erreichen. Damit ist die bislang für WLAN-Designs gültige Richtlinie, insbesondere bei
Richtfunkstrecken möglichst für eine freie "Line of Sight" (LOS) zu sorgen, mit 802.11n hinfällig.
Mehr noch: Dies kann sogar zu einer Verringerung der Übertragungsraten führen. Wichtig ist
vielmehr, dass durch die Umgebung genügend reflektierte Signale beim Empfänger eintreffen. Auch in
dem Fall, dass sich Sender und Empfänger zu nah beieinander befinden und damit zwischen den
Antennen kaum Reflexionen auftreten, sondern die Signale direkt an den Empfangsantennen ankommen,
erreicht der Anwender mit 802.11n-Produkten nicht die maximal möglichen Datendurchsätze. Allerdings
sei darauf hingewiesen, dass diese geringeren Durchsatzwerte zwischen 802.11n-Komponenten immer
noch deutlich höher sind als jene von 802.11b/g- oder 802.11a-Produkten. So liegen die
11n-Nettodatenraten in nicht optimalen Umgebungen üblicherweise bei zirka 30 bis 40 MBit/s, während
sie bei 802.11g in der Regel Werte zwischen zirka 13 und 16 MBit/s erreichen. In typischen
Büroumgebungen, in denen die Signale reflektiert werden, betragen die 11n-Datendurchsätze bei
Entfernungen bis zu 15 Metern 50 bis 70 MBit/s. In gut geeigneten realen Umgebungen kann 802.11n
auch Nettodurchsätze von über 100 MBit/s erreichen.
Modulationsverfahren
Mit einem 2×2-Design – also zwei Spatial Streams – sind nach 802.11n Draft 2.0 theoretisch
Bruttodatenraten bis zu maximal 300 MBit/s möglich. Die in Aussicht gestellten
600-MBit/s-Übertragungsraten lassen sich nur mit einem 4×4-Design erreichen. Zudem müssen für die
Realisierung höherer Datendurchsätze komplexe Modulationsverfahren zum Einsatz kommen. Als
Modulationsverfahren erlaubt 802.11n die Verwendung von BPSK (Binary Phase Shift Keying), QPSK
(Quadrature Phase Shift Keying), 16 QAM (Quadrature Amplitude Modulation) und 64 QAM. Diese
unterschiedlichen Verfahren sind Teil eines OFDM-Senders/Empfängers (Orthogonal Frequency Division
Multiplexing) und kommen je nach Qualität des anliegenden Empfangssignals zum Einsatz. BPSK ist
relativ robust gegenüber Störungen, bietet aber nur eine niedrige Datenübertragungsrate. Die
64-QAM-Modulation verhält sich hingegen relativ empfindlich gegenüber Störungen, ermöglicht dafür
aber eine hohe Datenübertragungsrate. Zudem stellt sie höhere Anforderungen an die
Leistungsfähigkeit der verwendeten Chipsätze. In dieser Hinsicht zeigen verschiedene Messungen,
dass die aktuellen 802.11n-Geräte wesentlich besser abschneiden als die bisherigen
802.11g/a-Produkte. Aufgrund dieser optimierten Hardwareleistungsfähigkeit lassen sich mit
11n-Produkten selbst beim gemeinsamen Betrieb mit 802.11g/a-Geräten die Datendurchsatzraten
steigern und sogar die Reichweite erhöhen. Obwohl Produkte nach Standard 11g nicht von den
Vorteilen durch MIMO, Spatial Multiplexing oder Kanalbündelung profitieren, zeigt sich dennoch eine
Performance-Steigerung durch die verwendete 802.11n-Hardware.
Beim Netzdesign einer neuen WLANInfrastruktur kommt der Leistungssteigerung von reinen
802.11g/a-Client-Landschaften durch den Einsatz von 802.11nAccess-Points eine bedeutende Rolle zu.
Außerdem besteht dabei die Chance, schrittweise 11n-Clients in das Netzwerk zu integrieren und
später – unter Beibehaltung der Access Points – auf ein komplettes 802.11n-Netzwerk zu
migrieren.
Kanalbündelung und Kanalbelegung
Der WLAN-Frequenzbereich im 2,4-GHz-Band reicht in Europa von 2400 MHz bis 2485 MHz. Für
802.11b/g und auch 802.11n stehen insgesamt dreizehn verschiedene Kanäle zur Verfügung. Die
Bandbreite eines Kanals beträgt dabei zirka 20 MHz. Anhand der Kanalbelegungstabelle wird deutlich,
dass sich einige Funkkanäle überschneiden, da der Kanalabstand nur 5 MHz zwischen zwei benachbarten
Kanälen beträgt (Bild 2). Um die erforderliche Dämpfung von -20 dB zu erreichen, ist jedoch ein
Abstand von mindestens 22 MHz einzuhalten. Kommt zum Beispiel Kanal 1 zum Einsatz, ist der nächste
freie Kanal die Nummer 6. Sinnvolle Kanalzuordnungen wäre somit 1, 6, 11 oder 1, 7, 13 oder 1, 6,
13 und so weiter.
Der 802.11n-Draft 2.0 sieht zur Erhöhung der Datendurchsätze eine Kanalbündelung vor, das heißt,
es werden jeweils zwei bisherige 20-MHz-Kanäle zu einem 40-MHz-Kanal zusammengefasst. Gleichzeitig
verschiebt sich dabei die Mittenfrequenz. Demnach sind bis zu Kanal 4 höhere Kanäle zur Bündelung
vorgesehen, ab Kanal 5 werden niedrigere Kanäle zusammengefasst (Bild 3). Dieser Effekt der
Kanalbündelung lässt sich am besten anhand einer Spektrumsanalyse veranschaulichen. Eine solche
Spektraldarstellung zeigt recht deutlich, dass ab Kanal 5 die Bündelung abwärts mit Kanal 1 erfolgt
(Bild 4).
Überlappen sich 802.11n- und 802.11g-Produkte in einem Gebiet, so senden bei Verwendung der
40-MHz-Kanäle zwar die 11n-Geräte untereinander mit hohen Datendurchsatzraten, blockieren aber
gleichzeitig freie Frequenzen für die 802.11g-Clients. In der Folge leidet der Gesamtdatendurchsatz
im WLAN. Um diese Koexistenz von 802.11b/g/n zu berücksichtigen, bieten 11n-Produkte die
Konfigurationsmöglichkeit eines reinen 20-MHz- sowie eines 20-/40-MHz-Automodus. Bei der
Einstellung von 20 MHz müssen sich alle Stationen fest mit dieser Bandbreite verbinden. Der
20-/40-MHz-Automodus erlaubt, dass sich Clients sowohl mit 20 MHz als auch mit 40 MHz verbinden
können. Sind zu viele Störungen im Frequenzband vorhanden, schaltet der Access Point außerdem
automatisch auf 20-MHz-Kanäle zurück.
Letztendlich birgt die Verwendung von 40-MHz-Kanälen erhebliche Risiken für den
Gesamtdatendurchsatz in dem bereits stark belegten 2,4-GHz-Frequenzband. Daher sollte hinsichtlich
des Designs heterogener WLAN-Netze mit vorhandenen 802.11b/g-Geräten der 20-MHz-Modus Verwendung
finden. Dies ist bei der Konfiguration der Produkte zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern.
Hinzu kommt, dass die Steigerung der Nettodatendurchsätze bei 40-MHz- gegenüber 20-MHz-Kanälen
nicht zu der angenommenen, theoretischen Verdoppelung der Datendurchsätze führt. Wie
Vergleichsmessungen in realen Umgebungen zeigen, ergibt sich der prozentual größte Gewinn von
40-MHz-Kanälen unter Verwendung von nur einer Antenne auf Sende- und Empfangsseite.
Diese Erkenntnisse beeinflussen auch die aktuelle Entwicklung des Drafts 802.11n. So werden im
künftigen ratifizierten Standard nur noch 20-MHz-Kanäle spezifiziert sein. Dies soll insbesondere
der vorhandenen 802.11b/g-Landschaft Rechnung tragen. Zugleich geht damit jedoch auch einher, dass
der endgültige 802.11n-Standard im 2,4-GHz-Band Bruttodatenraten von maximal 290 MBit/s statt 600
MBit/s ermöglicht. Auf die Nettodatendurchsätze wirken sich diese Neuerungen allerdings nur
marginal aus.
802.11n und Richtfunkstrecken
Das Design von Richtfunkstrecken war bei den Standards 802.11b/g/a bisher durch das Verwenden
von nur jeweils einer Antenne mit starker Richtcharakteristik auf Sende- und Empfangsseite
gekennzeichnet. Bei 802.11n-Produkten zeigen reale Messungen ein anderes Ergebnis. Aufgrund der
MIMO-Technik sind die höchsten Datenraten mittels Reflexionen des Funksignals zu erreichen. So
empfiehlt es sich, beim Einsatz von 802.11n auf Richtfunkstrecken – etwa zur Verbindung zwischen
Gebäuden – mehrere externe Antennen zu verwenden. Ideal sind drei Antennen, die jeweils über eine
Richtcharakteristik mit relativ großem Öffnungswinkel verfügen sollten; Standardprodukte sind
zumeist nur mit einfachen omnidirektionalen 2-dBi-Antennen ausgestattet. 11n-Geräte profitieren
zudem vom so genannten Beamforming. Letzteres führt zu einer Verformung der Strahlenkeule, die eine
automatische Ausrichtung der Antennen auf die jeweilige Gegenstelle ermöglicht. Dies geschieht
elektronisch und für den Nutzer vollkommen transparent.
802.11n und Dual-Band
In der jüngsten Zeit sind Draft-802.11n-Produkte erhältlich, die sowohl im 2,4-GHz als auch im
5-GHz-Frequenzband arbeiten. Der Standard spezifiziert beide Frequenzbänder und erlaubt zudem die
alleinige Verwendung des 5-GHz-Frequenzbands. Im 5-GHz-Band gelten auch bei 802.11n die bekannten
Vorteile: Dazu zählt die Verfügbarkeit von mehr nicht-überlappenden Kanälen, die bisher geringere
Benutzung sowie damit einhergehend die geringere "Verschmutzung" gegenüber dem
2,4-GHz-Frequenzband. Ein für das WLAN-Design äußerst wichtiger Aspekt ist der Einsatz
tatsächlicher 2,4-/5-GHz-"Concurrent"-Systeme. Derzeit existieren noch erhebliche Unterschiede
zwischen den verfügbaren 11n-Dual-Band-Produkten. "Concurrent"-Geräte zeichnen sich durch das
gleichzeitige Arbeiten mit der vollen 802.11n-Leistung in beiden Frequenzbändern aus. So kann ein
Access Point im 2,4-GHz-Band sowohl die vorhandenen 802.11g- und 802.11n-Clients anbinden als auch
simultan im 5-GHz-Frequenzband 802.11a- und 802.11n-Geräte bedienen. Die volle Leistungsfähigkeit
von 802.11n wird dabei auf jeden Fall immer ausgeschöpft.
Fazit
802.11n ist auf dem Weg, die beherrschende WLAN-Technik der nächsten Jahre zu werden. So lassen
sich mit 802.11n nicht nur höhere Datendurchsätze erreichen, sondern auch die Reichweiten im Haus
aber auch im Freien um den Faktor 2 bis 3 steigern. Dadurch ergibt sich die Abdeckung einer
größeren Fläche, und es sind weniger Access Points zur Funkversorgung des gleichen Gebietes nötig.
Im Hinblick auf WLAN-Designs mit 802.11n sind die MIMO-Mechanismen unter Nutzung der Reflexionen zu
beachten. Dies gilt insbesondere für Richtfunkstrecken und reflexionsarme Umgebungen. Darüber
hinaus sollten Administratoren sehr detailliert ein Site Survey, inklusive der vorhandenen
WLAN-Clients durchführen, um die Effekte von 20-/40-MHz-Kanälen bewerten und um eventuell
auftretende geringe Datendurchsätze erklären zu können.