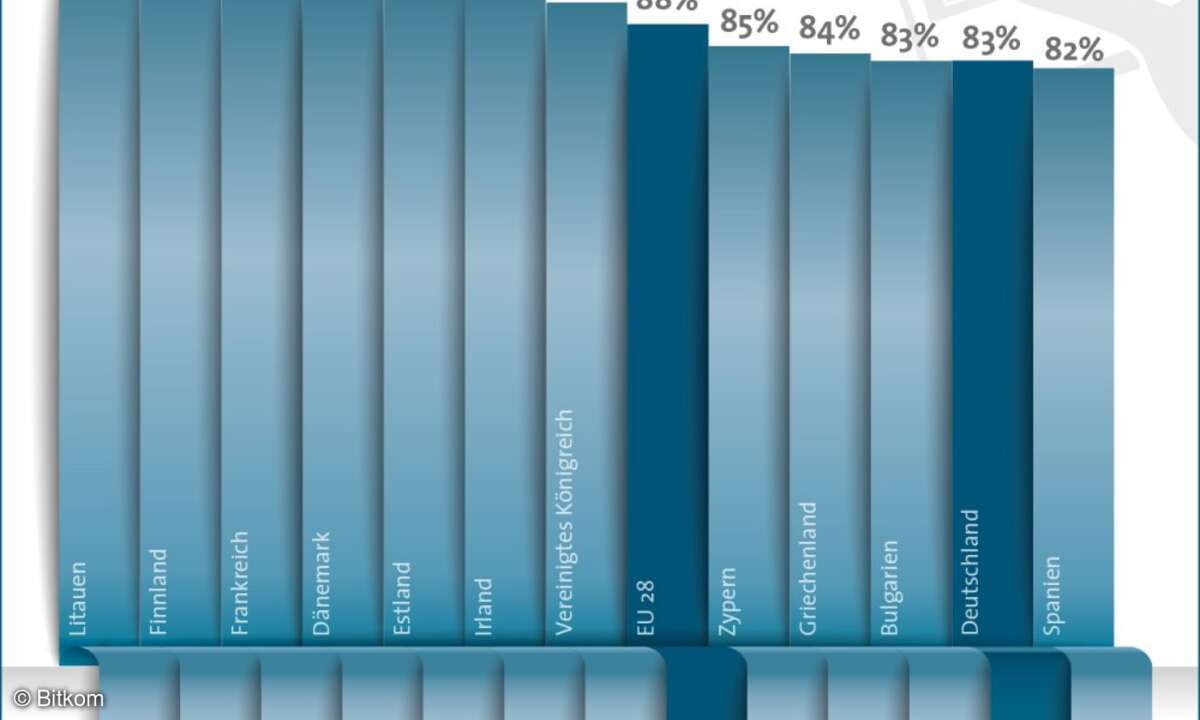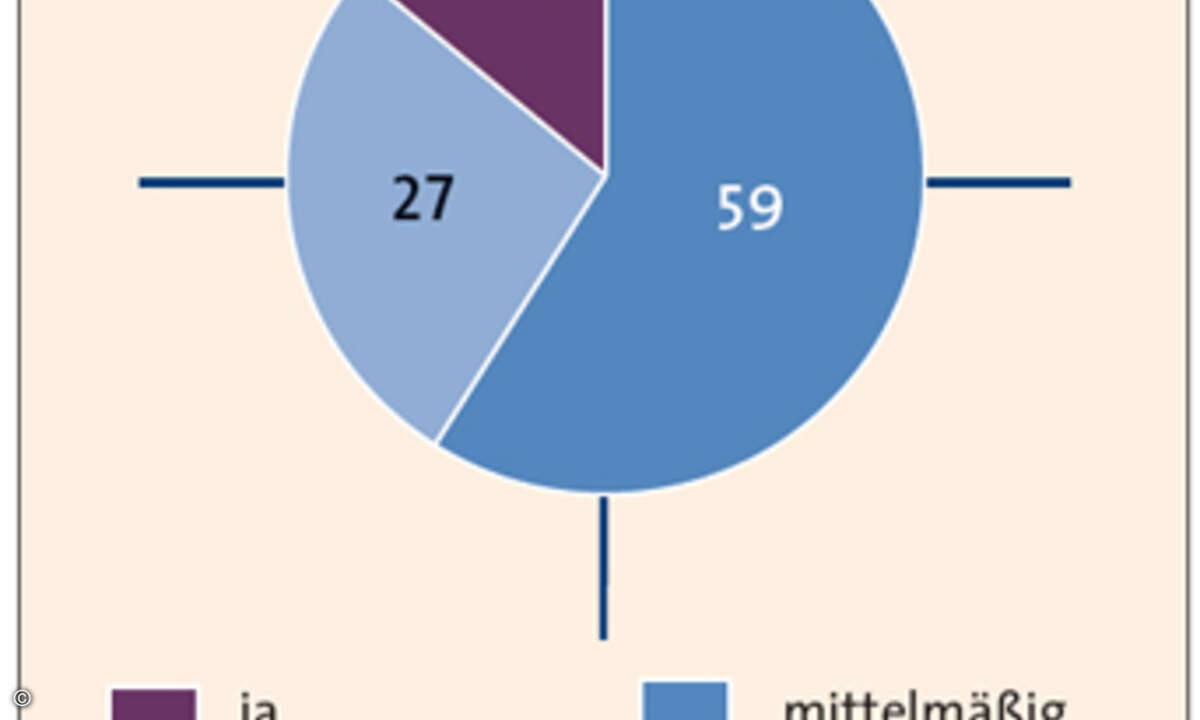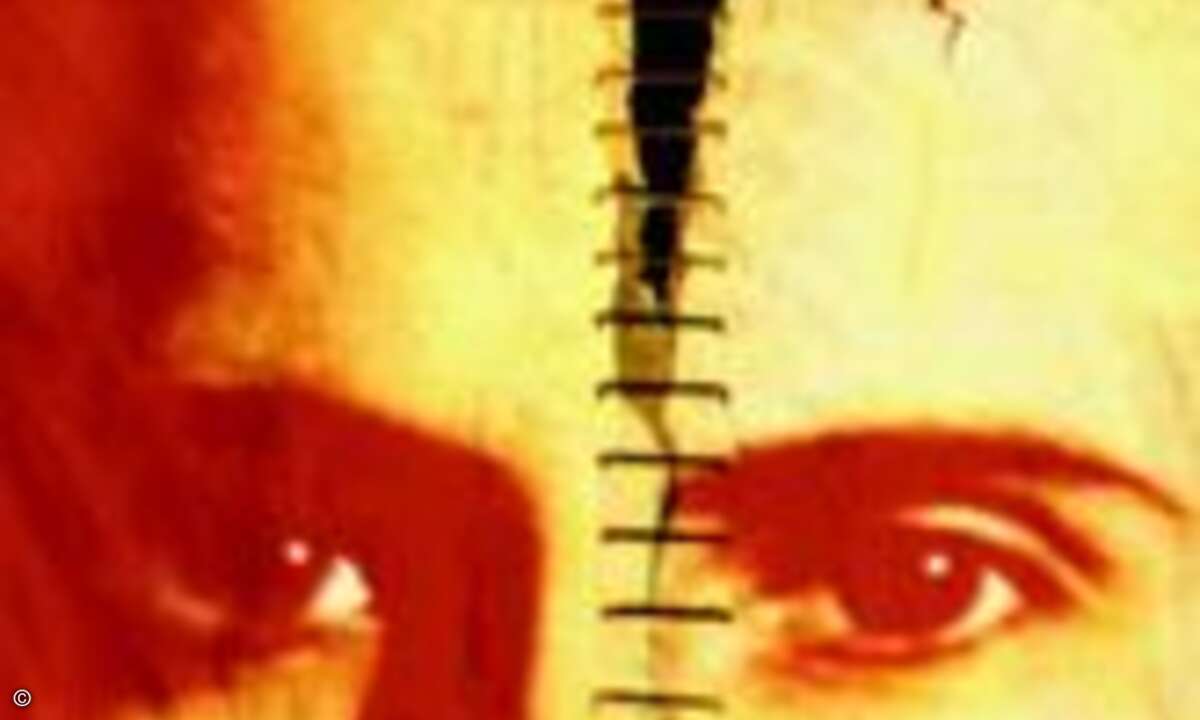Forschung tut Not!
Forschung tut Not!. Deutschen Ansätzen im E-Government mangelt es an wissenschaftlichen Grundlagen und begleitenden Analysen. Deshalb haben vier Wissenschaftler im Auftrag der Gesellschaft für Informatik jetzt einen Forschungsplan für Verwaltungsinformatik erarbeitet.

Forschung tut Not!
Deutschland hängt in Sachen Verwaltungsinformatik in Forschung und Hochschule weit hinter anderen Ländern zurück. Das hat negative Auswirkungen auch auf das praktische Verwaltungshandeln und vor allem auf die Versuche, E-Government zu realisieren. Außerdem ist Deutschland dadurch im Wettlauf der Volkswirtschaften in einer globalisierten Wirtschaft benachteiligt. So lautet die Kernthese der Studie »E-Government Forschungsplan«, die Jörn von Lucke, Reinhard Riedl, Tino Schuppan, Maria Wimmer und Martin Wind im Auftrag des Fachausschusses für Verwaltungsinformatik der Gesellschaft für Informatik erstellt wurde (Download unter http://www.docs.ifib.de/egov-plan/).
Die Autoren führen den Rückstand der deutschen Verwaltungsinformatik unter anderem auf die außerordentlich veränderungsresistenten Strukturen der Verwaltung zurück. Außerdem seien die neuen Möglichkeiten der Informatik, die mittlerweile tatsächlich strukturoptimierende Fähigkeiten mitbringt, vielen Verwaltungsmitarbeitern nicht bewusst. Weitere Mankos: Verwaltungsmodernisierung und E-Government werden zu oft getrennt betrachtet. Stark föderalistische Strukturen hemmen die übergreifende Zusammenarbeit. Viele Verwaltungsmitarbeiter sind nicht sonderlich technikbegeistert, eher im Gegenteil. Auch die Technologien selbst sind noch zu kompliziert, zu wenig skalierbar und modular. Das verringert die Akzeptanz der Nutzer.
Technik treibt den Wandel an
Als Motoren der Veränderung nennt die Studie mehrere technische Faktoren:
? die wachsende Verarbeitungsgeschwindigkeit, die Data Mining und amts- oder parteieigene Informationsfilter ermöglicht,
? das semantische Web, das beliebige, in- und externe Informationsquellen vernetzt,
? modulare, vernetzungs- und prozessorientierte Software wie Web Services.
Gemeinsam führen alle diese Technologien zu Kosteneinsparungen, Effizienzsteigerungen und mehr Datenqualität. Ihr Veränderungspotential reicht weit über die Unterstützung bestehender Abläufe hinaus, sondern ermöglicht vollkommen neue Strukturen.
Die Autoren entwickeln Perspektiven für ein verändertes Verwaltungshandeln, das die neuen technischen Möglichkeiten konsequent nutzt. So könnten unterschiedliche technische Systeme zusammenwachsen und neue, IT-gestützte Verwaltungsleistungen definiert werden. Verwaltungsvorgänge lassen sich idealerweise komplett digital erledigen. Bei komplexeren Aufgaben, etwa Ausschreibungen, könnten die Bürger auch durch Avatare (digitale, menschenähnliche Figuren) oder intelligente Agenten unterstützt werden. Proaktive Leistungen, zum Beispiel digitale Hinweise auf den Ablauf von Pässen oder Genehmigungen, sind denkbar.
Unterschiedliche Akteure der Verwaltung lassen sich zu Leistungsnetzen verbinden, die sich die Aufgaben komplexerer Vorgänge teilen und digital miteinander kommunizieren, zum Beispiel Prozesse abwickeln oder Dokumente gemeinsam bearbeiten. Vorbedingung dafür ist aber eine Government Application Integration (GAI) mit integrierter Vorgangsverwaltung und digitaler Dokumentation. Damit solche Ansätze realisierbar werden, muss nach Meinung der Autoren aber auch der bestehende Gesetzesdschungel auf hinderliche Vorschriften durchforstet werden.
Mehr Bürgerbeteiligung
Bürger lassen sich wirkungsvoller am politischen Prozess beteiligen, zum Beispiel über elektronische Abstimmungen, Foren oder durch Bereitstellung von digitalen Informationen. Die Entscheidungsträger selbst könnten ebenfalls von einer besseren, insbesondere plattformübergreifenden digitalen Bereitstellung der vorhandenen riesigen Informationsmengen der einzelnen Verwaltungsinstanzen profitieren, zum Beispiel in Data Warehouses. Sie könnten dabei helfen, den internen Transparenzrückstand, den die Verwaltung heute gegenüber Wirtschaftsunternehmen hat, abzubauen. Derartige Echtzeitinformationssysteme bezeichnet die Studie als kritische Wettbewerbsfaktoren, weil schlechtere Informationen schlechtere Entscheidungen bedingen.
Die Studie schlägt daher vor, bestehende Ansätze und Projekte des
E-Government und der Verwaltungsinformatik neutral, dauerhaft und strukturiert zu überwachen. Außerdem drängen die Autoren darauf, einen Innovationsmarkt speziell im öffentlichen Sektor aufzubauen. Nachdrücklich warnen sie vor der heute weit verbreiteten Übernahme wirtschaftsinformatischer Erkenntnisse und Verfahren auf das E-Government. E-Government habe andere Aufgaben als der private Sektor, bediene andere Interessengruppen und stelle höhere Anforderungen an Qualität und die Art der Technologienutzung. Erforderlich sind nach Meinung der Autoren vielmehr vollkommen neue Formen der Technologiegestaltung und -adaption. Wichtig seien zum Beispiel Softwaredesign auf einer höheren Abstraktionsstufe, die die Dominanz der technisch ausgerichteten Entwicklungsprozesse beende.
Interoperabilität und die Integration verschiedener Behörden und Verwaltungen ist ein weiterer Schlüsselbegriff. Gemeinsame Standards, die den Datenaustausch, aber auch Prozesse über Organisationsgrenzen hinweg ermöglichen, sind hier ein wichtiger Faktor. Dazu sind rollen- und identitätsbasierende Sicherheitsverfahren nötig. Allerdings gibt es hierfür keine übergreifende Ideallösung, weil sich die Datenschutz-Anforderungen an die einzelnen Akteure zu stark unterscheiden.
Wissen gemeinsam nutzen
Um Wissen gemeinsam nutzen zu können, müsste zudem eine gemeinsame Begrifflichkeit entwickelt und das digitale Wissen dann über geeignete Portale und Plattformen organisationsübergreifend breitgestellt werden.
Technische Basis übergreifender Lösungen sind service- und prozessorientierte Architekturen (SOA/ POA). Wegen der unterschiedlichen Verwaltungsverfahren, Prozesse und Gesetze in einem föderalen Staat lassen sie sich aber wesentlich schwerer realisieren als in der Wirtschaft.
Um dies alles zu erreichen, fordern die Autoren der Studie eine Qualifikationsoffensive, die Verwaltungsmitarbeiter mit den Möglichkeiten und Chancen der digitalen Technologien vertraut macht. Außerdem empfehlen sie die Ausbildung von Verwaltungsinformatikern, die in eigenständigen Studiengängen ausgebildet werden sollten.
Um relevantes Wissen im Bereich Verwaltungsinformatik/E-Government zu erarbeiten, fordert die Studie mehr interdisziplinäres Forschen und Lehren zwischen Informatik, Verwaltungswissenschaft und Sozialwissenschaften. Solche interdisziplinär geschulten Verwaltungsinformatiker sind heute Mangelware, was verhindert, dass die aktuellen E-Government-Projekte angemessen wissenschaftlich begleitet werden. Statt dessen übernimmt die Verwaltung oft einfach Konzepte aus der Wirtschaftsinformatik. Forschung erfolgt weitgehend projekt- und anwendungsbezogen durchgeführt und fremdfinanziert, die Ergebnisse werden weder national noch international vernetzt.
Um dieses Defizite zu beheben, schlagen die Autoren eine Art Masterplan Wissenschaftliche Verwaltungsinformatik vor (siehe Kasten), der innerhalb von fünf Jahren rund 13,5 Millionen Euro kosten, aber möglicherweise gravierende Fehlinvestitionen verhindern würde.