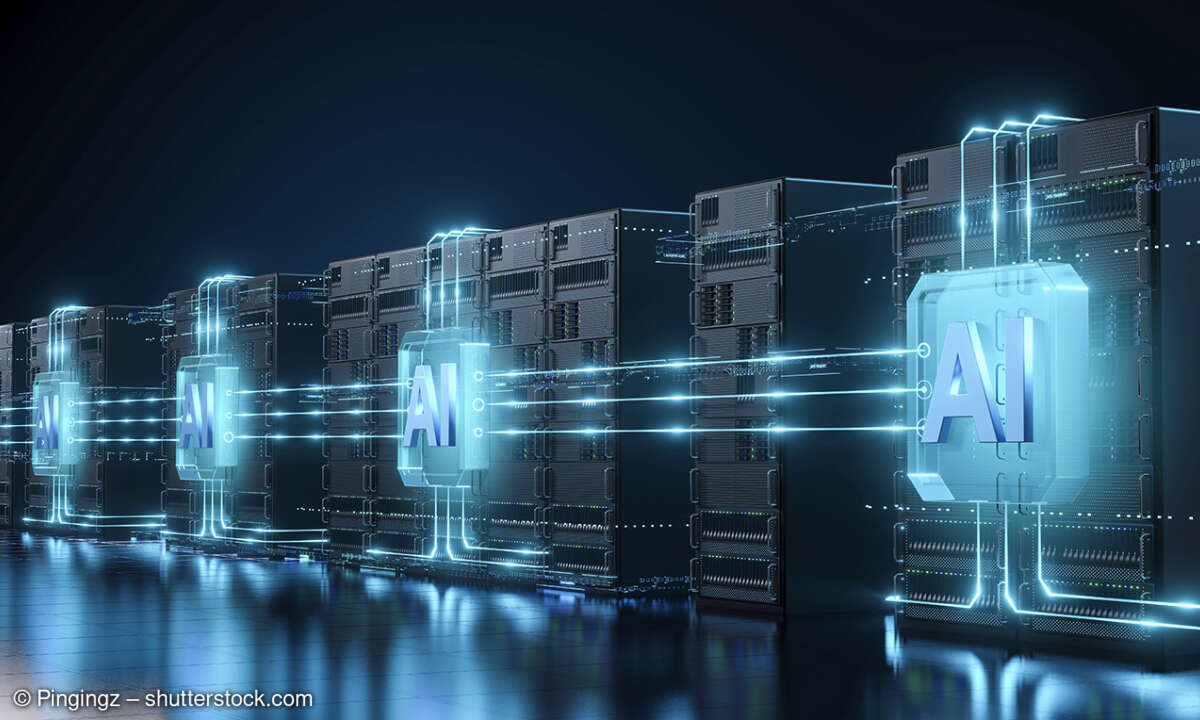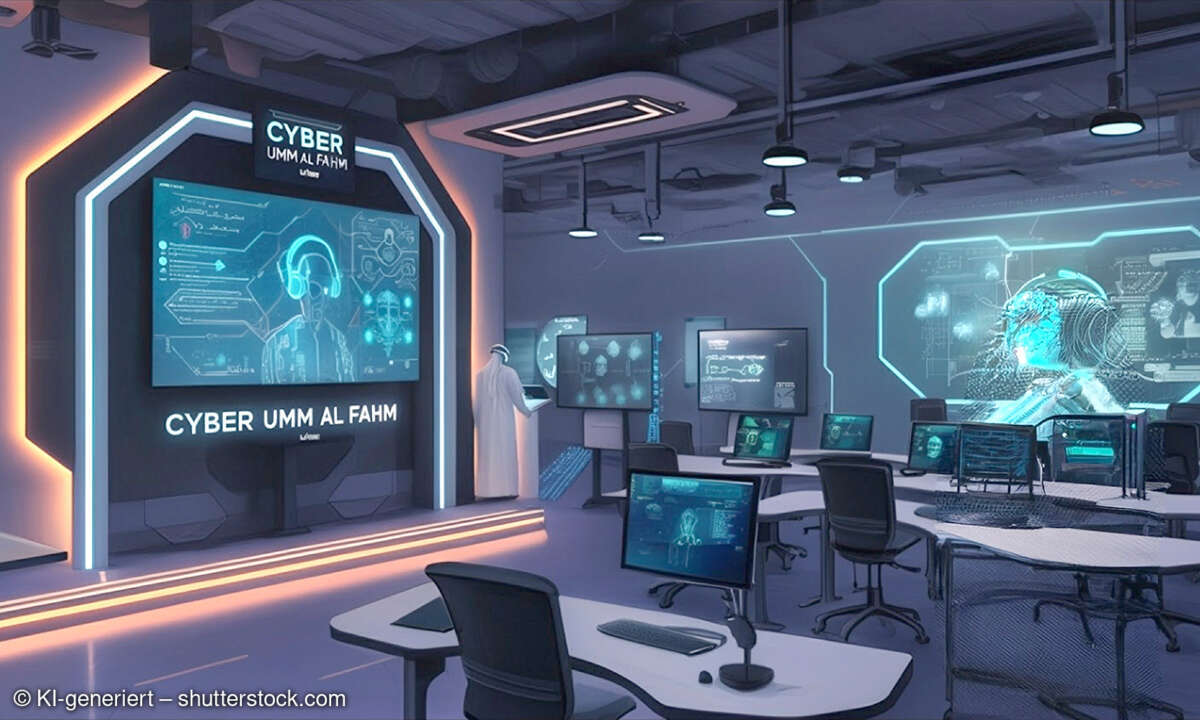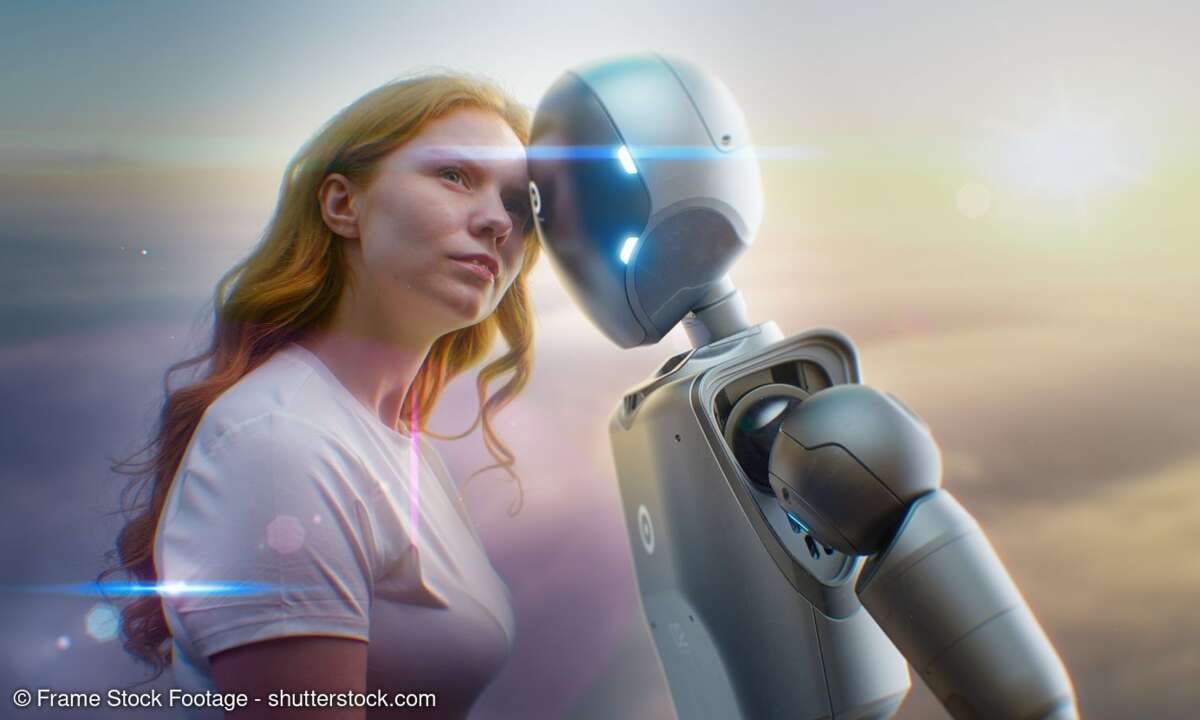Studie offenbart Ungleichheiten und Widersprüche bei der Einführung von KI am Arbeitsplatz
Unternehmen setzen sich weltweit mit der Einführung, dem Mehrwert und den ethischen Aspekten von KI auseinander. Dazu hat eine Studie von The Adaptavist Group grundlegende Widersprüche in der Herangehensweise und Umsetzung dieser Technik durch Unternehmen aufgedeckt, die teils ein Traum, teils eine Dystopie ist.

Durchgeführt als Teil der Studie „Digital Etiquette: Unlocking the AI gates" befragte das Unternehmen 900 Experten, die für die Einführung und Implementierung von KI in Großbritannien, den USA, Kanada und Deutschland verantwortlich sind.
Bei den 225 Befragten in Deutschland zeigte sich eine große Kluft zwischen den 42 Prozent, die die KI-Ansprüche ihres Unternehmens für übertrieben halten – den „KI-Skeptikern“ – und den 34 Prozent, die dies nicht tun, den „KI-Realisten“.
Für die „KI-Skeptiker“ – Führungskräfte, die die Aussagen ihres Unternehmens für übertrieben halten – bringt die Technik vermeintliche Gefahren und Ängste mit sich: 56 Prozent der Befragten glauben, dass ihr Unternehmen Kunden durch den Einsatz von KI finanziell, psychisch oder physisch gefährdet. Im Gegensatz dazu sind nur 13 Prozent der Meinung, dass ihr Unternehmen realistische Versprechen zu KI macht.
Trotz dieser trüben Aussichten investieren die Unternehmen, die KI überbewerten, Millionen in diese Technik: 36 Prozent der KI-Skeptiker hatten in den letzten zwölf Monaten zwischen 1,14 und 11,47 Millionen Euro in die Implementierung der Technik investiert, 7 Prozent investierten über 11,47 Millionen Euro. Das ist mehr als ihre „realistischen” Kollegen, von denen 30 Prozent zwischen 1,14 und 11,47 Millionen Euro und 4 Prozent sogar mehr ausgegeben haben. Die nur geringe Differenz zeigt jedoch, dass der Unterschied in der Einstellung wahrscheinlich nicht mit der Höhe der Investitionen zusammenhängt.
In Unternehmen, in denen die KI-Einführung von den eher skeptischen Verantwortlichen vorangetrieben wird, ist der Treiber für die Implementierung von KI eher der Handlungsdruck, es sind weniger die Ergebnisse: 79 Prozent gaben an, dass sie ihr Team zur Nutzung der Technik ermutigen, weil sie das Gefühl haben, dass sie das tun sollten, und nicht, weil sie einen konkreten Mehrwert bietet, verglichen mit 64 Prozent der Realisten. Diese Kluft zwischen den Befragten – also genau den Personen, die KI in Unternehmen integrieren – deutet darauf hin, dass die Technik den Teams von oben herab aufgezwungen wird, möglicherweise ohne die erforderliche Unterstützung oder Schulung.
Die unterschiedlichen Einstellungen beruhen auf unterschiedlichen Wertvorstellungen hinsichtlich der KI. KI-Führungskräfte in Unternehmen, die einen eher zurückhaltenden Ansatz bei der Einführung von KI verfolgen, berichten von konkreteren Ergebnissen. Sie haben mehr Vertrauen in die Technik, sind experimentierfreudiger und sehen eher Verbesserungen in der Arbeitsqualität, Zeiteffizienz und Produktivität.
Die Studienergebnisse fallen in eine kritische Zeit, in der Unternehmen mit der flächendeckenden Einführung von KI zu kämpfen haben, während ihre Mitarbeiter zunehmend skeptisch werden. Der Hype ist nach wie vor groß, doch immer mehr Experten werden desillusioniert, und renommierte Studien von Organisationen wie dem MIT kommen zu dem Schluss, dass 95 Prozent der generativen KI-Pilotprojekte scheitern. Im Anschluss an den MIT-Bericht zeigt die Studie von The Adaptavist Group, wie Unternehmenskultur, Wahrnehmung und Umsetzung einen enormen Einfluss auf den Erfolg von KI haben können.
Zuckerbrot und Peitsche
KI-Skeptiker, die sich gezwungen sehen, schnell Ergebnisse zu liefern oder hohe Erwartungen zu erfüllen, berichten von einer Kultur der Angst, Schuldzuweisungen und strengen Einschränkungen. In diesen Unternehmen befürchten 56 Prozent der Befragten, dass die Einführung von KI Arbeitsplätze gefährdet, verglichen mit nur 13 Prozent der weniger skeptischen Führungskräfte. Ebenso gaben 78 % der Führungskräfte, die der Meinung waren, dass ihr Unternehmen die Vorteile der KI überbewertet, an, dass ihr Unternehmen KI-Innovationen nutzt, um Personal abzubauen, verglichen mit 33 Prozent der Unternehmen mit realistischen Erwartungen.
45 Prozent der KI-Skeptiker sagten, dass sie ihre Nutzung von KI am Arbeitsplatz aus Angst vor Konsequenzen verheimlichen, gegenüber nur 9 Prozent der KI-Realisten – was wahrscheinlich auf eine schlechte Unternehmenskultur zurückzuführen ist.
58 Prozent – und damit mehr als die Hälfte – der Beschäftigten in Unternehmen mit übertriebenen Erwartungen befürchten, fälschlicherweise der Nutzung von KI verdächtigt zu werden, während 53 Prozent der Meinung sind, dass Kollegen Nutzer von KI als weniger kompetent wahrnehmen. Dies steht in krassem Gegensatz zu den 26 Prozent und 10 Prozent der KI-Realisten, die derselben Meinung sind.
Unterschiede in der Einstellung der Unternehmen gegenüber bestimmter Messgrößen können ebenfalls Aufschluss über die unterschiedlichen Erfahrungen der beiden Gruppen geben, wobei KI-Skeptiker stärker unter Druck stehen, messbare Ergebnisse zu liefern. KI-Skeptiker geben an, dass ihr Unternehmen die Nutzung von KI eher an Leistungs-KPIs knüpft (46 Prozent gegenüber 20 Prozent) und Experimente eher ablehnt (65 % gegenüber 25 %). Dies deutet darauf hin, dass in Unternehmen, die KI als eine Verpflichtung mit hohem Risiko betrachten, eine restriktive Kultur entsteht, die Neugier und Experimentierfreudigkeit hemmt.
Lücken in der Schulung können diesen Druck noch verstärken und KI-Skeptiker zum Scheitern verurteilen: 52 Prozent der Führungskräfte in Unternehmen, in denen KI überbewertet wird, geben an, dass es keine formellen KI-Schulungen gibt, verglichen mit 19 Prozent der Realisten. Der vorherige Bericht von The Adaptavist Group hat die Bedeutung von Schulungen und die weit verbreiteten Unterschiede beim Zugang zu diesen aufgezeigt.
Den Nutzen neuer Technik erschließen
Im Gegensatz dazu berichteten KI-Verantwortliche in Unternehmen, die der Meinung waren, dass der Nutzen von KI ehrlich kommuniziert wurde, von weitaus größeren Vorteilen. 55 Prozent sagen, dass KI die Arbeitsqualität verbessert hat (gegenüber 39 %) der Führungskräfte, die der Meinung waren, dass ihre Unternehmen die Vorteile von KI überbewertet haben), 57 Prozent berichten von Zeitersparnissen (gegenüber 27 Prozent) und 39 Prozent stellen eine Leistungssteigerung fest (gegenüber 27 Prozent).
Diese Unternehmen berichten auch von weniger ethischen und operativen Herausforderungen. Die Bedenken hinsichtlich Plagiaten, Täuschungen, Ungenauigkeiten und Voreingenommenheit sind bei KI-Realisten, in denen mehr Schulungen durchgeführt wurden, deutlich geringer:
- Nur 34 Prozent der KI-Realisten beschäftigen sich mit Fragen der Ethik und des Plagiats, verglichen mit 67 Prozent der KI-Skeptiker,
- 19 Prozent der KI-Realisten machen sich Gedanken über Realitätsverluste, gegenüber 62 % der KI-Skeptiker, und
- 22 Prozent äußern Bedenken hinsichtlich der Voreingenommenheit, verglichen mit 63 Prozent in vermeintlich überbewerteten Umgebungen.
Die besser ausgebildeten KI-Realisten verbringen auch weniger Zeit damit, KI-Ergebnisse zu korrigieren, was die ausgeprägtere Schulung oder Beratung widerspiegelt, die sie erhalten haben: 20 Prozent bearbeiten oder regenerieren regelmäßig Antworten, gegenüber 67 Prozent der skeptischen Führungskräfte. KI-Realisten fördern Experimente, bauen Vertrauen in KI-generierte Arbeit auf und schaffen Umgebungen, in denen sowohl Menschen als auch Technik gedeihen können.
KI-Kluft wird trotz massiver Investitionen weiter wachsen
Die schnelle Verbreitung von Tools trägt ebenfalls zur Diskrepanz bei und lässt vermuten, dass KI-Skeptiker möglicherweise Opfer eines „zu schnellen, zu starken” Wandels geworden sind. 67 Prozent der KI-skeptischen Führungskräfte sind der Meinung, dass zu viele KI-Tools zu schnell eingeführt werden, verglichen mit 23 Prozent der KI-Realisten. 62 Prozent der KI-skeptischen Führungskräfte erwarten, dass ihre KI-Nutzung in den nächsten zwölf Monaten zurückgehen wird, verglichen mit nur 10 Prozent der Realisten.
Dies macht deutlich, dass selbst bei erheblichen Investitionen, einer positiven Wahrnehmung und einem guten Ansatz die Frage, ob KI als Verpflichtung mit hohem Druck oder als überschaubares, nützliches Werkzeug angesehen wird, darüber entscheidet, ob Unternehmen einen „Traum“ oder eine „Dystopie“ erleben. CEOs und CTOs müssen sich fragen, ob sie ihren KI-Führungskräften die richtigen Schulungen und die richtige Denkweise vermittelt haben, um Wachstum zu ermöglichen, so die Studienautoren.
Jon Mort, CTO von The Adaptavist Group, kommentierte dies so: „Der Kontrast zwischen Führungskräften, die von der KI-Entwicklung ihres Unternehmens überzeugt sind, und solchen, die mit schlechten Ergebnissen, überstürzten Implementierungen und einer widerstrebenden Belegschaft zu kämpfen haben, ist eklatant. Welche Seite der Medaille für Ihr Unternehmen zutrifft, scheint von der Wahrnehmung abzuhängen, aber es gibt Faktoren, die diese Wahrnehmung beeinflussen. Unternehmen, die KI-Tools lediglich als Ersatz für bestehende Arbeitsplätze oder Aufgaben betrachten, ohne ihr Arbeitssystem als Ganzes zu sehen, sind zum Scheitern verurteilt.“
Führungskräfte, die dazu gedrängt werden, KI in rasantem Tempo „einfach einzuführen“, ohne Schulungen oder ausreichend Zeit zum Testen, Verfeinern und Aufbauen der richtigen Strukturen, geraten viel eher in eine Kultur der Angst vor KI und verlieren das Vertrauen in den Wert menschlicher Arbeit, so Mort weiter. Um den wahren Wert von KI freizusetzen, müssten Unternehmen experimentieren, jedoch genug Zeit einplanen, um sie verantwortungsbewusst einzuführen, in Schulungen zu investieren und ein Umfeld zu schaffen, in dem sowohl Menschen als auch Technik gedeihen können, so der CTO abschließend.