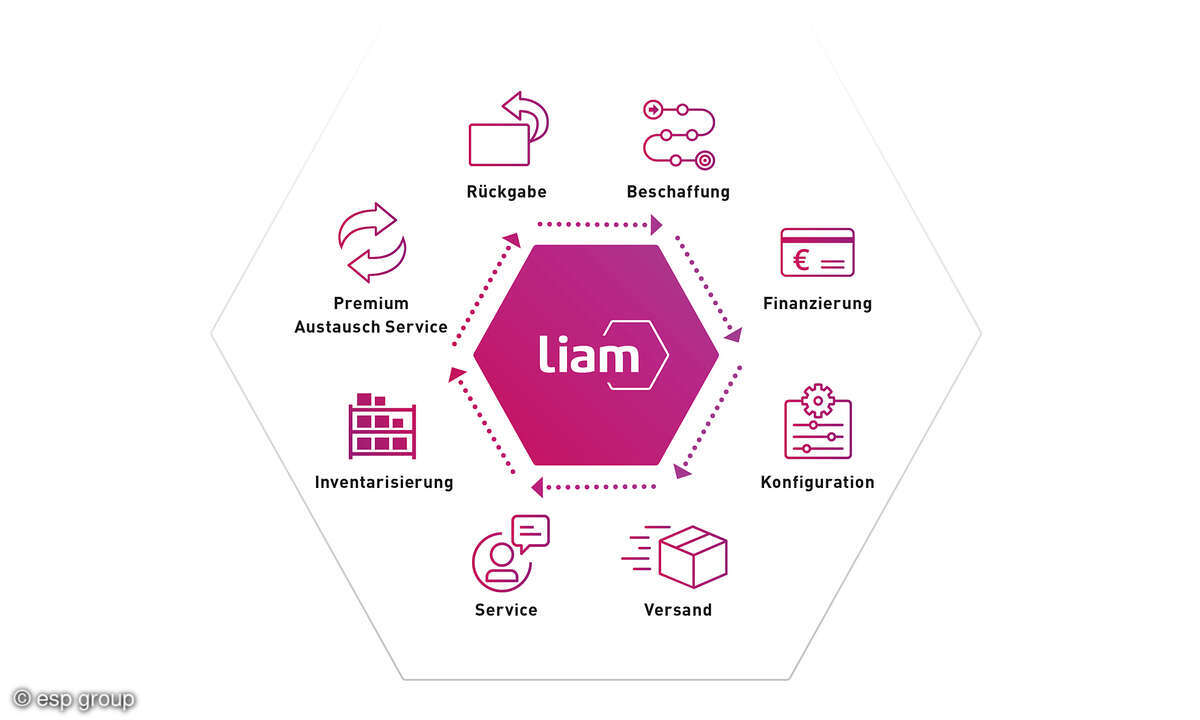Fallstricke bei SLAs
- "Es geht immer um Verantwortung"
- Fallstricke bei SLAs
funkschau: Welche Fallstricke sollten bei SLAs generell beachtet werden? Welche Parameter dürfen in SLAs auf keinen Fall fehlen?
Hühold: Bei SLAs handelt es sich um eine Definition von Parametern. Entscheidend ist, die dahinterliegenden Prozesse ganzheitlich zu betrachten. In Zeiten von Multi-Cloud- und Multi-Dienstleister-Szenarien kann allein die Ausformulierung der SLAs eine recht komplexe Herausforderung sein. Schließlich erstrecken sich die zu erbringenden Services über viele Ebenen – von der Infrastruktur über die Applikationen bis hin zu Kommunikationsnetzen. Vor diesem Hintergrund müssen Incident- und Service-Management optimal aufeinander abgestimmt sein. In der Praxis entsteht dabei oftmals ein großes Missverständnis. Viele Unternehmen sind heute der Meinung, dass sie die Verantwortung für ihr Geschäft komplett abgeben, wenn sie Outsourcing betreiben. Das ist ein Irrglaube. Verbleiben die Applikationen weiterhin bei einem Unternehmen, trägt es nach wie vor die Verantwortung dafür.
Argumente wie „ein anderer Dienstleister hat nicht geliefert, das ist also ein Fall für die SLAs“ hören wir immer wieder. Sie sind aber nicht haltbar. Die Verantwortung dafür, eine Software zu warten und aktuell zu halten, um zu verhindern, dass beispielsweise Sicherheitslücken entstehen, obliegt dem Unternehmen – trotz Outsourcing. Es gibt genau eine Konstellation, in der Arvato Systems die Verantwortung für Pflege, Wartung, Updates und dergleichen übernimmt. Nämlich dann, wenn ein Unternehmen uns diese Verantwortung vollumfänglich überträgt. Dass ein derartiges Outsourcing nicht zum Nulltarif zu haben ist, ein tiefgehendes Onboarding voraussetzt und mit anderen Prozessen einhergeht, überrascht allerdings viele Unternehmen. Hier muss ein Umdenken stattfinden: Entweder müssen Firmen die Verantwortung für ihr eigenes Business übernehmen. Oder sie müssen bereit sein, den Preis für den vollumfänglichen Service zu zahlen.
funkschau: Full-Services-Vertrag oder selektives Auslagern einzelner IT-Services: Gibt es hier Unterschiede bei den SLAs?
Hühold: Ob Unternehmen einzelne Applikationen oder ihre komplette IT auslagern, ist in der Regel von ihrer Größe abhängig. Die Mehrzahl der Start-ups kümmert sich selbst um Prozesse und Applikationen, große Konzerne wollen möglichst viel extern verlagern. Hier beobachten wir einen klaren Trend: Unternehmen suchen einen Partner, der sie bei der Transformation ihrer eigenen IT unterstützt – ein höchst strategisches Vorhaben. Dabei geht es in erster Linie darum, Eigenentwicklungen durch Software-as-a-Service-Lösungen zu ersetzen. Viele Unternehmen wollen noch einen Schritt weiter gehen und ihr komplettes Application-Management an einen Dienstleister auslagern. Für einen solchen Full-Service-Ansatz braucht es individuelle SLAs, die das jeweilige Unternehmen und seine Prozesse widerspiegeln müssen.
funkschau: Es gibt Stimmen, die sagen, dass kleinere Unternehmen bei einem kleinen Outsourcing-Anbieter besser aufgehoben sind, größere Unternehmen eher bei einem großen. Wie sehen Sie das?
Hühold: Es kommt immer auf das Unternehmen an, würde ich sagen. Wenn ein Start-up seine IT-Infrastruktur an einen Hyperscaler wie AWS, Azure oder Google auslagert, arbeitet es mit einem sehr großen Unternehmen zusammen. Unter einer Voraussetzung kann das gut passen: Nämlich dann, wenn der Hyperscaler ein flexibles Self-Service-Portal hat, über welches das Start-up seine Infrastruktur individuell gestalten kann. Wenn man von diesen Hyperscalern absieht, ist es schon so, dass Kunde und Dienstleister ähnlich groß sein sollten. Insbesondere im Beratungsumfeld muss der Dienstleister groß genug sein, um skalieren zu können. Kleine Dienstleister können die Anforderungen großer Kunden oftmals nur bis zu einem gewissen Grad erfüllen – und sei es nur aus personellen Gründen. Aber auch umgekehrt kann es zu Komplikationen kommen. Größere Dienstleister sind Sicherheitsnormen verpflichtet, sie arbeiten strukturiert und prozessorientiert. In Zusammenarbeit mit einem Start-up, das sein Geschäftsmodell gerade erst entwickelt, kann es darum zu Unstimmigkeiten kommen, die zwar ungewollt sind, sich aber in der Praxis nicht vermeiden lassen. Oftmals gibt es keine Lösung: Der Dienstleister kann nicht von seinen Standards abrücken, während das Start-up seine Zeit braucht, sich zu etablieren. In solchen Fällen ist das Start-up bei einem Hyperscaler unter Umständen besser aufgehoben.