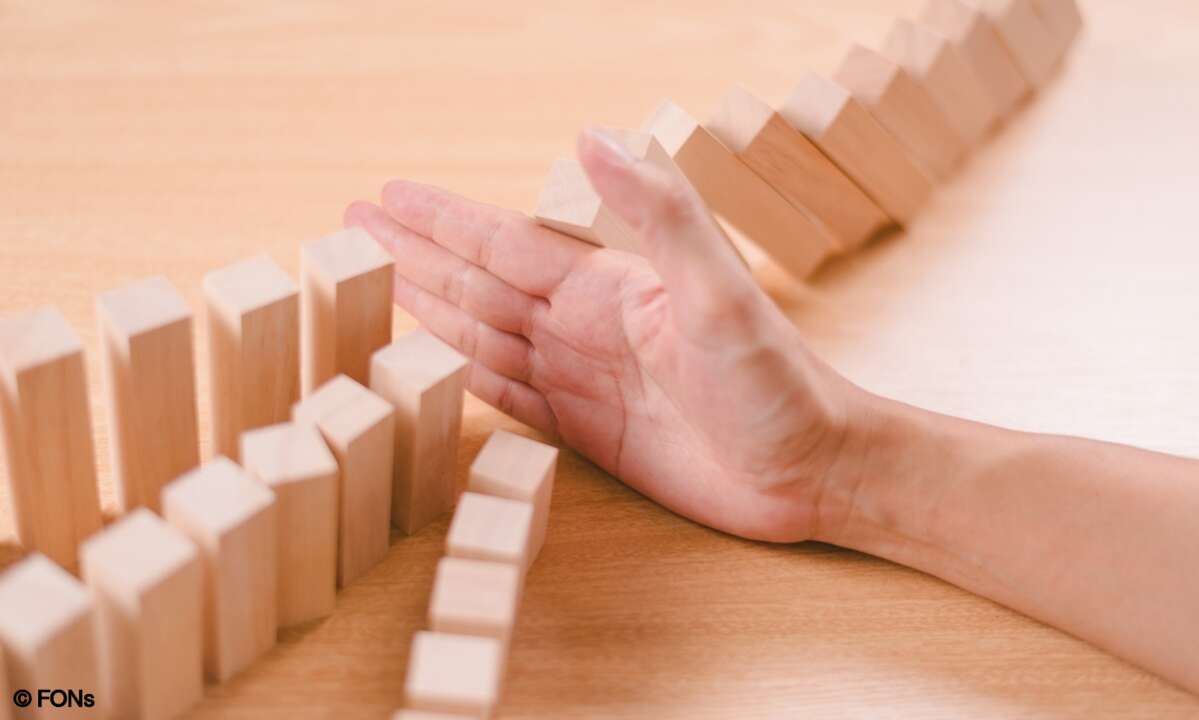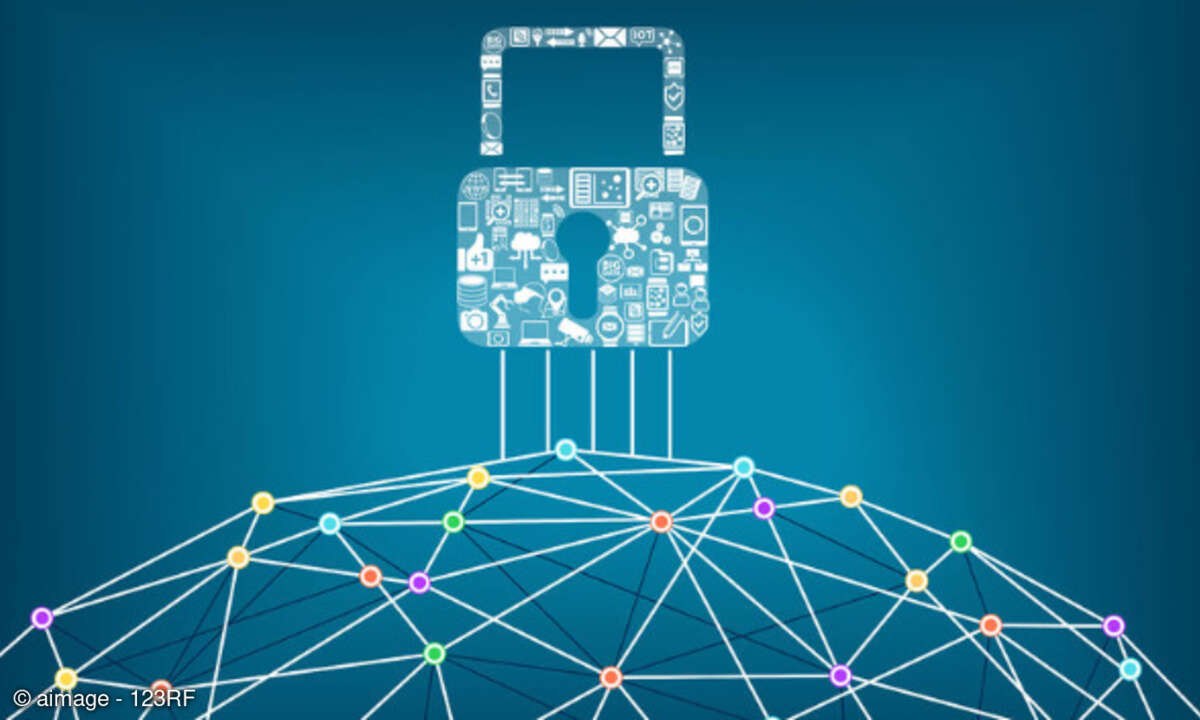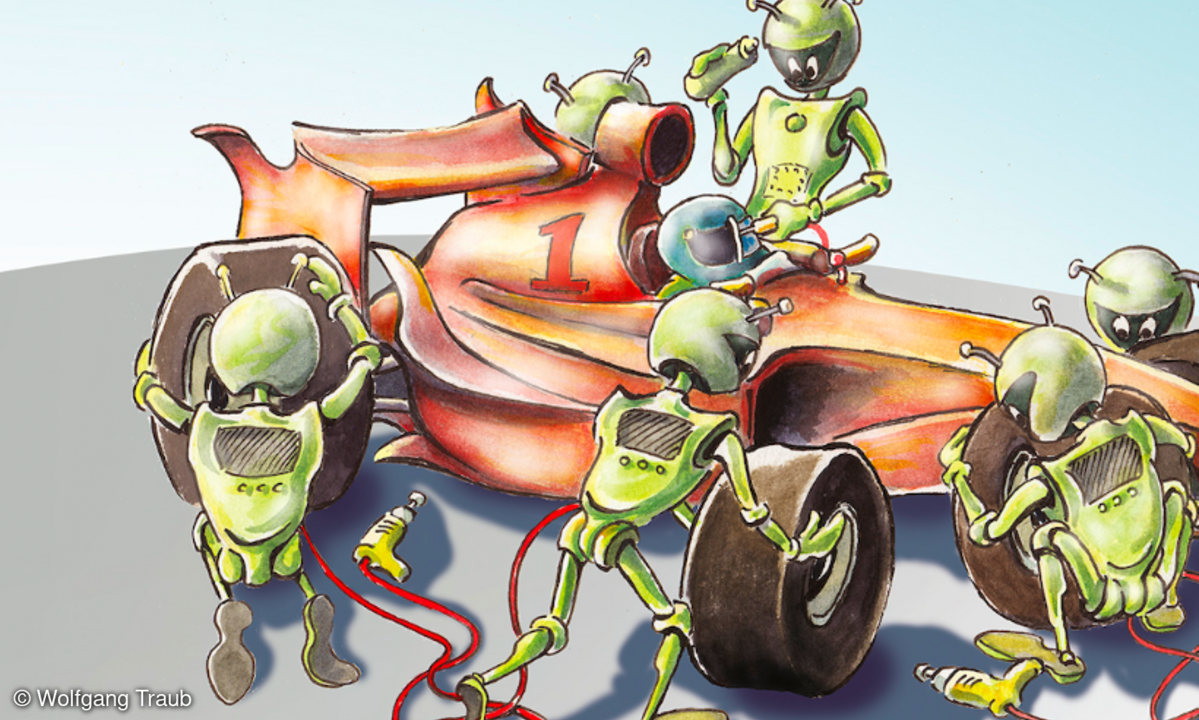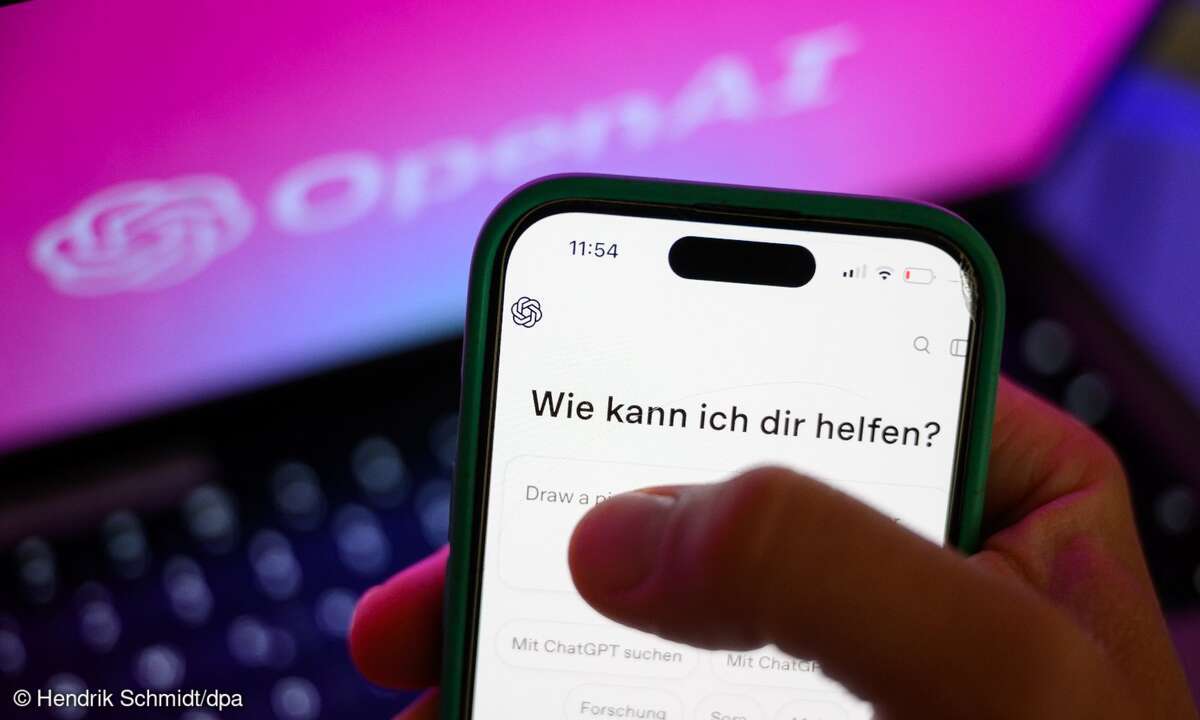Die Krise als Chance
Die Pandemie hat die Weltwirtschaft in ihren Grundfesten erschüttert – und die Folgen sind längst noch nicht absehbar. Obwohl nahezu alle Unternehmen und Branchen von der Krise betroffen sind, muss differenziert werden: drei Covid-19-Krisentypen im Vergleich.

- Die Krise als Chance
- Payback is King
Corona hat Firmen weltweit bis ins Mark getroffen: Planungen wurden quasi über Nacht über den Haufen geworfen. Für zahlreiche Unternehmen steht gar die Existenz auf dem Spiel. Eine V-Erholung der Wirtschaft wird es voraussichtlich nicht geben, denn sowohl die Kaufkraft der Konsumenten als auch die Investitionsbereitschaft befinden sich auf sehr niedrigem Niveau.
Gleichzeitig sind aber längst nicht alle Unternehmen von der Krise gebeutelt. Trotz Corona gibt es starke und stabile Player am Markt, die gut aufgestellt sind und den Fokus jetzt auf Wachstum und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle legen. Nichtsdestotrotz gehen rund 100 Experten bei der Befragung zu den Folgen der Pandemie davon aus, dass die Mehrheit der Unternehmen akut gefährdet sind. Grundlegend lassen sich aktuell drei Krisentypen für Unternehmen definieren, die sich hinsichtlich ihres finanziellen Spielraumes und ihrer unternehmerischen Handlungsfreiheit unterscheiden.
Cash is King
In diese Kategorie fallen Unternehmen, die aktuell ums blanke Überleben kämpfen. Oft waren sie bereits vor der Pandemie (finanziell) unter Druck, Corona war lediglich der Brandbeschleuniger für bereits schwelende Brände. Für diese Unternehmen stehen die Sicherung der Liquidität und damit auch der Existenz klar im Fokus. Sie befinden sich sozusagen im Emergency-Modus. Die Liquiditätssicherung kann hier auf drei Ebenen geschehen:
- Stärkung der Innenfinanzierungskraft, beispielsweise durch konsequentes Cost-Cutting, striktes Working-Capital-Management oder staatliche Unterstützung in Form von Steuerstundungen.
- Liquiditätsschöpfung durch bestehende Vermögenswerte, die eine bonitätsunabhängige Refinanzierung ermöglichen – etwa durch den Sale-and-Lease-Back bereits abbezahlter Maschinen oder Factoring.
- Finanzierung auf Basis der bestehenden Bonität beziehungsweise der zukünftigen Kapitaldienstfähigkeit über die eigene Hausbank oder Konsortialführer. Als einfachste Form sind hier Tilgungsstundung oder -aussetzung zu nennen. Weitere Möglichkeiten, um an „frisches Geld“ zu kommen, sind beispielsweise KfW-Kredite, Mezzanine oder Debt-Fonds – Letztere gehen allerdings mit deutlich höheren Kosten einher.
Für die kommenden Wochen und Monate gilt es, sich auf die Zeit nach dem Emergency-Modus einzustellen. Unter Leitung einer Corona-Taskforce, in deren Rahmen sich die Führungsriege eng abstimmt, sollten mögliche Ansätze vorgedacht und Szenarien entwickelt sowie durchgespielt werden. Wichtig dabei ist die konsequente Steuerung aller Schritte und die Überwachung ihrer Effektivität. Ein Redesign des eigenen Geschäftsmodells mit Fokus auf das Kerngeschäft, Investitionen in die digitale Infrastruktur unter Berücksichtigung des optimalen Paybacks und Maßnahmen zur Stärkung der Unternehmensresilienz sollten dabei im Fokus stehen.
In diesem Zusammenhang ist eine intakte 360-Grad-Kommunikation wichtig. Nicht nur, um interne Prozesse zu gestalten und Unsicherheiten innerhalb der Belegschaft entgegenzuwirken, sondern auch, um eine Informationsasymmetrie mit externen Stakeholdern wie Banken und Gewerkschaften zu vermeiden und das für alle Seiten beste Ergebnis zu erzielen. Sobald die Liquidität gesichert ist, gilt es, den Fokus auf eine nachhaltige Resilienz zu legen. Unternehmen müssen sich nun so aufstellen, dass weitere, zukünftig mögliche Rückschläge nicht direkt zum wirtschaftlichen Knock-out führen. Gelingt dies nicht, droht am Ende ein Sterben auf Raten. Es entstehen Zombie-Unternehmen.