Die Strategie entscheidet
Die Strategie entscheidet Auch heute noch haben viele Unternehmen keine Sourcing-Strategie, die diesen Namen verdient. Doch ohne sie kann man die unterschiedlichen Spielarten des Outsourcings nicht optimal nutzen. Schlimmer noch: Chaos droht.
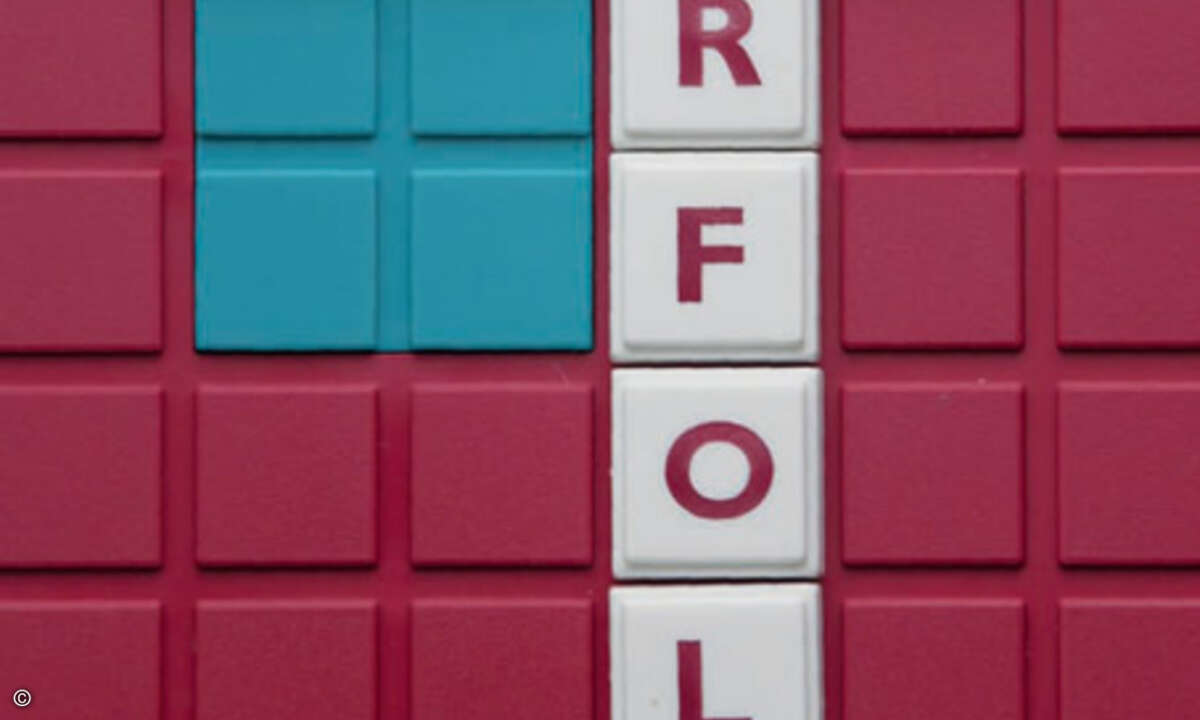
Das Auslagern von Teilen der IT an einen externen Partner hat sich in den letzten zehn Jahren stark entwickelt. Über die gemachten positiven und negativen Erfahrungen wird mittlerweile offen diskutiert. Das Verständnis dafür, dass es im Zusammenhang mit Sourcing nicht alleine um Kostenüberlegungen gehen kann, ist mittlerweile weitgehend vorhanden. Aber: Auch heute noch verfügen viele Unternehmen über keine Sourcing-Strategie, die diesen Namen verdient. Man beschränkt sich allzu oft auf ein paar taktische Überlegungen. Sourcing-Projekte betreffen nicht nur den Fachbereich wie beispielsweise die IT selbst, sondern beeinflussen auch direkt die Geschäftsentwicklung mehr oder weniger günstig. Deshalb ist es lohnend, eine dezidierte Sourcing-Strategie zu entwickeln, welche die Auswirkungen auf alle Unternehmensbereiche angemessen berücksichtigt.
Insourcing als Zwischenlösung Ein mögliches Szenario ist zunächst einmal das Insourcing in Form der Ausgründung des Informatikbereichs in eine »IT-GmbH« oder die Überführung von Konzernfunktionen wie Finanzen, Personal und Informatik in ein Shared Service Center (SSC). Wesentliches Merkmal bei beiden Ausprägungen des Insourcings ist nicht die bloße Zentralisierung, sondern die Umgestaltung der Fachbereiche in einen echten Dienstleister, wodurch eine Art Kunden-Lieferanten-Beziehung etabliert wird. Der Weg in eine »IT-GmbH« oder ein SSC ist für viele Unternehmen leichter zu realisieren als der Schritt hin zu einem Outsourcing. Risiken, beispielsweise im Zusammenhang mit einem Personalübergang, sind hier im Gegensatz zu einem Outsourcing in der Regel kleiner. Ein Insourcing kann im Rahmen einer Sourcing-Strategie durchaus eine Zwischenlösung darstellen, die zu einem späteren Zeitpunkt in ein IT-Outsourcing oder Business Process Outsourcing (BPO) überführt werden kann. Beim Auslagern an einen Dritten gibt es vier unterschiedliche Grade im Outsourcing: das umfassende Outsourcing, auch Full-Outsourcing genannt, das partielle beziehungsweise selektive Outsourcing, Managed Services und schließlich Outtasking. Sieht die Sourcing-Strategie vor, dass sich das Unternehmen konsequent auf seine Kernkompetenzen ausrichten will, so dürfte ein umfassendes Outsourcing die erste Wahl sein. Dabei kann es unter Umständen zu erhöhten Kosten in der IT kommen. Falls die positiven Auswirkungen auf die gesamte Geschäftsentwicklung diese Mehrkosten übersteigen, ist ein Full-IT-Outsourcing dennoch sinnvoll. Ein umfassendes Outsourcing muss dabei nicht bedeuten, dass alle Dienstleistungen von dem gleichen externen Partner erbracht werden. Für grössere Unternehmen lohnt es sich, zwei strategische Varianten zu berücksichtigen: »Best-of-breed« oder echtes Dual-Sourcing. Beim ersten Modell wählt man für verschiedene Services jeweils denjenigen Partner mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis. Bei einem echten Dual-Sourcing sorgt die Aufteilung des Leistungsumfangs auf gleichwertige externe Partner für Wettbewerb. Neben der Festlegung der IT-Architektur besteht die Hauptaufgabe der Informatikabteilung bei diesem Szenario in der kompetenten Steuerung der externen IT-Dienstleister. Bei der konkreten Umsetzung steckt der Teufel oft im Detail. Der Kunde ist gefordert, passende Standards auf allen Ebenen (Technologie, Prozesse, Reporting) zu formulieren und gegenüber den beiden IT-Dienstleistern auch durchzusetzen. Sonst droht das Outsourcing im Chaos zu versinken.
Minimierte Risiken – optimale Kostenreduktion Das partielle Outsourcing bietet die Möglichkeit, die Vorzüge einer internen Leistungserbringung mit dem Know-how eines externen Dienstleisters zu kombinieren. In der Regel werden echte »Commodities«, also Leistungen welche zwischen verschiedenen externen Partnern leicht austauschbar sind, an einen IT-Dienstleister vergeben. Sehr spezifische Services wie beispielsweise selbst entwickelte Applikationen verbleiben in der Regel intern. Das partielle Outsourcing ist aktuell die am weitesten verbreitete Form am Markt. Die Risiken sind kleiner, die Chancen einer Reversibilität (Backsourcing) grösser als bei einem umfassenden Outsourcing. Vor allem aber lassen sich die IT-Kosten – je nach Aufstellung des Unternehmens – optimal reduzieren. Genauso wie bei einem Full-Outsourcing gehört zu einem partiellen Outsourcing auch der Übergang von Personal, Assets und bestehenden Verträgen an einen externen Dienstleister. Das Übergabeprojekt, die sogenannte Transition, ist deshalb anspruchsvoll und bedarf meistens einer gezielten Überprüfung der beim Outsourcing-Angebot getroffenen Annahmen in Form einer Due Diligence. Das entsprechende Vorgehen ist mit der Akquisition eines Unternehmens vergleichbar: Dabei entfallen jedoch Stolpersteine wie die Bewertung der Aktien beziehungsweise Gesellschaftsanteile, der Goodwill sowie Risiken aus Altlasten.
Managed-Services – ständig sinkende Preise Zeigt sich bei der Ausarbeitung der Sourcing-Strategie, dass der Übergang von Personal und Assets zu erheblichen Nachteilen führen wird, sollte das Unternehmen die Alternative »Managed Services« in Betracht ziehen. Wurde in der Vergangenheit bereits ein partielles oder Full-IT-Outsourcing durchgeführt, dann handelt es sich bei der Vertragserneuerung beziehungsweise beim Wechsel zu einem anderen Partner faktisch ebenfalls um Managed Services. Weil dabei kein Personal und keine Assets übernommen werden, sind die Leistungen sehr leicht vergleichbar. Dies führt unter den Anbietern zu erhöhtem Preisdruck sowie zu einer fortschreitenden Industrialisierung der Dienstleistungen. Die Vertragslaufzeiten werden in der Folge immer noch kürzer, die Preise sinken konstant. Aufgrund solch offensichtlicher Vorteile neigen die Anwender-Unternehmen dazu, eine hohe Anzahl von externen Partnern für einzelne Aufgaben einzusetzen – und schaffen sich damit neue Probleme. Der Steuerungsaufwand (Provider Management) nimmt sehr stark zu und die Schnittstellen-Probleme zwischen den externen Partnern erhöhen neben den Kosten auch gleichzeitig die operativen Risiken. Und trotzdem gewinnen Managed Services immer mehr an Bedeutung. Der entscheidende Nachteil von Managed Services liegt aber darin, dass unternehmensintern andere Lösungen für die Mitarbeiter gefunden werden müssen. Ist dies nicht möglich, kommt es entweder zu Entlassungen oder zu erheblichen Mehrkosten aufgrund redundanter Personalkosten. Im Gegensatz dazu wird bei einem partiellen oder umfassenden Outsourcing die Verantwortung zur Sicherung der Weiterbeschäftigung der Mitarbeiter an den externen Partner übertragen. Entsprechende Beschäftigungsgarantien liegen in Deutschland häufig bei 24 Monaten – je nach Marktsituation schwankt dieser Wert aber. Der deutsche Gesetzgeber hat nicht nur für den Betriebsübergang nach Art. 613a BGB sondern auch im Rahmen des Gesetzes über den Datenschutz Vorschriften erlassen, die bei der Entwicklung einer Sourcing-Strategie berücksichtigt werden müssen. Dies gilt speziell für Versicherungsgesellschaften, die Dienstleistungen im Bereich der Sozialversicherungen anbieten. Die rechtlichen Risiken stellen nicht in jedem Fall zwingend ein Hindernis dar, sind aber notwendigerweise Gegenstand bei der Entwicklung der Sourcing-Strategie.
Kommunikationsplan einhalten Egal für welche Variante sich ein Unternehmen auch entscheidet, für jedes Szenario muss jeweils eine konkrete Lösung für die Mitarbeiter gefunden und ein Konzept für das Provider Management entwickelt werden. Dabei gilt es die entsprechenden Kosten und Risiken zu beschreiben. Zu einer erfolgreichen Sourcing-Strategie gehört immer auch ein Kommunikationsplan. Der Umgang mit den von einer Auslagerung betroffenen Mitarbeiter verlangt Fingerspitzengefühl und angemessene Information in allen Phasen des Projekts. Andernfalls ergeben sich unter anderem durch die Kündigung von Schlüsselpersonen Sachzwänge beziehungsweise Engpässe, die nicht nur das Outsourcing-Projekt an sich, sondern auch den IT-Bereich als Ganzes in eine kritische Situation bringen können.
Stefan Regniet, CEO von Active Sourcing





