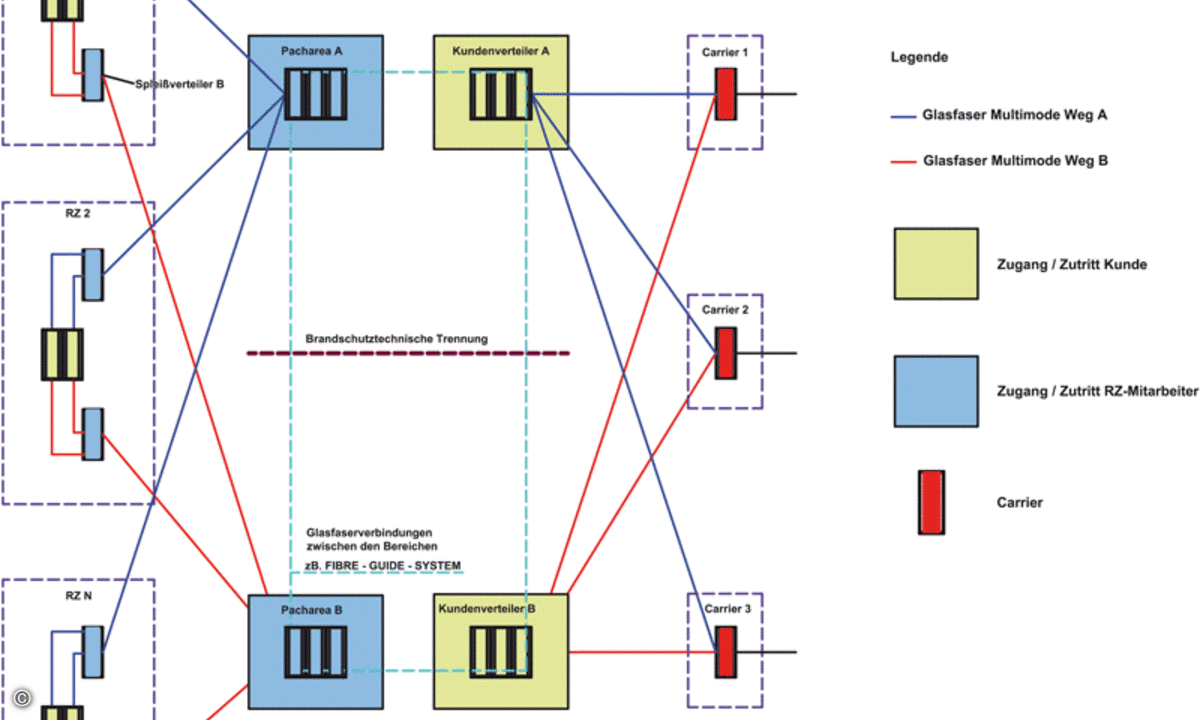Dreisprung zur optimierten Wertschöpfungstiefe
Dreisprung zur optimierten Wertschöpfungstiefe Wer akzeptierte Argumente für oder gegen das Auslagern von Teilen der IT benötigt, braucht Transparenz und konsensual vereinbarte Bewertungskriterien.

- Dreisprung zur optimierten Wertschöpfungstiefe
- Klare Leistungs- und Produktabgrenzung
- Identifikation der richtigen Bewertungskriterien
Kann eine Positionierung der internen IT als Full-Service-Dienstleister heute noch Wettbewerbsvorteile bringen? Ist eine Full-Service-Positionierung im Vergleich zum externen Markt wirtschaftlich vertretbar und strategisch zielführend? Wie häufig ist die aktuelle Sourcingstrategie eines IT-Dienstleisters zu hinterfragen und wie sieht ein solches Vorgehen aus? Das sind Fragen, denen sich die Leiter von konzerneigenen IT-Abteilungen beziehungsweise von konzerneigenen IT-Systemhäusern regelmäßig stellen (müssten). Diese Fragestellungen betreffen vor allem die, die als Full-Service-Anbieter innerhalb eines Konzerns agieren. Natürlich ist es komfortabel, alle Leistungen im eigenen Hause zu wissen, allerdings lässt sich dieser Komfort im heutigen Wettbewerbsumfeld kaum noch sicherstellen. Nicht nur durch die regelmäßigen Akquisetermine der großen Outsourcinganbieter wie IBM, EDS, Atos, TSI, BT et cetera werden diese selbstzweiflerischen Punkte zur »richtigen« Sourcingstrategie aufgeworfen. Oftmals stellen auch die CIOs oder CFOs die unangenehmen Fragen zur aktuellen und zukünftigen Ausrichtung des IT-Dienstleisters hinsichtlich des Produkt- und Leistungsspektrums sowie der damit einhergehenden Wertschöpfungstiefe. Um diesen Fragen jederzeit, kompetent, umfänglich und selbstbewusst beantworten zu können, muss Transparenz geschaffen werden – und zwar vor allem in quantitativer Hinsicht. Qualitativ und rein strategisch dominierte Diskussionen helfen hier kaum weiter. Gestartet wird dabei mit einem grundlegenden und Produktsparten übergreifenden Projekt zur Analyse der Wertschöpfungstiefe. Um aber auch zukünftig Fragen nach der Adäquatheit der Wertschöpfungstiefe Dritten – aber auch sich selbst – beantworten zu können und um nicht immer von vorne anzufangen, müssen die Verantwortlichen der IT-Organisationen Regelprozesse zum Review der aktuellen Sourcingsstrategie etablieren. Der Markt unterstützt den Trend zur Überprüfung der Sourcingstrategie. Etablierte Outsourcer und somit Wettbewerber der internen Konzern-IT, sourcen zu Tiefstpreisen. Auch Kunden erwarten die Realisierung von (Prozess-)Kostenvorteilen durch die IT. Schließlich hört man ja überall, dass die IT dauernd günstiger wird. Zudem erhalten die Konzerntöchter zunehmend die Möglichkeit der freien Anbieterwahl. Das Spannungsfeld ist weit und schwierig. Der Bedarf zur Schaffung interner Transparenz und die Notwendigkeit der Identifikation von Effizienzpotenzialen, um in diesem Spannungsfeld zu bestehen, steigt stetig. Ein aktuelles Benchmarking unter konzerngebundenen IT-Gesellschaften zeigte bereits einen zunehmenden Verlagerungstrend. Insbesondere im Bereich der Services (User Help Desk & Desktop Service) als auch im Infrastrukturbereich konnten Outsourcingquoten zwischen zehn und 16 Prozent identifiziert werden (Quelle: SMP Benchmarking). In der Regel stehen natürlich die »Commodity-Leistungen« im Fokus der Sourcing-Analyse. Die Ziele einer eingehenden Analyse der eigenen Wertschöpfungstiefe lassen sich wie folgt zusammenfassen:
– Identifikation der eigenen Kernkompetenzen vor dem Hintergrund strategischer Ziele
– Ermittlung von Einheiten, die sich zum Auslagern eignen, zur Verschlankung der eigenen Leistungserbringung und Realisierung von Kostensenkungspotenzialen
– Schaffung eines wettbewerbs- und marktfähigen Leistungsportfolios
– Optimale Allokation von Kapazitäten und Ressourcen
– Eingrenzung von Leistungen und Produkten, die im Rahmen einer Make-or-Buy-Entscheidung detailliert zu kalkulieren und gegebenenfalls auszuschreiben sind.
Offen bleibt, in welcher Form sich die Wertschöpfungstiefe am effektivsten prüfen und bewerten lässt. In der Praxis hat sich ein dreistufiges Vorgehen zur Überprüfung der Wertschöpfungstiefe als pragmatisch herausgestellt (siehe Abbildung oben). Die Überprüfung der eigenen Wertschöpfungstiefe erfordert zunächst eine Bewertung der aktuellen Leistungstiefe. Konnten die bestehenden Leistungen und Produkte (sowohl im Anwendungs-, als auch Infrastruktur- und Servicebereich) abgegrenzt, bewertet und die weiterhin zu prüfenden Leistungen und Produkte (solche mit geringer interner Produktattraktivität aber hoher Kundenrelevanz) identifiziert werden, erfolgt die Konzeption der zukünftigen Wertschöpfungstiefe. Ergebnis der zweiten Phase ist die Identifikation und Priorisierung von Leistungen, die im Sourcingprozess einen weiteren Schritt Richtung Outsourcing nehmen werden. Abschließend werden die identifizierten und detaillierten Maßnahmen je Leistung umgesetzt (das heißt Leistungsbereiche werden optimiert, Leistungen ausgeschrieben, Verträge abgeschlossen) und ein Regelprozess für die regelmäßige Überprüfung der Wertschöpfungstiefe aufgesetzt. Ergebnis der ersten Phase ist die Schaffung von Transparenz sowie die Bewertung der aktuellen Leistungstiefe. Diese Bewertung lässt sich in Form eines Scorings durchführen und graphisch abbilden. Drei wesentliche Erfolgsfaktoren gilt es dabei zwingend zu berücksichtigen:
1. Sicherstellung einer eindeutigen und von der Organisation mitgetragenen Leistungs- und Produktabgrenzung
2. Identifikation adäquater Bewertungskriterien
3. Nachvollziehbare Leistungsbewertung und plausible Ergebnisüberführung in Sourcing-Matrix.