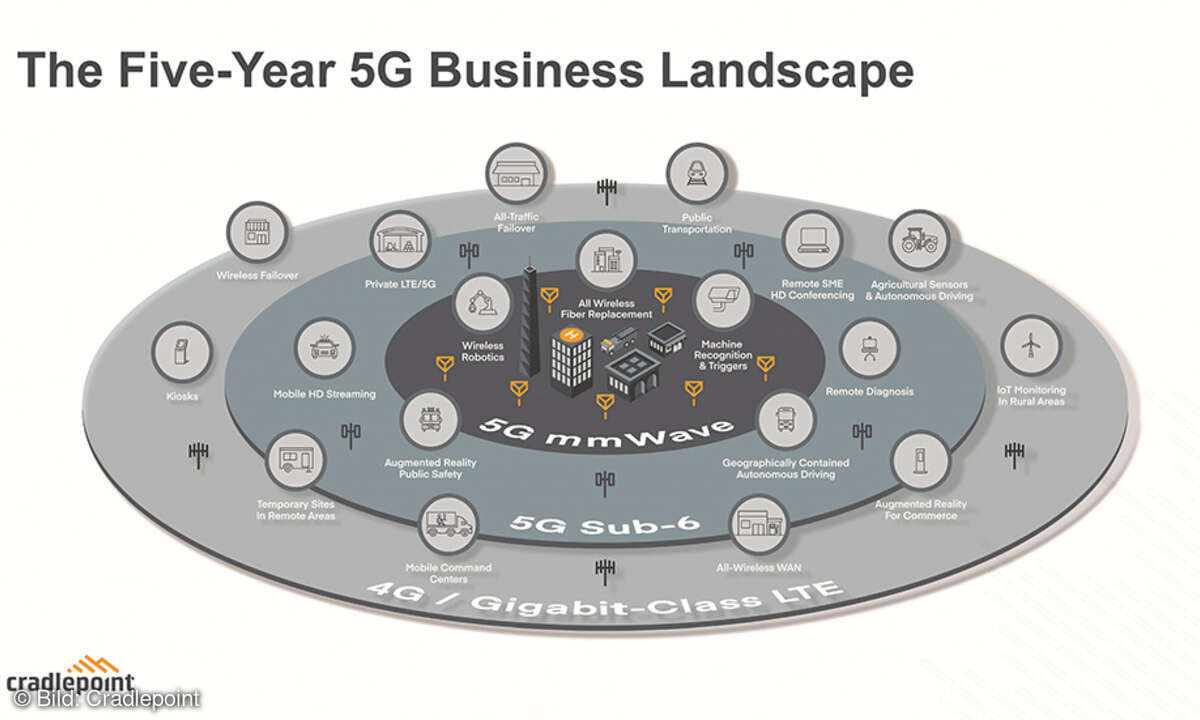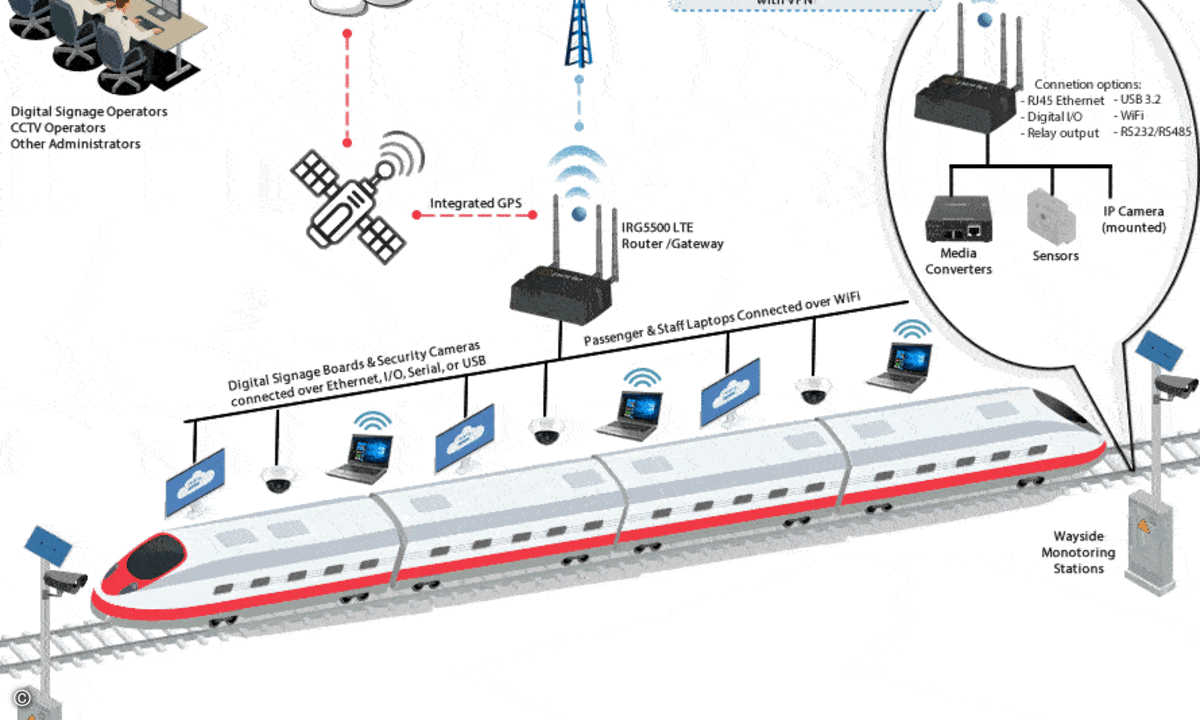Ein intelligenter Ansatz zur Bereitstellung von LTE-Netzwerken
LTE markiert den Beginn einer neuen Ära, die Mobilfunkbetreibern deutlich höhere Datenraten und geringere Latenzzeiten beschert, damit diese noch mehr Funktionen und höherwertige Dienste unterstützen können. Gleichzeitig müssen sie aber die dazu erforderliche Netzwerk-Infrastruktur zur Verfügung stellen, die diese Dienste unterstützt – und das zu möglichst geringen Kosten.
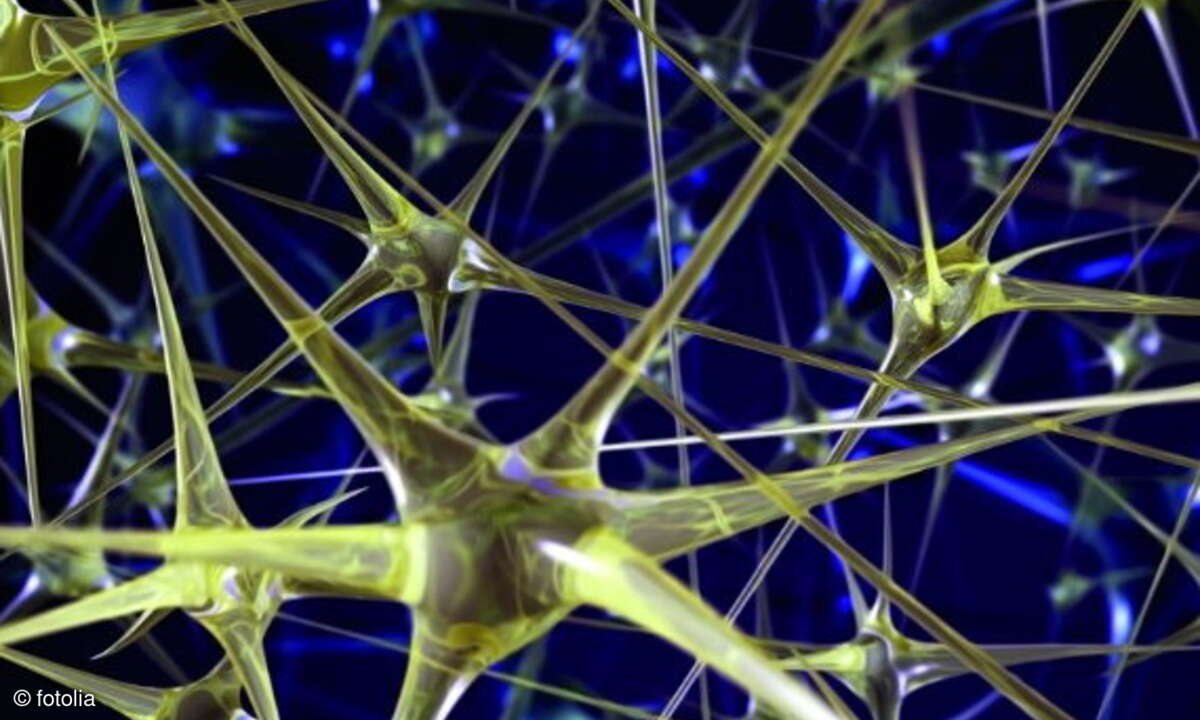
- Ein intelligenter Ansatz zur Bereitstellung von LTE-Netzwerken
- Network-Intelligence
- Fazit
- Expertenkommentar Empirix zur Qualitätssicherung
Long-Term-Evolution (LTE) bietet Mobilfunkanbietern die Vorteile einer reinen paketvermittelnden Infrastruktur (IP-Protokoll), was vorher ein Privileg der Festnetz-Anbieter war. Das heißt, in Zukunft können Mobilfunk- und Festnetze auf einer gemeinsamen Transport- und Dienstebene konvergieren. Durch den Übergang auf eine IP-basierte Technik können Mobilfunkanbieter ihren Netzwerksupport und ihr Dienste-Angebot ausweiten und dabei die Betriebs- und Investitionskosten senken. Doch die Notwendigkeit, dass LTE erstens verschiedene Service-Klassen – anstelle einer einzigen – unterstützt, zweitens interoperabel zu bestehender Netzwerktechnik (2G, 2.5G, 3G) ist und drittens erheblich mehr Datenverkehr bewältigen muss, führt zu einer erheblichen Belastung der verfügbaren Ressourcen. Damit die Anbieter erfolgreich eine hohe Qualität und interessante LTE-Dienste kosteneffizient bereitstellen können, muss eine Reihe technischer und netzwerkbezogener Herausforderungen bewältigt werden.
Maximale Rendite bei der Investition in LTE
Wenn Mobilfunkanbieter die Früchte ihres LTE-Engagements ernten wollen, müssen sie durch den Einsatz der IP-Technik ihre Leistungen und Anwendungen profitabel bereitstellen. Der Kunde verlangt stets einen günstigeren und besseren Service als ihn der Mitbewerber bieten kann. Dazu müssen die Daten, die innerhalb des Netzwerks bestehen, besser genutzt werden. Diese Daten können folgenden Zwecken dienen:
1. Der Betreiber kann Ereignisse auf Netzwerk- und Service-Ebene mit seinen Geschäftszielen – mehr Umsatz, bessere Servicequalität, weniger Kundenabwanderung – korrelieren.
2. Der Betreiber erhält die Möglichkeit, umsatz- und kostenbedingte Aspekte beziehungsweise Probleme zu erkennen und zu lösen. Betreiber müssen feststellen können, wie ihre Netzwerkressourcen genau genutzt werden, damit diese mit maximaler Effizienz ausgelastet werden können. Außerdem müssen sie das Benutzererlebnis ihrer Dienste evaluieren können. So sollten zum Beispiel Unzufriedenheiten bei Abrechnung, Zahlung, Kreditoptionen, Handyauswahl, Service-Funktionen, Angebotsoptionen, Netzqualität etc., ausfindig gemacht werden. Sie müssen Zugriff auf anspruchsvolle Überwachungs-/Managementlösungen haben, die wertvolle Daten aus dem Netz ziehen können. Diese Daten und deren Zusammenhänge müssen untersuchbar sein und zur Weiterverarbeitung und Überprüfung durch andere Abteilungen des Netzbetreibers zur Verfügung stehen. Nur so lassen sich strategische Entscheidungen treffen und Probleme lösen. Dies lässt sich durch die Implementierung von „Network Intelligence“ realisieren.