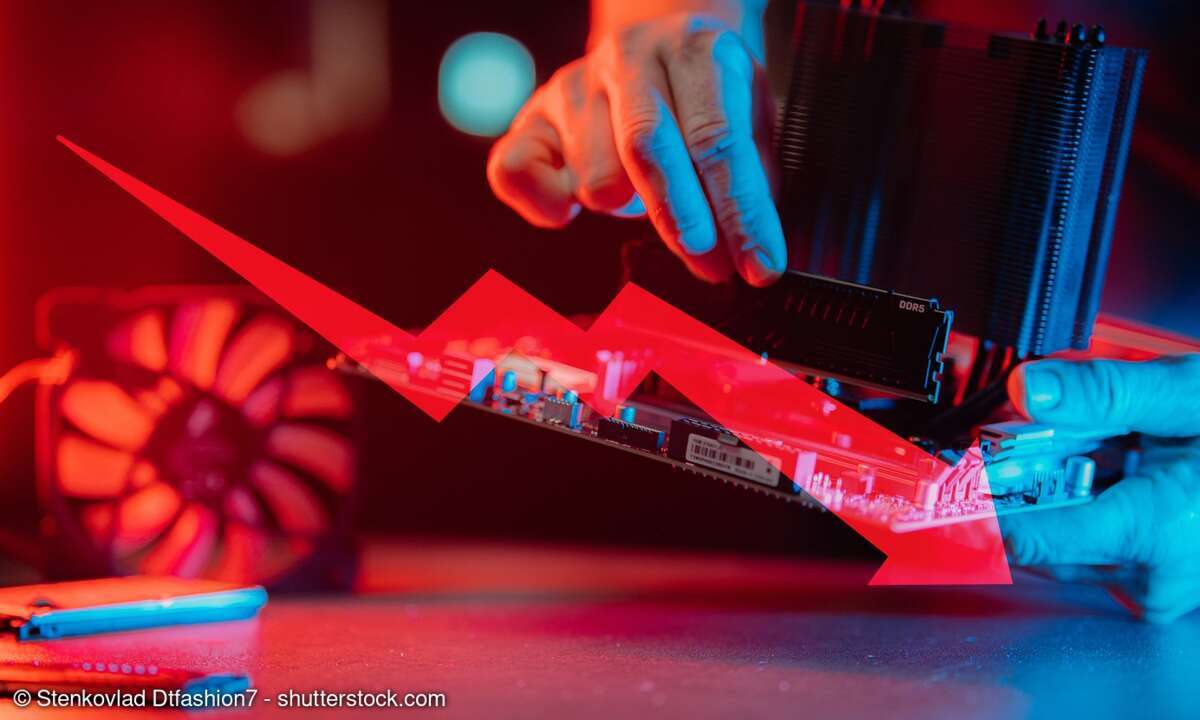ERP im Aufwind ? dem Mittelstand sei Dank
ERP im Aufwind ? dem Mittelstand sei Dank. Der Mittelstand ist nicht nur der Motor der deutschen Wirtschaft, sondern belebt auch das ERP-Geschäft. Das traditionell von mittelständischen ERP-Anbietern bestimmte Segment hat sich zu einem heiß umkämpften Markt entwickelt. Stagnierende Umsatzzahlen im Großkundengeschäft und positive Wachstumsprognosen locken große Software-Unternehmen wie SAP und Microsoft vor allem in das untere Segment.
ERP im Aufwind ? dem Mittelstand sei Dank
Autorin: Karena Friedrich
Der ERP-Markt in Deutschland wächst. Marktforscher von Pierre Audoin Consultants (PAC) rechnen für 2006 mit einer Steigerung von rund 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das erwartete Lizenz- und Wartungs-Volumen beträgt demnach über zwei Milliarden Dollar. Überdurchschnittlich hohen Anteil am Wachstum hätten dabei kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu 1.000 Mitarbeitern. Die Umsätze mit Konzernen entwickeln sich dagegen unterdurchschnittlich. Dieses Segment ist nach wie vor in der Hand des Software-Giganten SAP, der laut PAC-Analysten einen Marktanteil von 77 Prozent vorweisen kann. Das Mittelstands-Segment ist dagegen weitaus zersplitterter und heiß umkämpft. Vor dem Hintergrund der positiven Wachstumsprognosen drängen neben SAP auch die großen Software-Anbieter wie Microsoft und Oracle verstärkt in den mittelständischen ERP-Markt. SAP-Vorstandssprecher Henning Kagermann beispielsweise kündigte auf der Cebit an, den Anteil des Mittelstandsgeschäfts am Lizenzumsatz bis 2010 auf 40 bis 45 Prozent steigern zu wollen. Zum Vergleich: Derzeit liegt er noch bei 31 Prozent.
Ein wichtiger Grund für die steigenden IT-Ausgaben im Mittelstand ist in der zunehmenden Internationalität und Komplexität der Geschäftsprozesse zu sehen. Viele Firmen haben alte Systeme in Betrieb, die den erweiterten Anforderungen nicht mehr gerecht werden. Vor allem Unternehmen in der Fertigungs- und Prozessindustrie müssen verstärkt ihre externen Standorte in das zentrale IT-System integrieren. Trotz der erwarteten Wachstumsraten ist das Mittelstandsgeschäft vor allem ein Verdrängungswettbewerb. Allerdings behaupten sich auch kleinere Anbieter wie SoftM, Semiramis oder Godesys. Gegenüber der Markenstärke und Investitionssicherheit der Großen verfügen die Kleinen über eine mittelstandsgerechte Branchenexpertise und etablierte Netzwerke regionaler Partner. Sie punkten vor allem mit individueller Kundenansprache und anforderungsgerechten Branchenlösungen. Gerade für mittelständische und kleine Unternehmen sind diese Faktoren kaufentscheidend. Nach wie vor sind hier Partner gefragt, die meist auf der Basis von Standardprodukten eigene Branchenlösungen anbieten oder entsprechende Anpassungen vornehmen. Aufgrund ihrer Größe können kleinere Software-Anbieter zudem flexibler und gezielter in speziellen Marktsegmenten agieren als große Hersteller.
Manch einer der großen Wettbewerber kämpft zudem mit hausgemachten Problemen, wie beispielsweise Oracle mit der Reorganisation nach diversen Zukäufen. Der Hersteller hatte sich mit der Übernahme von Peoplesoft auch eine ERP-Lösung für den Mittelstand ins Portfolio geholt, die seit einiger Zeit über den Channel vertrieben wird. »Großes Wachstum im Mittelstand ist hier allerdings nicht zu erwarten«, prognostiziert Christian Glas, Senior Consultant bei PAC. Es gäbe für »Enterprise One« zwar einen stabilen Kundenstamm, allerdings kaum Neukundengeschäft. Oracle hatte zwar angekündigt, sich verstärkt im Mittelstand zu engagieren, doch konzentriere sich das Unternehmen im Augenblick primär auf Großkunden, so Glas. Es bleibt abzuwarten, ob Oracle sein Mittelstandsgeschäft später noch in Schwung bringen kann.
SAP und Microsoft lassen sich dagegen einiges einfallen, um mittelständische Kunden von ihren Lösungen zu überzeugen und ihre Marktanteile in diesem Segment zu vergrößern. So hat Microsoft beispielsweise mit der virtuellen Referenzfirma »Contoso« ein Verkaufs- und Beratungs-Tool für Partner entwickelt, das idealtypische Geschäftsabläufe eines mittelständischen Unternehmens zeigt. »Contoso« simuliert die Verzahnung einzelner Betriebsprozesse, die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern oder die Einbindung von Kunden und Lieferanten in ein Unternehmen. Der Konzern reagiert damit auch auf die Anforderungen vieler Kunden an ein ERP-System, nicht mehr nur die Unternehmensprozesse abzubilden, sondern auch ihr IT-System mit denen ihrer Kunden und Partner zu verknüpfen.
Im Mittelstand sind die finanziellen und personellen Ressourcen allerdings begrenzt, IT-Investitionen werden kritisch durchdacht und ausgewählt. Aufgrund der schwierigen Finanzierungssituation, besonders im Hinblick auf gesetzliche Vorschriften wie Basel II, entscheiden sich viele Unternehmen zunächst gegen die Einführung eines ERP-Systems. SAP versucht mit einem auf der Cebit vorgestellten Finanzierungsprogramm, diese Investitionshemmschwelle abzubauen. Die Walldorfer bieten ihren Kunden, gemeinsam mit Siemens Financial Services (SFS), nach eigenen Angaben einfache und erschwingliche Finanzierung für SAP-Lösungen an. Unter dem Namen »SAP Financing« sollen die Finanzierungslösungen auf die individuellen Liquiditätsanforderungen der Kunden zugeschnitten werden. Das Programm deckt dabei sämtliche Kosten einer SAP-Lösung ab, von der Software über Hardware bis hin zu Implementierungs- und Wartungskosten. Das Finanzierungsangebot soll die Budgetplanung vereinfachen und Unternehmen einen besseren Überblick über die Gesamtkosten und die Investitionsrendite geben. Das Angebot wird über Reseller und Systemintegratoren vertrieben, die mithilfe eines »Investment Calculators« Finanzierungsangebote ohne externe Finanzexperten schnell und einfach kalkulieren können. Auch viele mittelständische Anbieter wie beispielsweise Myfactory oder Softengine bieten ihren Kunden verschiedene Finanzierungsmodelle an.
Eine ebenfalls für Partner interessante Strategie im Großkundengeschäft haben sowohl Microsoft als auch SAP eingeschlagen. Mit den eigentlich für den unteren Mittelstand gedachten Lösungen »Microsoft Dynamics AX« und »SAP Business One« (SBO) richten sich die Unternehmen an die Niederlassungen und Tochtergesellschaften von Konzernen. Bei Microsoft laufen unter der »Hub & Spoke« genannten Strategie immerhin 25 Prozent aller Installationen von Microsoft Dynamics, wie Robert Helgerth, Direktor des Mittelstandsgeschäfts bei Microsoft, auf der Cebit verkündete. Häufig haben Konzerne große ERP-Lösungen im Einsatz, wählen für die Niederlassungen aber eine kleine Mittelstandslösung. Ebenfalls auf der Cebit verkündete SAP 79 neue Kunden, die SBO über die SAP-Netweaver-Plattform in ihre bereits bestehende SAP-Landschaft integriert haben. Beide Unternehmen betonten die Zusammenarbeit mit den Partnern vor Ort, ohne deren Branchenexpertise das Geschäft auch in Zukunft nicht zu erobern sein wird.
Interview
»Der Mittelstand diktiert die Strategie«
Hoffnungsvolle Wachstumsprognosen für das ERP-Geschäft gibt es vor allem für das Segment der kleinen und mittleren Mittelständler. Um diesen Markt erfolgreich anzugehen, haben sich viele Hersteller nach Branchen aufgestellt. Reinhold Karner, Gründer und CEO vom ERP-Anbieter Semiramis, sprach mit CRN-Redakteurin Karena Friedrich über die vielzitierte Branchenorientierung im Mittelstand.
CRN: Herr Karner, Sie haben vor kurzem einmal gesagt, hinter der so genannten Branchenorientierung im ERP-Geschäft stecke mehr Marketing als technologische Notwendigkeit.
Karner: Es ist beides. In gewisser Weise diktiert der Mittelstand tatsächlich die aktuelle Marketing-Strategie im ERP-Geschäft. Gerade die kleineren Unternehmen, die oft stark spezialisiert sind, legen großen Wert auf anforderungsgerechte Betreuung. Auch wenn sich die Prozesse oft branchenübergreifend ähneln oder sogar identisch sind, verlangt der Kunde nach »seiner« Branchenlösung. Er sortiert daher oft die Angebote aus, die zwar nicht ausdrücklich als branchenspezifisch deklariert sind, aber dennoch die geforderten Prozesse abbilden könnten. Die Hersteller reagieren darauf, indem sie ein Produkt einer bestimmten Branche zuordnen, auch wenn es noch viele andere abdecken könnte. Das machen wir übrigens auch so.
CRN: Also alles Etikettenschwindel?
Karner: Nein, es gibt tatsächlich viele Branchen, deren Prozesse man ohne spezielle Branchenfunktionalitäten nicht abbilden kann. Wenn man aber ein Produkt clever baut, dann kann man auch mit einer Standard-Lösung bereits 50 Prozent aller Branchen abdecken. Da geht es dann meistens nur noch um Customizing.
CRN: Was haben die nicht so Cleveren denn falsch gemacht, wenn sie verstärkt auf zusätzliche Branchenlösungen angewiesen sind?
Karner: Fairerweise muss man sagen, dass viele ERP-Lösungen schon fünfzehn bis zwanzig Jahre alt sind. Die haben vielleicht in einer Branche angefangen und allmählich eine Standard-Lösung entwickelt, ohne die Anforderungen von anderen Branchen zu kennen. Im Nachhinein ist es natürlich schwieriger geworden, weitere Funktionalitäten hinzuzufügen, weil diese oft tief im Kern der Lösung stecken.
CRN: Also sind die Newcomer im Vorteil?
Karner: Wir sind beispielsweise mit unserer Lösung Semiramis echte Newcomer, verfügen aber gleichzeitig über zwanzig Jahre Erfahrung durch Entwicklung und Marktbeobachtung. Wir hatten einfach die Chance, mit eben diesen Erfahrungen quasi auf der »grünen Wiese« neu zu beginnen. Und das offensichtlich zu einem guten Zeitpunkt, denn unsere Visionen von Webservices, Workflow- und Prozessorientierung kamen parallel auch im Markt auf.