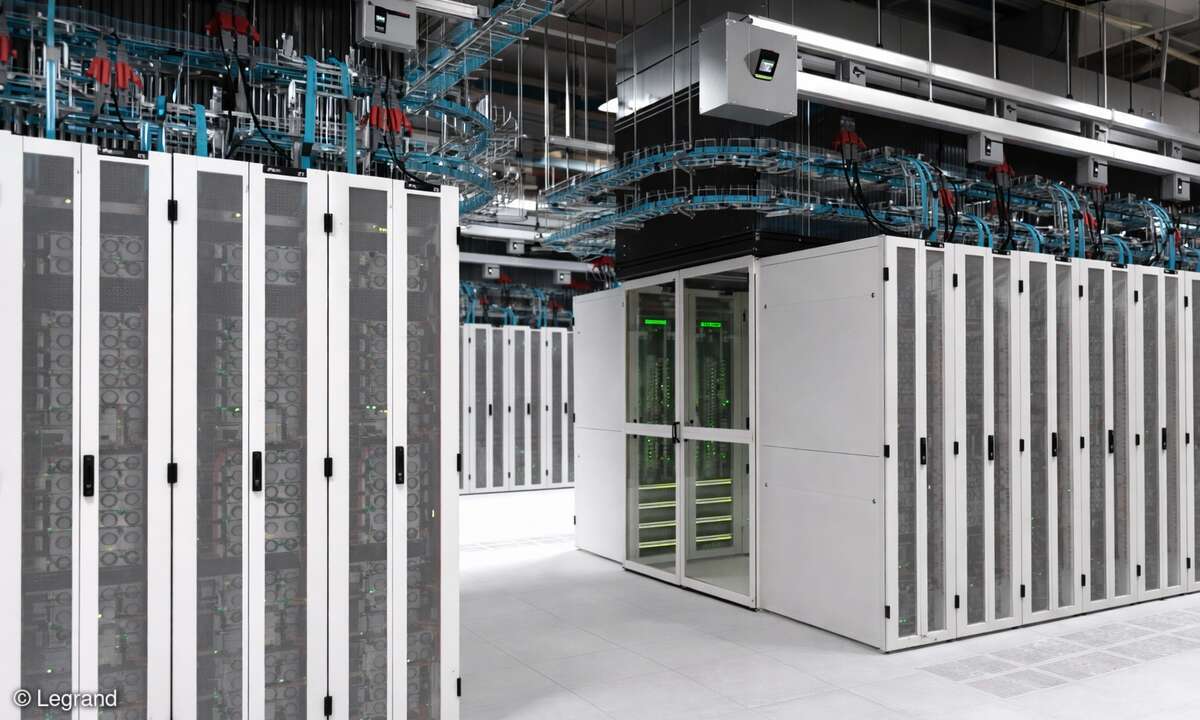Leben mit dem Outsourcing-Partner (Fortsetzung)
- Leben mit dem Outsourcing-Partner
- Leben mit dem Outsourcing-Partner (Fortsetzung)
- Leben mit dem Outsourcing-Partner (Fortsetzung)
Akzeptanz erarbeiten
Ein Beispiel betrifft die Ausfallsicherheit des Netzwerks. Wenn ein SLA die durchschnittliche Verfügbarkeit des Netzwerks zu 99,9 Prozent garantiert, klingt das zunächst einmal gut. Dennoch können regelmäßige Ausfälle schon im Millisekundenbereich den Abbruch des Transfers von Luft- und Raumfahrtdaten nach sich ziehen. Ein Dienstleister, der sich in einem solchen Fall auf die vertragliche Regelung bezieht, wird naturgemäß Akzeptanzprobleme haben. Im DLR werden deshalb regelmäßig Befragungen zur Messung der Nutzerzufriedenheit durchgeführt. Ein weiterer Baustein zur Ermittlung der vom Anwender erlebten Servicequalität ist das engmaschige End-to-End-Monitoring aller Services.
Ein weiteres Beispiel: Das Einspielen von Software-Patches und Updates, die nicht zu Serviceunterbrechungen führen steht dem ICT-Dienstleister laut Vertrag jederzeit frei. Würden jedoch durch die unvermeidbaren Restrisiken dabei wichtige Events (Start eines Satelliten, Präsentation im Bundesministerium etc.) gefährdet, so wäre der Imageschaden kaum zu beziffern. In der Praxis sprechen sich deshalb das DLR und T-Systems mit Hilfe eines Event-Kalenders über jeden Wartungsschritt frühzeitig ab. Nahezu kostenfrei wird hierdurch die Servicequalität für den Anwender noch einmal deutlich erhöht.
Im Gegenzug erhält der Dienstleister zusätzliche Wartungszeiten, wenn dies zur Langzeitstabilität der Systeme oder im akuten Krisenfall notwendig wird.
Die wohl wichtigste Domäne der Zusammenarbeit zwischen zentraler IT-Abteilung und Outsourcingpartner ist der nach ITIL vorgesehene Change Management Prozess. Er beschreibt das Vorgehen bei Erweiterungen und Modifikationen von Services im Zuge von Optimierungen und sich ändernden Anforderungen aus dem Tagesgeschäft.
In der Regel reicht dabei ein örtlicher IT-Manager eine entsprechende Anfrage beim Standortmanager ein und dieser gibt sie an den CIO weiter. Nach Diskussion im zentralen IT-Gremium erfolgt die Bearbeitung im so genannten Change Advisory Board und die Abstimmung mit den jeweils betroffenen fachlichen Stabsstellen, dem Operations Manager des IT-Dienstleisters sowie den jeweiligen Kundenbetreuern. Im Service-Gespräch klären die Beteiligten fachliche, organisatorische, budgetäre und sicherheitsspezifische Fragen. Erst danach erfolgt der Auftrag zur Implementierung des jeweiligen Dienstes. Insgesamt erfolgen die Freigabeprozesse aber nicht streng linear. Häufig sind mehrfache Durchläufe notwendig, in denen die Mitarbeiter abgelehnte Details wieder neu diskutieren müssen.
Information ist alles
Bei der letztendlichen Implementierung ist entscheidend, dass die Kommunikation der geplanten Änderungsschritte an die Anwender entsprechende Aufmerksamkeit erhält und schon vor dem eigentlichen IT-Prozess startet. Gerade bei einem Rollout neuer Software müssen sowohl Inhalte als auch Art und Weise der Kommunikation in dedizierten Agendapunkten der Change-Management-Meetings festgeschrieben sein. Wann werden welche Nutzer in welcher Form mit welchen Informationen versorgt? Hierbei müssen Formulierungen von E-Mails und Internetseiten genau auf ihre Verständnisfähigkeit geprüft werden. Das IT-Management informiert die betroffenen Nutzer genau, welche Veränderungen erfolgen und in welchem Zeitraum die Arbeiten stattfinden. Nur durch rechtzeitige und klare Information lässt sich die notwendige Akzeptanz bei den Anwendern gewinnen.
Prof. Dr. Hans-Joachim Popp, IT-Manager und Chief Information Officer, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Köln