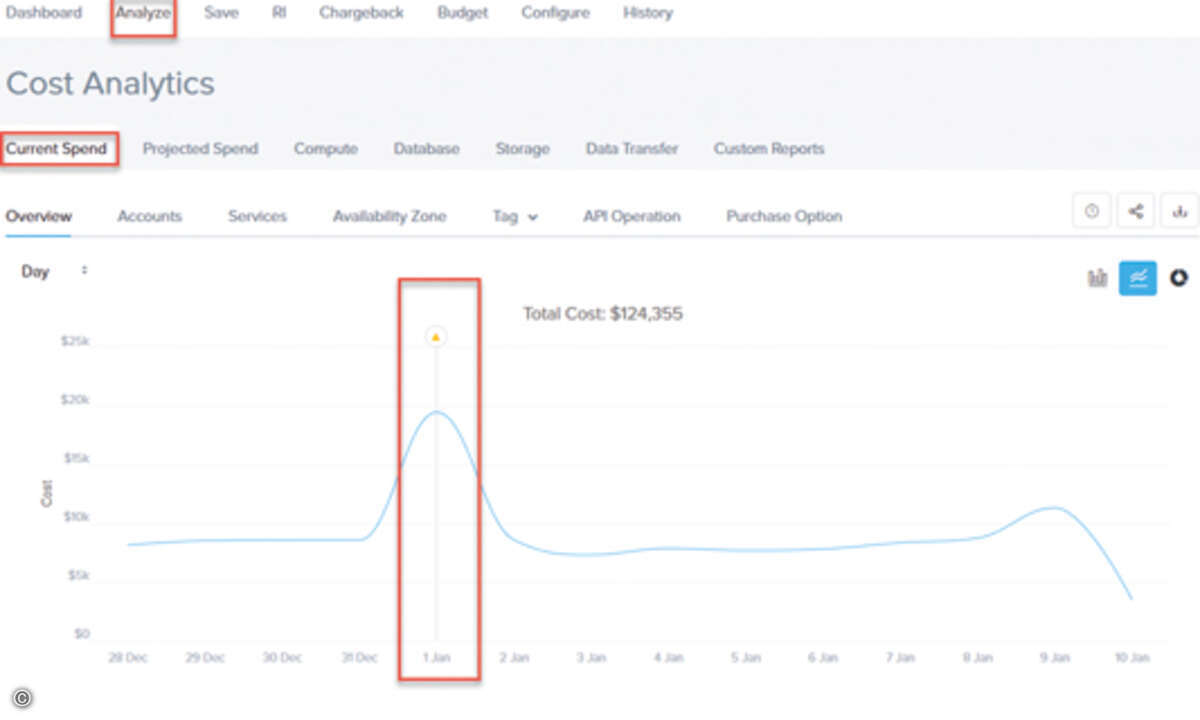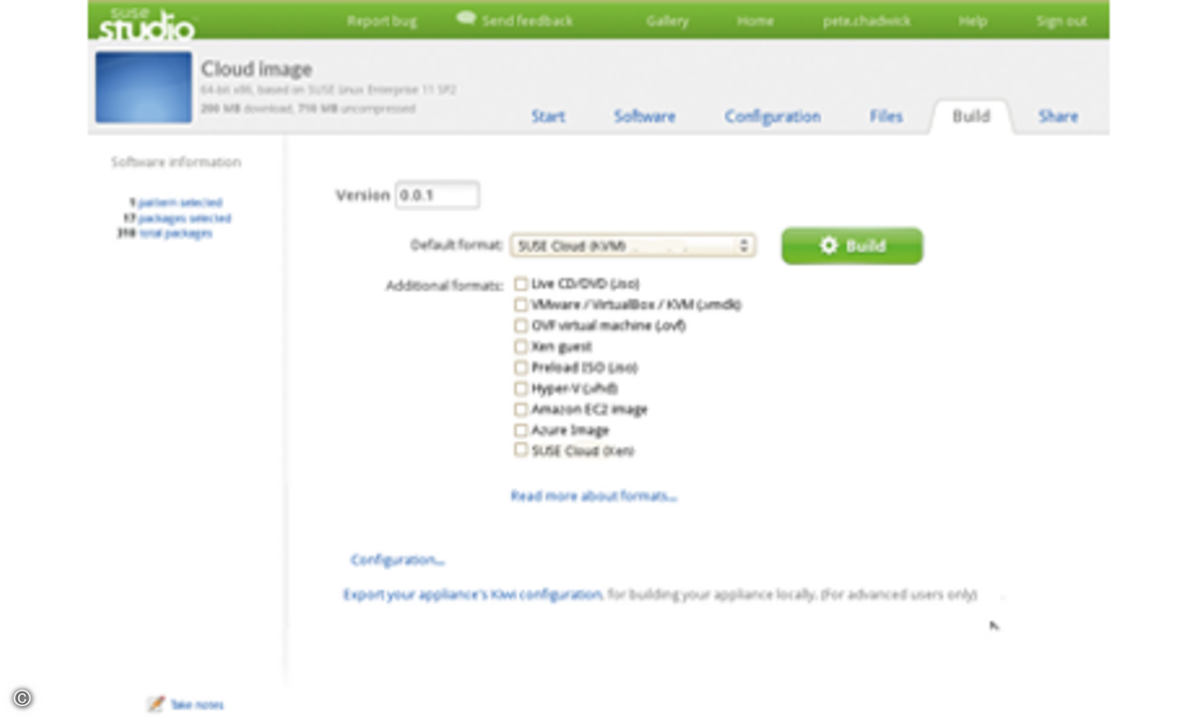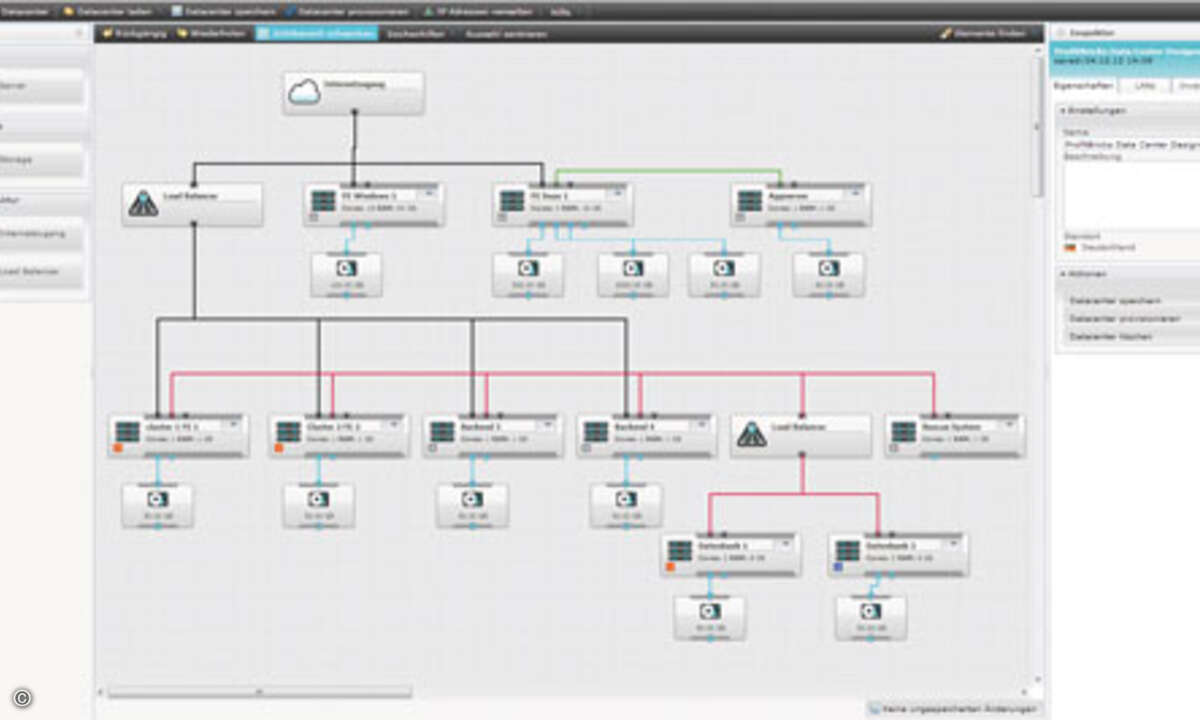Public Private Partnership: Viel Potenzial, wenig genutzt (Fortsetzung)
- Public Private Partnership: Viel Potenzial, wenig genutzt
- Public Private Partnership: Viel Potenzial, wenig genutzt (Fortsetzung)

Kosten runter, Qualität rauf
In den letzten Jahren wurden einige innovative Betreibermodelle des Bundes gestartet, beispielsweise in Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen oder in Bayern. Das Internet-Portal der Stadt Esslingen ist ein gutes Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit von öffentlichen und privaten Partnern. Die Dienstleistungen ECommerce, E-Community und E-Government sollten durch den privaten Partner vereint und die überregionale Vermarktung der Anwendungen von MEDIA@Komm-Stadt Esslingen erschlossen werden. Hauptkriterien für die Auswahl des Projektes waren: Effizienz, finanzielle Vorteile, Innovation, Durchführbarkeit und Risikomanagement.
Die ausgewählte Konzeption wurde als Verbundprojekt unter Beteiligung von acht Partnern der Wirtschaft und der Stadt realisiert. Die privaten Partner haben Lösungen geliefert, die Standardisierung, Einbindung der elektronischen Signatur bei rechtsverbindlicher elektronischer Antragstellung und Wissenstransfer ermöglichen.
Durch das Projekt konnten elektronische Verwaltungsdienste entwickelt und Einsparpotenziale bei Melderegisterauskünften, Bauanfragen und Gewerbemeldungen erzielt werden. Die Zusammenarbeit der öffentlichen und privaten Partner bei dem Relaunch der städtischen Homepage führte gegenüber einem städtischen Eigenbetrieb zu erheblicher Kosteneinsparung, gleichzeitig stieg die Servicequalität des Portalangebotes.
Um auf kommunaler Ebene ein ausreichend tragfähiges Vergütungsmodell auf die Beine zu stellen, kann man unter drei grundlegenden strategischen Finanzierungsquellen wählen. Das »Public Funding«-Modell basiert überwiegend auf einer Globalfinanzierung durch die Kommune, die bisher am häufigsten anzutreffende Variante. Das Refinanzierungsmodell setzt auf einen Einnahmemix aus Prozesskosteneinsparungen in der Verwaltung, Online-Werbung und ECommerce, Consulting und der Vermarktung von Lizenzen. Im dritten Modell ? dem transaktionsbasierten Modell ? erhält der Betreiber von der Kommune und den Portalkunden Transaktionsgebühren für die zur Verfügung gestellten E-Services. Letztlich ist es Aufgabe der Verantwortlichen, aus diesen drei Betreibermodellen die beste Komposition für die spezifischen Belange vor Ort zu wählen. Erfolgsvoraussetzungen
In Europa und den USA werden bereits verschiedene Vergütungs- und Betreibermodelle genutzt. Länder wie Großbritannien oder USA setzen PPP gezielt ein, um ihre Verwaltungen zu modernisieren. In Amerika verwendet man zum Beispiel das Konzept Sharein-Savings: Die Investitionen für neue Hard- oder Software übernimmt dabei der private Partner. Die Vergütung ist gestaffelt nach den Einsparungen, die der öffentliche Partner durch die neue Technik erzielt.
Damit PPP-Modelle Erfolg haben, sind die Finanzierungsaspekte bereits bei der Konzeption der Vergabemodalitäten zu berücksichtigen. Eine weitere Erfolgsvoraussetzung: Partnerschaftsmodelle, die das Synergiepotenzial auf beiden Seiten nutzen ? jeder übernimmt die Aufgaben, die er am effektivsten leisten kann.
Peter Krolle ist Partner Senior Manager Public Sector bei Steria Mummert Consulting