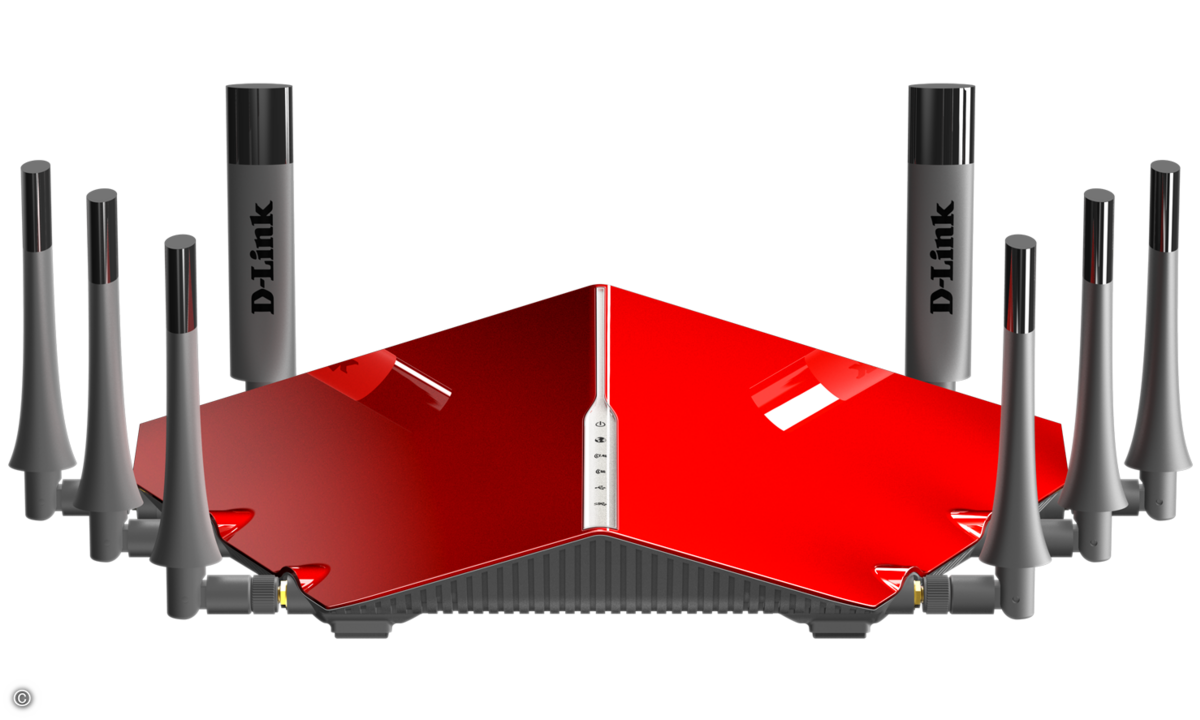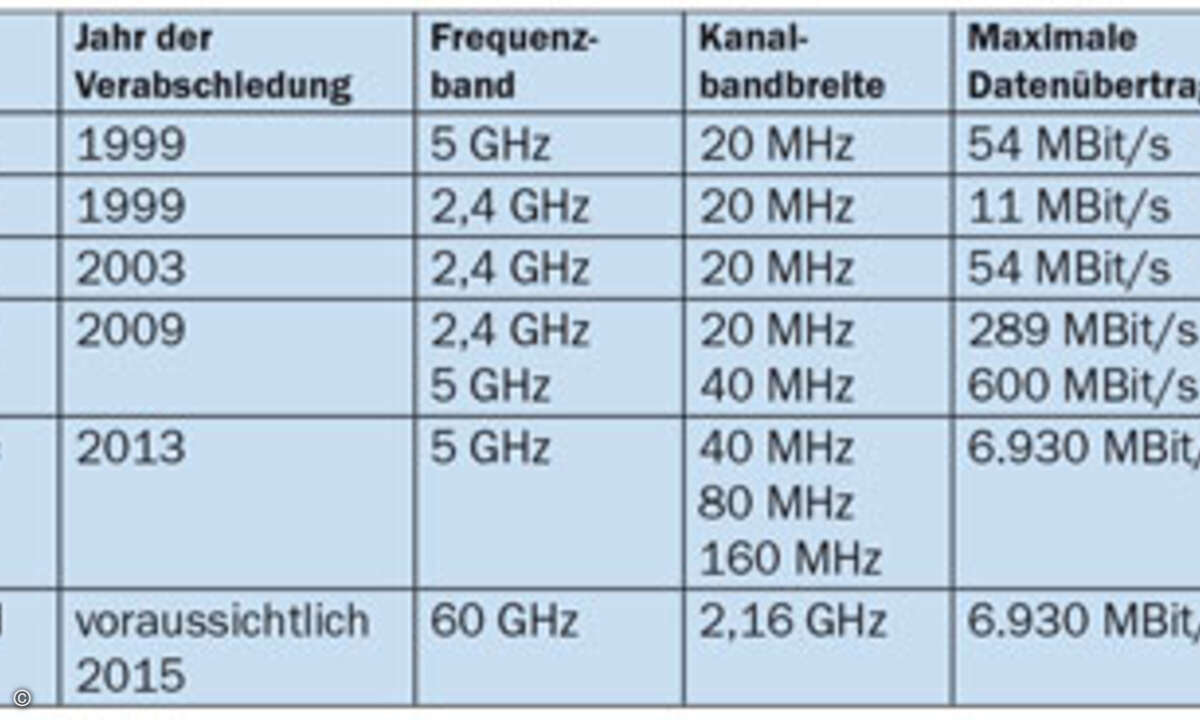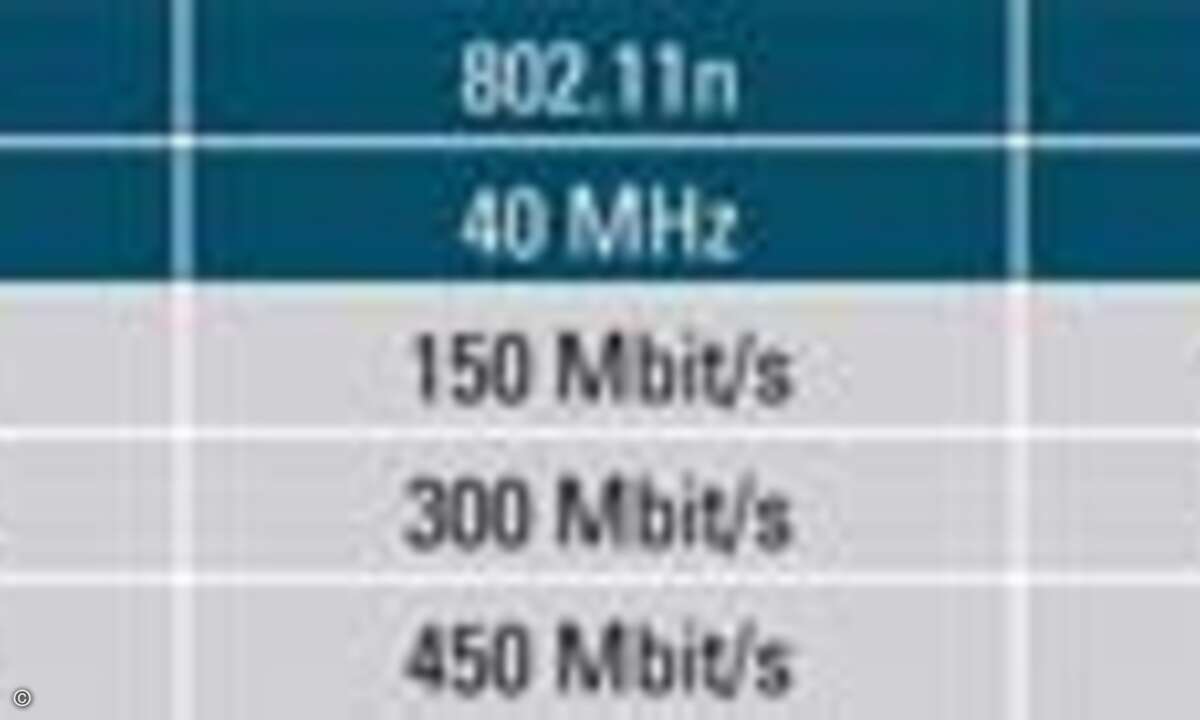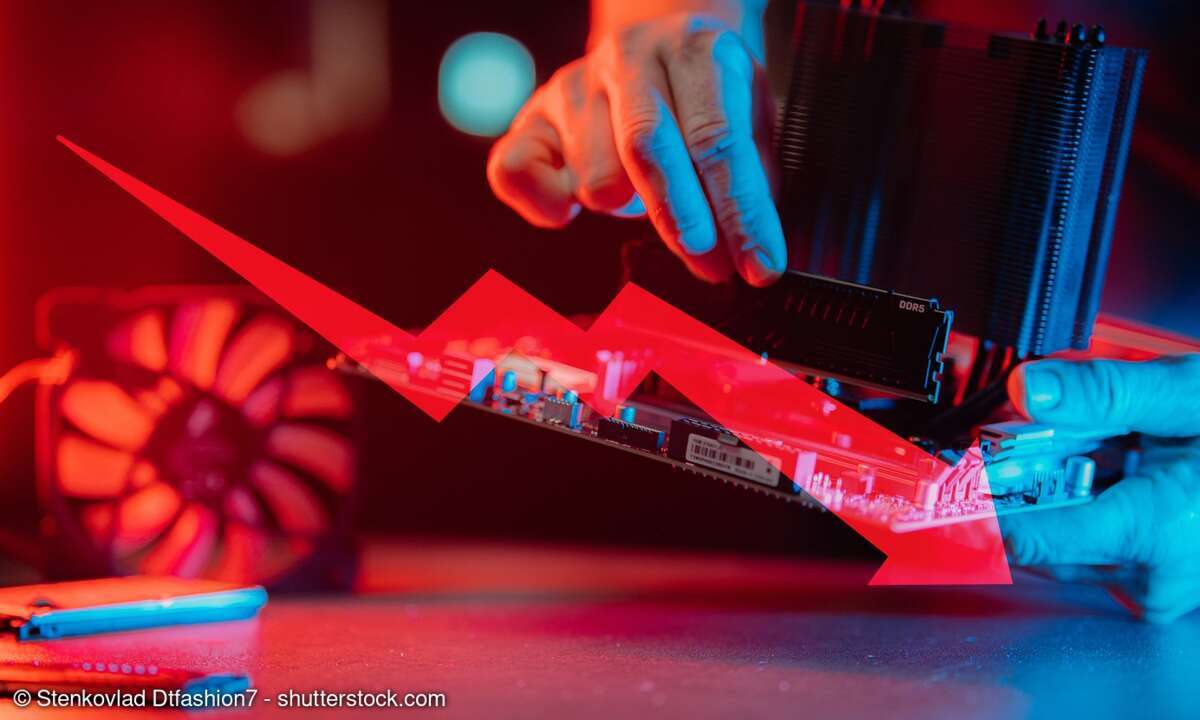Smog in der Messehalle (Fortsetzung)
- Smog in der Messehalle
- Smog in der Messehalle (Fortsetzung)
- Smog in der Messehalle (Fortsetzung)
- Smog in der Messehalle (Fortsetzung)

Im folgenden Schritt werden ebenfalls aus einer in das Programm integrierten Datenbank Access-Points beziehungsweise die an diese Access-Points montierten Antennen mit unterschiedlichen 3D-Charakteristiken ausgewählt. Die Anordnung der Access-Points im Gebäude sollte eine flächendeckende Verfügbarkeit von mindestens -70 dBm Empfangssignalstärke ermöglichen. Die editierbaren Eigenschaften eines virtuellen Access-Points sind der Name, die Sendeleistung (typischerweise 16 dBm), das Frequenzband beziehungsweise der verwendete IEEE-Standard und die Kanalnummer. Weiterhin müssen bei gerichteten Antennencharakteristiken der Montagewinkel in der horizontalen und in der vertikalen Ebene an die real zu konfigurierenden Gegebenheiten angepasst werden. Die Montagehöhe der Access-Points über der jeweiligen Geschossebene beeinflusst ebenfalls die Ausbreitung der Funkzelle.
Am Anfang des Planungsprozesses haben wir den Einsatz von gerichtete Antennen von Huber & Suhner vorgesehen. Die Antennencharakteristik beeinflusst die Ausprägung der Funkzelle. Die definierte Vorzugsrichtung lässt sich ebenfalls aus der Visualisierung der Verteilung der Empfangssignalstärke ablesen. Aus logistischen Gründen haben wir später omnidirektionale Standardantennen der Altitude-Access-Points von Extreme Networks eingesetzt.
Die WLAN-Planung durch Simulation birgt einige Planungsrisiken. Hierzu zählen
- Fehlerhafte Bemaßung,
- nicht oder unzureichend beschriebene Wandmaterialien,
- falsche oder nicht aktuelle Planungszeichnungen sowie
- falsch konfigurierte virtuelle Access-Points.
Die Beschaffung der korrekten und aktuellen Planungsdaten sollte Aufgabe des künftigen WLAN-Betreibers sein. Im Idealfall kann eine WLAN-Simulation die genauen Standorte der Access-Points vorgeben und die Montage der Access-Points ohne spätere kostspielige Verlagerungen vorgenommen werden.
Empfehlenswert ist zusätzlich eine Standortbegehung. Hierbei werden die Funkzellen von temporär an den geplanten Montagepunkten platzierten Access-Points mittels einer Site-Survey-Software auf die Etagengrundrisse gemapt. Für die Planung des Interopnet-WLANs haben wir einen Vororttermin durchgeführt und eine Beispielfunkzelle mittels der Ekahau-Site-Survey-Software gemapt. Zum Zeitpunkt einer solchen Planungsbegehung sollte natürlich das zu begehende Gebäude im Endausbau sein. Kurz gesagt, eine Planungsbegehung in einer Büroetage ohne Trennwände oder die Begehung einer Lagerhalle mit leeren Regalen macht wenig Sinn. Die Begehung in der völlig leeren Messehalle in unserem Beispiel brachte vor allem die Erkenntnis, dass eine als relativ gering anzusehende Anzahl von vier Access-Points tatsächlich ausreicht, um die Halle komplett und mit ausreichender Redundanz zu versorgen. Allein die Ausdehnung einer omnidirektionalen WLAN-Zelle versorgt die gesamte Halle mit mindestens -70 dBm im 2,4-GHz-Band.
Unter Beachtung der vorhergehenden Bemerkungen kann eine Planungsbegehung die zuvor aufgeführten Planungsrisiken auf ein Minimum reduzieren. Die dabei erzeugten Karten mit den Verteilungen der Empfangssignalstärken, der Signal-Rauschabstände, der Interferenzen, den Redundanzen und den zu erwartenden Datenraten stellen bereits eine umfangreiche und genaue Dokumentation der künftigen WLAN-Infrastruktur dar.